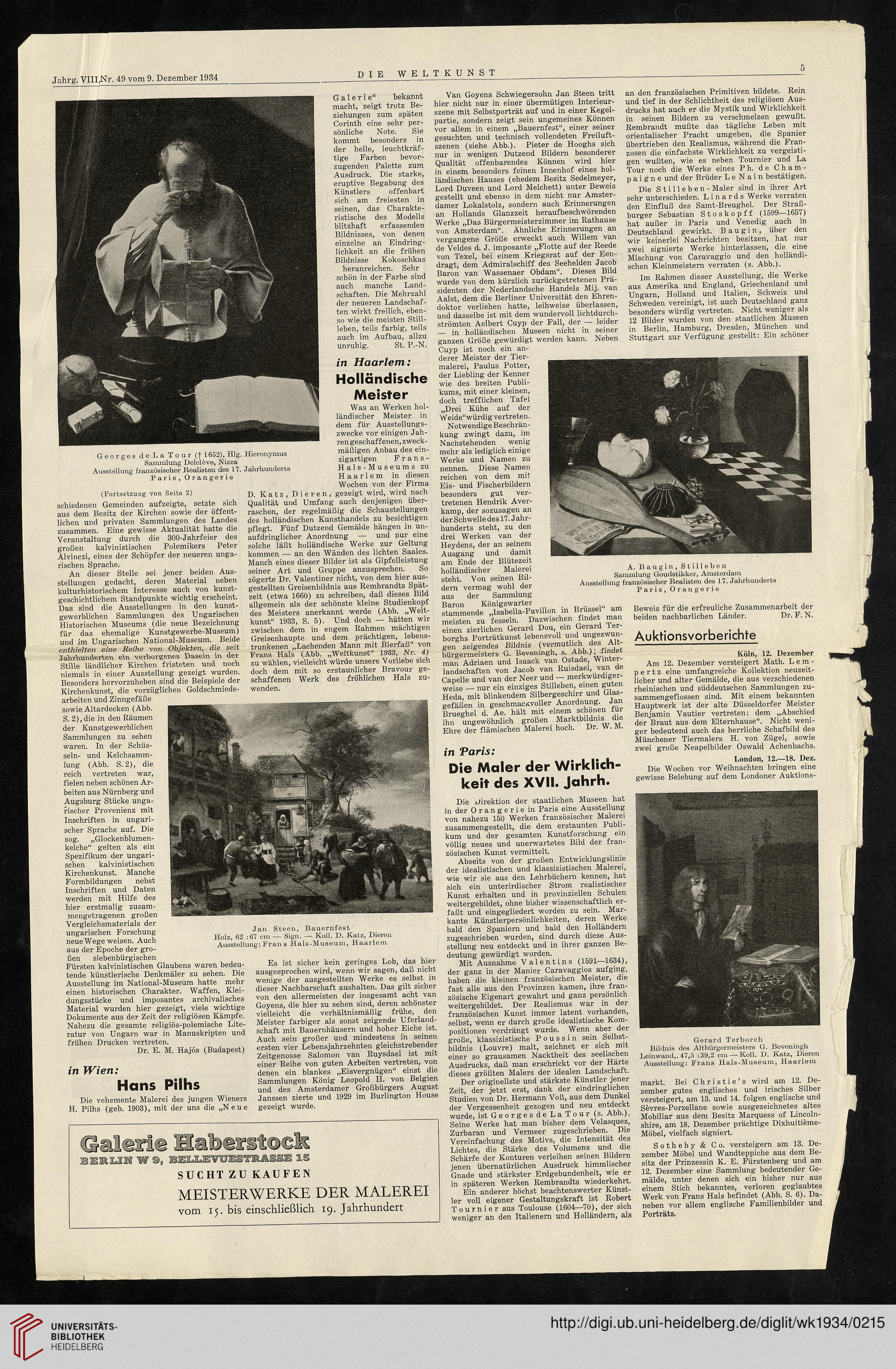Jahrg. VIIIfNr. 49 vom 9. Dezember 1934
DIE WELTKUNST
5
Georges de La Tour (f 1652), Hlg. Hieronymus
Sammlung Deleleve, Nizza
Ausstellung französischer Bealisten des 17. Jahrhunderts
Paris, Orangerie
(Fortsetzung von Seite 2)
schiedenen Gemeinden aufzeigte, setzte sich
aus dem Besitz der Kirchen sowie der öffent-
lichen und privaten Sammlungen des Landes
zusammen. Eine gewisse Aktualität hatte die
Veranstaltung durch die 300-Jahrfeier des
großen kalvinistischen Polemikers Peter
Alvinczi, eines der Schöpfer der neueren unga-
rischen Sprache.
An dieser Stelle sei jener beiden Aus-
stellungen gedacht, deren Material neben
kulturhistorischem Interesse auch von kunst-
geschichtlichem Standpunkte wichtig erscheint.
Das sind die Ausstellungen in den kunst-
gewerblichen Sammlungen des Ungarischen
Historischen Museums (die neue Bezeichnung
für das ehemalige Kunstgewerbe-Museum)
und im Ungarischen National-Museum. Beide
enthielten eine Reihe von Objekten, die seit
Jahrhunderten ein verborgenes Dasein in der
Stille ländlicher Kirchen fristeten und noch
niemals in einer Ausstellung gezeigt wurden.
Besonders hervorzuheben sind die Beispiele der
Kirchenkunst, die vorzüglichen Goldschmiede-
arbeiten und Zinngefäße
sowie Altardecken (Abb.
S. 2), die in den Räumen
der Kunstgewerblichen
Sammlungen zu sehen
waren. In der Schüs¬
seln- und Kelchsamm¬
lung (Abb. S. 2), die
reich vertreten war,
fielen neben schönen Ar¬
beiten aus Nürnberg und
Augsburg Stücke unga¬
rischer Provenienz mit
Inschriften in ungari¬
scher Sprache auf. Die
sog. „Glockenblumen¬
kelche“ gelten als ein
Spezifikum der ungari¬
schen kalvinistischen
Kirchenkunst. Manche
Formbildungen nebst
Inschriften und Daten
werden mit Hilfe des
hier erstmalig zusam¬
mengetragenen großen
Vergleichsmaterials der
ungarischen Forschung
neue Wege weisen. Auch
aus der Epoche der gro¬
ßen siebenbürgischen
Fürsten kalvinistischen Glaubens waren bedeu-
tende künstlerische Denkmäler zu sehen. Die
Ausstellung im National-Museum hatte mehr
einen historischen Charakter. Waffen, Klei-
dungsstücke und imposantes archivalisches
Material wurden hier gezeigt, viele wichtige
Dokumente aus der Zeit der religiösen Kämpfe.
Nahezu die gesamte religiös-polemische Lite-
ratur von Ungarn war in Manuskripten und
frühen Drucken vertreten.
Dr. E. M. Hajos (Budapest)
in Wien:
Hans Pilhs
Die vehemente Malerei des jungen Wieners
H. Pilhs (geb. 1903), mit der uns die „Neue
Galerie“ bekannt
macht, zeigt trotz Be-
ziehungen zum späten
Corinth eine sehr per-
sönliche Note. Sie
kommt besonders in
der helle, leuchtkräf-
tige Farben bevor-
zugenden Palette zum
Ausdruck. Die starke,
eruptive Begabung des
Künstlers offenbart
sich am freiesten in
seinen, das Charakte-
ristische des Modells
blitzhaft erfassenden
Bildnisses, von denen
einzelne an Eindring-
lichkeit an die frühen
Bildnisse Kokoschkas
heranreichen. Sehr
schön in der Farbe sind
auch manche Land-
schaften. Die Mehrzahl
der neueren Landschaf-
ten wirkt freilich, eben-
so wie die meisten Still-
leben, teils farbig, teils
auch im Aufbau, allzu
unruhig. St. P.-N.
in Haarlem:
Holländische
Meister
Was an Werken hol-
ländischer Meister in
dem für Ausstellungs-
zwecke vor einigen Jah-
ren geschaffenen, zweck-
mäßigen Anbau des ein-
zigartigen Frans-
Hals-Museums zu
Haarlem in diesen
Wochen von der Firma
D. Katz, Die r en, gezeigt wird, wird nach
Qualität und Umfang auch denjenigen über-
raschen, der regelmäßig die Schaustellungen
des holländischen Kunsthandels zu besichtigen
pflegt. Fünf Dutzend Gemälde hängen in un-
aufdringlicher Anordnung — und nur eine
solche läßt holländische Werke zur Geltung
kommen — an den Wänden des lichten Saales.
Manch eines dieser Bilder ist als Gipfelleistung
seiner Art und Gruppe anzusprechen. So
zögerte Dr. Valentiner nicht, von dem hier aus-
gestellten Greisenbildnis aus Rembrandts Spät-
zeit (etwa 1660) zu schreiben, daß dieses Bild
allgemein als der schönste kleine Studienkopf
des Meisters anerkannt werde (Abb. „Welt-
kunst“ 1933, S. 5). Und doch — hätten wir
zwischen dem in engem Rahmen mächtigen
Greisenhaupte und dem prächtigen, lebens-
trunkenen „Lachenden Mann mit Bierfaß“ von
Frans Hals (Abb. „Weltkunst“ 1933, Nr. 4)
zu wählen, vielleicht würde unsere Vorliebe sich
doch dem mit so erstaunlicher Bravour ge-
schaffenen Werk des fröhlichen Hals zu-
wenden.
Es ist sicher kein geringes Lob, das hier
ausgesprochen wird, wenn wir sagen, daß nicht
wenige der ausgestellten Werke es selbst in
dieser Nachbarschaft aushalten. Das gilt sicher
von den allermeisten der insgesamt acht van
Goyens, die hier zu sehen sind, deren schönster
vielleicht die verhältnismäßig frühe, den
Meister farbiger als sonst zeigende Uferland-
schaft mit Bauernhäusern und hoher Eiche ist.
Auch sein großer und mindestens in seinen
ersten vier Lebensjahrzehnten gleichstrebender
Zeitgenosse Salomon van Ruysdael ist mit
einer Reihe von guten Arbeiten vertreten, von
denen ein blankes „Eisvergnügen“ einst die
Sammlungen König Leopold II. von Belgien
und des Amsterdamer Großbürgers August
Janssen zierte und 1929 im Burlington House
gezeigt wurde.
Jan Steen, Bauernfest
Holz, 62 :67 cm — Sign. — Koll. D. Katz, Dieren
Ausstellung: Fran s Hals-Museum, Haarlem
W 3.5
SUCHT ZU KAUFEN
MEISTERWERKE DER MALEREI
vom 15. bis einschließlich 19. Jahrhundert
Van Goyens Schwiegersohn Jan Steen tritt
hier nicht nur in einer übermütigen Interieur-
szene mit Selbstporträt auf und in einer Kegel-
partie, sondern zeigt sein ungemeines Können
vor allem in einem „Bauernfest“, einer seiner
gesuchten und technisch vollendeten Freiluft-
szenen (siehe Abb.). Pieter de Hooghs sich
nur in wenigen Dutzend Bildern besonderer
Qualität offenbarendes Können wird hier
in einem besonders feinen Innenhof eines hol-
ländischen Hauses (ehedem Besitz Sedelmeyer,
Lord Duveen und Lord Melchett) unter Beweis
gestellt und ebenso in dem nicht nur Amster-
damer Lokalstolz, sondern auch Erinnerungen
an Hollands Glanzzeit heraufbeschwörenden
Werke „Das Bürgermeisterzimmer im Rathause
von Amsterdam“. Ähnliche Erinnerungen an
vergangene Größe erweckt auch Willem van
de Veldes d. J. imposante „Flotte auf der Reede
von Texel, bei einem Kriegsrat auf der Een-
dragt, dem Admiralschiff des Seehelden Jacob
Baron van Wassenaer Obdam“. Dieses Bild
wurde von dem kürzlich zurückgetretenen Prä-
sidenten der Nederlandsche Handels Mij. van
Aalst, dem die Berliner Universität den Ehren-
doktor verliehen hatte, leihweise überlassen,
und dasselbe ist mit dem wundervoll lichtdurch-
strömten Aelbert Cuyp der Fall, der — leider
—- in holländischen Museen nicht in seiner
ganzen Größe gewürdigt werden kann. Neben
Cuyp ist noch ein an¬
derer Meister der Tier¬
malerei, Paulus Potter,
der Liebling der Kenner
wie des breiten Publi¬
kums, mit einer kleinen,
doch trefflichen Tafel
„Drei Kühe auf der
Weide“ würdig vertreten.
N otwendige Beschrän-
kung zwingt dazu, im
Nachstehenden wenig
mehr als lediglich einige
Werke und Namen zu
nennen. Diese Namen
reichen von dem mit
Eis- und Fischerbildern
besonders gut ver¬
tretenen Hendrik Aver-
kamp, der sozusagen an
der Schwelle des 17. Jahr-
hunderts steht, zu den
drei Werken van der
Heydens, der an seinem
Ausgang und damit
am Ende der Blütezeit
holländischer Malerei
steht. Von seinen Bil-
dern vermag wohl der
aus der Sammlung
Baron Königswarter
stammende „Isabella-Pavillon in Brüssel“ am
meisten zu fesseln. Dazwischen findet man
einen zierlichen Gerard Dou, ein Gerard Ter-
borghs Porträtkunst lebensvoll und ungezwun-
gen zeigendes Bildnis (vermutlich des Alt-
bürgermeisters G. Beveningh, s. Abb.); findet
man Adriaen und Isaack van Ostade, Winter-
landschaften von Jacob van Ruisdael, van de
Capelle und van der Neer und — merkwürdiger-
weise — nur ein einziges Stilleben, einen guten
Heda, mit blinkendem Silbergeschirr und Glas-
gefäßen in geschmacKvoller Anordnung. Jan
Brueghel d. Ae. hält mit einem schönen für
ihn ungewöhnlich großen Marktbildnis die
Ehre der flämischen Malerei hoch. Dr. W. M.
in Paris:
Die Maler der Wirklich-
keit des XVII. Jahrh.
Die Direktion der staatlichen Museen hat
in der Orangerie in Paris eine Ausstellung
von nahezu 150 Werken französischer Malerei
zusammengestellt, die dem erstaunten Publi-
kum und der gesamten Kunstforschung ein
völlig neues und unerwartetes Bild der fran-
zösischen Kunst vermittelt.
Abseits von der großen Entwicklungslinie
der idealistischen und klassizistischen Malerei,
wie wir sie aus den Lehrbüchern kennen, hat
sich ein unterirdischer Strom realistischer
Kunst erhalten und in provinziellen Schulen
weitergebildet, ohne bisher wissenschaftlich er-
faßt und eingegliedert worden zu sein. Mar-
kante Künstlerpersönlichkeiten, deren Werke
bald den Spaniern und bald den Holländern
zugeschrieben wurden, sind durch diese Aus-
stellung neu entdeckt und in ihrer ganzen Be-
deutung gewürdigt worden.
Mit Ausnahme Valentins (1591—1634),
der ganz in der Manier Caravaggios aufging,
haben die kleinen französischen Meister, die
fast alle aus den Provinzen kamen, ihre fran-
zösische Eigenart gewahrt und ganz persönlich
weitergebildet. Der Realismus war in der
französischen Kunst immer latent vorhanden,
selbst, wenn er durch große idealistische Kom-
positionen verdrängt wurde. Wenn aber der
große, klassizistische P 0 u s s i n sein Selbst-
bildnis (Louvre) malt, zeichnet er sich mit
einer so grausamen Nacktheit des seelischen
Ausdrucks, daß man erschrickt vor der Härte
dieses größten Malers der idealen Landschaft.
Der originellste und stärkste Künstler jener
Zeit, der jetzt erst, dank der eindringlichen
Studien von Dr. Hermann Voß, aus dem Dunkel
der Vergessenheit gezogen und neu entdeckt
wurde, ist Georges de La Tour (s. Abb.).
Seine Werke hat man bisher dem Velasquez,
Zurbaran und Vermeer zugeschrieben. Die
Vereinfachung des Motivs, die Intensität des
Lichtes, die Stärke des Volumens und die
Schärfe der Konturen verleihen seinen Bildern
jenen übernatürlichen Ausdruck himmlischer
Gnade und stärkster Erdgebundenheit, wie er
in späteren Werken Rembrandts wiederkehrt.
Ein anderer höchst beachtenswerter Künst-
ler voll eigener Gestaltungskraft ist Robert
Tournier aus Toulouse (1604—70), der sich
weniger an den Italienern und Holländern, als
an den französischen Primitiven bildete. Rein
und tief in der Schlichtheit des religiösen Aus-
drucks hat auch er die Mystik und Wirklichkeit
in seinen Bildern zu verschmelzen gewußt.
Rembrandt mußte das tägliche Leben mit
orientalischer Pracht umgeben, die Spanier
übertrieben den Realismus, während die Fran-
zosen die einfachste Wirklichkeit zu vergeisti-
gen wußten, wie es neben Tournier und La
Tour noch die Werke eines Ph. de Cham-
p a i gn e und der Brüder Le N ai n bestätigen.
Die Stilleben - Maler sind in ihrer Art
sehr unterschieden. L i n a r d s Werke verraten
den Einfluß des Samt-Breughel. Der Straß-
burger Sebastian Stoskopff (1599—1657)
hat außer in Paris und Venedig auch in
Deutschland gewirkt. B a u g i n , über den
wir keinerlei Nachrichten besitzen, hat nur
zwei signierte Werke hinterlassen, die eine
Mischung von Caravaggio und den holländi-
schen Kleinmeistern verraten (s. Abb.).
Im Rahmen dieser Ausstellung, die Werke
aus Amerika und England, Griechenland und
Ungarn, Holland und Italien, Schweiz und
Schweden vereinigt, ist auch Deutschland ganz
besonders würdig vertreten. Nicht weniger als
12 Bilder wurden von den staatlichen Museen
in Berlin, Hamburg, Dresden, München und
Stuttgart zur Verfügung gestellt: Ein schöner
Beweis für die erfreuliche Zusammenarbeit der
beiden nachbarlichen Länder. Dr. F. N.
Auktionsvorberichte
Köln, 12. Dezember
Am 12. Dezember versteigert Math. Lem-
p e r t z eine umfangreiche Kollektion neuzeit-
licher und alter Gemälde, die aus verschiedenen
rheinischen und süddeutschen Sammlungen zu-
sammengeflossen sind. Mit einem bekannten
Hauptwerk ist der alte Düsseldorfer Meister
Benjamin Vautier vertreten: dem „Abschied
der Braut aus dem Elternhause“. Nicht weni-
ger bedeutend auch das herrliche Schafbild des
Münchener Tiermalers H. von Zügel, sowie
zwei große Neapelbilder Oswald Achenbachs.
Gerard Terborch
Bildnis des Altbürgermeisters G. Beveningh
Leinwand,, 47,5 :39,2 em—-Koll. D. Katz, Dieren
Ausstellung: Frans Hals-Museum, Haarlem
markt. Bei Christie’s wird am 12. De-
zember gutes englisches und irisches Silber
versteigert, am 13. und 14. folgen englische und
Sevres-Porzellane sowie ausgezeichnetes altes
Mobiliar aus dem Besitz Marquess of Lincoln-
shire, am 18. Dezember prächtige Dixhuitieme-
Möbel, vielfach signiert.
Sotheby & Co. versteigern am 13. De-
zember Möbel und Wandteppiche aus dem Be-
sitz der Prinzessin K. E. Fürstenberg und am
12. Dezember eine Sammlung bedeutender Ge-
mälde, unter denen sich ein bisher nur aus
einem Stich bekanntes, verloren geglaubtes
Werk von Frans Hals befindet (Abb. S. 6). Da-
neben vor allem englische Familienbilder und
Porträts.
A. Baugin, Stilleben
Sammlung Goudstikker, Amsterdam
Ausstellung französischer Realisten des 17. Jahrhunderts
Paris, Orangerie
DIE WELTKUNST
5
Georges de La Tour (f 1652), Hlg. Hieronymus
Sammlung Deleleve, Nizza
Ausstellung französischer Bealisten des 17. Jahrhunderts
Paris, Orangerie
(Fortsetzung von Seite 2)
schiedenen Gemeinden aufzeigte, setzte sich
aus dem Besitz der Kirchen sowie der öffent-
lichen und privaten Sammlungen des Landes
zusammen. Eine gewisse Aktualität hatte die
Veranstaltung durch die 300-Jahrfeier des
großen kalvinistischen Polemikers Peter
Alvinczi, eines der Schöpfer der neueren unga-
rischen Sprache.
An dieser Stelle sei jener beiden Aus-
stellungen gedacht, deren Material neben
kulturhistorischem Interesse auch von kunst-
geschichtlichem Standpunkte wichtig erscheint.
Das sind die Ausstellungen in den kunst-
gewerblichen Sammlungen des Ungarischen
Historischen Museums (die neue Bezeichnung
für das ehemalige Kunstgewerbe-Museum)
und im Ungarischen National-Museum. Beide
enthielten eine Reihe von Objekten, die seit
Jahrhunderten ein verborgenes Dasein in der
Stille ländlicher Kirchen fristeten und noch
niemals in einer Ausstellung gezeigt wurden.
Besonders hervorzuheben sind die Beispiele der
Kirchenkunst, die vorzüglichen Goldschmiede-
arbeiten und Zinngefäße
sowie Altardecken (Abb.
S. 2), die in den Räumen
der Kunstgewerblichen
Sammlungen zu sehen
waren. In der Schüs¬
seln- und Kelchsamm¬
lung (Abb. S. 2), die
reich vertreten war,
fielen neben schönen Ar¬
beiten aus Nürnberg und
Augsburg Stücke unga¬
rischer Provenienz mit
Inschriften in ungari¬
scher Sprache auf. Die
sog. „Glockenblumen¬
kelche“ gelten als ein
Spezifikum der ungari¬
schen kalvinistischen
Kirchenkunst. Manche
Formbildungen nebst
Inschriften und Daten
werden mit Hilfe des
hier erstmalig zusam¬
mengetragenen großen
Vergleichsmaterials der
ungarischen Forschung
neue Wege weisen. Auch
aus der Epoche der gro¬
ßen siebenbürgischen
Fürsten kalvinistischen Glaubens waren bedeu-
tende künstlerische Denkmäler zu sehen. Die
Ausstellung im National-Museum hatte mehr
einen historischen Charakter. Waffen, Klei-
dungsstücke und imposantes archivalisches
Material wurden hier gezeigt, viele wichtige
Dokumente aus der Zeit der religiösen Kämpfe.
Nahezu die gesamte religiös-polemische Lite-
ratur von Ungarn war in Manuskripten und
frühen Drucken vertreten.
Dr. E. M. Hajos (Budapest)
in Wien:
Hans Pilhs
Die vehemente Malerei des jungen Wieners
H. Pilhs (geb. 1903), mit der uns die „Neue
Galerie“ bekannt
macht, zeigt trotz Be-
ziehungen zum späten
Corinth eine sehr per-
sönliche Note. Sie
kommt besonders in
der helle, leuchtkräf-
tige Farben bevor-
zugenden Palette zum
Ausdruck. Die starke,
eruptive Begabung des
Künstlers offenbart
sich am freiesten in
seinen, das Charakte-
ristische des Modells
blitzhaft erfassenden
Bildnisses, von denen
einzelne an Eindring-
lichkeit an die frühen
Bildnisse Kokoschkas
heranreichen. Sehr
schön in der Farbe sind
auch manche Land-
schaften. Die Mehrzahl
der neueren Landschaf-
ten wirkt freilich, eben-
so wie die meisten Still-
leben, teils farbig, teils
auch im Aufbau, allzu
unruhig. St. P.-N.
in Haarlem:
Holländische
Meister
Was an Werken hol-
ländischer Meister in
dem für Ausstellungs-
zwecke vor einigen Jah-
ren geschaffenen, zweck-
mäßigen Anbau des ein-
zigartigen Frans-
Hals-Museums zu
Haarlem in diesen
Wochen von der Firma
D. Katz, Die r en, gezeigt wird, wird nach
Qualität und Umfang auch denjenigen über-
raschen, der regelmäßig die Schaustellungen
des holländischen Kunsthandels zu besichtigen
pflegt. Fünf Dutzend Gemälde hängen in un-
aufdringlicher Anordnung — und nur eine
solche läßt holländische Werke zur Geltung
kommen — an den Wänden des lichten Saales.
Manch eines dieser Bilder ist als Gipfelleistung
seiner Art und Gruppe anzusprechen. So
zögerte Dr. Valentiner nicht, von dem hier aus-
gestellten Greisenbildnis aus Rembrandts Spät-
zeit (etwa 1660) zu schreiben, daß dieses Bild
allgemein als der schönste kleine Studienkopf
des Meisters anerkannt werde (Abb. „Welt-
kunst“ 1933, S. 5). Und doch — hätten wir
zwischen dem in engem Rahmen mächtigen
Greisenhaupte und dem prächtigen, lebens-
trunkenen „Lachenden Mann mit Bierfaß“ von
Frans Hals (Abb. „Weltkunst“ 1933, Nr. 4)
zu wählen, vielleicht würde unsere Vorliebe sich
doch dem mit so erstaunlicher Bravour ge-
schaffenen Werk des fröhlichen Hals zu-
wenden.
Es ist sicher kein geringes Lob, das hier
ausgesprochen wird, wenn wir sagen, daß nicht
wenige der ausgestellten Werke es selbst in
dieser Nachbarschaft aushalten. Das gilt sicher
von den allermeisten der insgesamt acht van
Goyens, die hier zu sehen sind, deren schönster
vielleicht die verhältnismäßig frühe, den
Meister farbiger als sonst zeigende Uferland-
schaft mit Bauernhäusern und hoher Eiche ist.
Auch sein großer und mindestens in seinen
ersten vier Lebensjahrzehnten gleichstrebender
Zeitgenosse Salomon van Ruysdael ist mit
einer Reihe von guten Arbeiten vertreten, von
denen ein blankes „Eisvergnügen“ einst die
Sammlungen König Leopold II. von Belgien
und des Amsterdamer Großbürgers August
Janssen zierte und 1929 im Burlington House
gezeigt wurde.
Jan Steen, Bauernfest
Holz, 62 :67 cm — Sign. — Koll. D. Katz, Dieren
Ausstellung: Fran s Hals-Museum, Haarlem
W 3.5
SUCHT ZU KAUFEN
MEISTERWERKE DER MALEREI
vom 15. bis einschließlich 19. Jahrhundert
Van Goyens Schwiegersohn Jan Steen tritt
hier nicht nur in einer übermütigen Interieur-
szene mit Selbstporträt auf und in einer Kegel-
partie, sondern zeigt sein ungemeines Können
vor allem in einem „Bauernfest“, einer seiner
gesuchten und technisch vollendeten Freiluft-
szenen (siehe Abb.). Pieter de Hooghs sich
nur in wenigen Dutzend Bildern besonderer
Qualität offenbarendes Können wird hier
in einem besonders feinen Innenhof eines hol-
ländischen Hauses (ehedem Besitz Sedelmeyer,
Lord Duveen und Lord Melchett) unter Beweis
gestellt und ebenso in dem nicht nur Amster-
damer Lokalstolz, sondern auch Erinnerungen
an Hollands Glanzzeit heraufbeschwörenden
Werke „Das Bürgermeisterzimmer im Rathause
von Amsterdam“. Ähnliche Erinnerungen an
vergangene Größe erweckt auch Willem van
de Veldes d. J. imposante „Flotte auf der Reede
von Texel, bei einem Kriegsrat auf der Een-
dragt, dem Admiralschiff des Seehelden Jacob
Baron van Wassenaer Obdam“. Dieses Bild
wurde von dem kürzlich zurückgetretenen Prä-
sidenten der Nederlandsche Handels Mij. van
Aalst, dem die Berliner Universität den Ehren-
doktor verliehen hatte, leihweise überlassen,
und dasselbe ist mit dem wundervoll lichtdurch-
strömten Aelbert Cuyp der Fall, der — leider
—- in holländischen Museen nicht in seiner
ganzen Größe gewürdigt werden kann. Neben
Cuyp ist noch ein an¬
derer Meister der Tier¬
malerei, Paulus Potter,
der Liebling der Kenner
wie des breiten Publi¬
kums, mit einer kleinen,
doch trefflichen Tafel
„Drei Kühe auf der
Weide“ würdig vertreten.
N otwendige Beschrän-
kung zwingt dazu, im
Nachstehenden wenig
mehr als lediglich einige
Werke und Namen zu
nennen. Diese Namen
reichen von dem mit
Eis- und Fischerbildern
besonders gut ver¬
tretenen Hendrik Aver-
kamp, der sozusagen an
der Schwelle des 17. Jahr-
hunderts steht, zu den
drei Werken van der
Heydens, der an seinem
Ausgang und damit
am Ende der Blütezeit
holländischer Malerei
steht. Von seinen Bil-
dern vermag wohl der
aus der Sammlung
Baron Königswarter
stammende „Isabella-Pavillon in Brüssel“ am
meisten zu fesseln. Dazwischen findet man
einen zierlichen Gerard Dou, ein Gerard Ter-
borghs Porträtkunst lebensvoll und ungezwun-
gen zeigendes Bildnis (vermutlich des Alt-
bürgermeisters G. Beveningh, s. Abb.); findet
man Adriaen und Isaack van Ostade, Winter-
landschaften von Jacob van Ruisdael, van de
Capelle und van der Neer und — merkwürdiger-
weise — nur ein einziges Stilleben, einen guten
Heda, mit blinkendem Silbergeschirr und Glas-
gefäßen in geschmacKvoller Anordnung. Jan
Brueghel d. Ae. hält mit einem schönen für
ihn ungewöhnlich großen Marktbildnis die
Ehre der flämischen Malerei hoch. Dr. W. M.
in Paris:
Die Maler der Wirklich-
keit des XVII. Jahrh.
Die Direktion der staatlichen Museen hat
in der Orangerie in Paris eine Ausstellung
von nahezu 150 Werken französischer Malerei
zusammengestellt, die dem erstaunten Publi-
kum und der gesamten Kunstforschung ein
völlig neues und unerwartetes Bild der fran-
zösischen Kunst vermittelt.
Abseits von der großen Entwicklungslinie
der idealistischen und klassizistischen Malerei,
wie wir sie aus den Lehrbüchern kennen, hat
sich ein unterirdischer Strom realistischer
Kunst erhalten und in provinziellen Schulen
weitergebildet, ohne bisher wissenschaftlich er-
faßt und eingegliedert worden zu sein. Mar-
kante Künstlerpersönlichkeiten, deren Werke
bald den Spaniern und bald den Holländern
zugeschrieben wurden, sind durch diese Aus-
stellung neu entdeckt und in ihrer ganzen Be-
deutung gewürdigt worden.
Mit Ausnahme Valentins (1591—1634),
der ganz in der Manier Caravaggios aufging,
haben die kleinen französischen Meister, die
fast alle aus den Provinzen kamen, ihre fran-
zösische Eigenart gewahrt und ganz persönlich
weitergebildet. Der Realismus war in der
französischen Kunst immer latent vorhanden,
selbst, wenn er durch große idealistische Kom-
positionen verdrängt wurde. Wenn aber der
große, klassizistische P 0 u s s i n sein Selbst-
bildnis (Louvre) malt, zeichnet er sich mit
einer so grausamen Nacktheit des seelischen
Ausdrucks, daß man erschrickt vor der Härte
dieses größten Malers der idealen Landschaft.
Der originellste und stärkste Künstler jener
Zeit, der jetzt erst, dank der eindringlichen
Studien von Dr. Hermann Voß, aus dem Dunkel
der Vergessenheit gezogen und neu entdeckt
wurde, ist Georges de La Tour (s. Abb.).
Seine Werke hat man bisher dem Velasquez,
Zurbaran und Vermeer zugeschrieben. Die
Vereinfachung des Motivs, die Intensität des
Lichtes, die Stärke des Volumens und die
Schärfe der Konturen verleihen seinen Bildern
jenen übernatürlichen Ausdruck himmlischer
Gnade und stärkster Erdgebundenheit, wie er
in späteren Werken Rembrandts wiederkehrt.
Ein anderer höchst beachtenswerter Künst-
ler voll eigener Gestaltungskraft ist Robert
Tournier aus Toulouse (1604—70), der sich
weniger an den Italienern und Holländern, als
an den französischen Primitiven bildete. Rein
und tief in der Schlichtheit des religiösen Aus-
drucks hat auch er die Mystik und Wirklichkeit
in seinen Bildern zu verschmelzen gewußt.
Rembrandt mußte das tägliche Leben mit
orientalischer Pracht umgeben, die Spanier
übertrieben den Realismus, während die Fran-
zosen die einfachste Wirklichkeit zu vergeisti-
gen wußten, wie es neben Tournier und La
Tour noch die Werke eines Ph. de Cham-
p a i gn e und der Brüder Le N ai n bestätigen.
Die Stilleben - Maler sind in ihrer Art
sehr unterschieden. L i n a r d s Werke verraten
den Einfluß des Samt-Breughel. Der Straß-
burger Sebastian Stoskopff (1599—1657)
hat außer in Paris und Venedig auch in
Deutschland gewirkt. B a u g i n , über den
wir keinerlei Nachrichten besitzen, hat nur
zwei signierte Werke hinterlassen, die eine
Mischung von Caravaggio und den holländi-
schen Kleinmeistern verraten (s. Abb.).
Im Rahmen dieser Ausstellung, die Werke
aus Amerika und England, Griechenland und
Ungarn, Holland und Italien, Schweiz und
Schweden vereinigt, ist auch Deutschland ganz
besonders würdig vertreten. Nicht weniger als
12 Bilder wurden von den staatlichen Museen
in Berlin, Hamburg, Dresden, München und
Stuttgart zur Verfügung gestellt: Ein schöner
Beweis für die erfreuliche Zusammenarbeit der
beiden nachbarlichen Länder. Dr. F. N.
Auktionsvorberichte
Köln, 12. Dezember
Am 12. Dezember versteigert Math. Lem-
p e r t z eine umfangreiche Kollektion neuzeit-
licher und alter Gemälde, die aus verschiedenen
rheinischen und süddeutschen Sammlungen zu-
sammengeflossen sind. Mit einem bekannten
Hauptwerk ist der alte Düsseldorfer Meister
Benjamin Vautier vertreten: dem „Abschied
der Braut aus dem Elternhause“. Nicht weni-
ger bedeutend auch das herrliche Schafbild des
Münchener Tiermalers H. von Zügel, sowie
zwei große Neapelbilder Oswald Achenbachs.
Gerard Terborch
Bildnis des Altbürgermeisters G. Beveningh
Leinwand,, 47,5 :39,2 em—-Koll. D. Katz, Dieren
Ausstellung: Frans Hals-Museum, Haarlem
markt. Bei Christie’s wird am 12. De-
zember gutes englisches und irisches Silber
versteigert, am 13. und 14. folgen englische und
Sevres-Porzellane sowie ausgezeichnetes altes
Mobiliar aus dem Besitz Marquess of Lincoln-
shire, am 18. Dezember prächtige Dixhuitieme-
Möbel, vielfach signiert.
Sotheby & Co. versteigern am 13. De-
zember Möbel und Wandteppiche aus dem Be-
sitz der Prinzessin K. E. Fürstenberg und am
12. Dezember eine Sammlung bedeutender Ge-
mälde, unter denen sich ein bisher nur aus
einem Stich bekanntes, verloren geglaubtes
Werk von Frans Hals befindet (Abb. S. 6). Da-
neben vor allem englische Familienbilder und
Porträts.
A. Baugin, Stilleben
Sammlung Goudstikker, Amsterdam
Ausstellung französischer Realisten des 17. Jahrhunderts
Paris, Orangerie