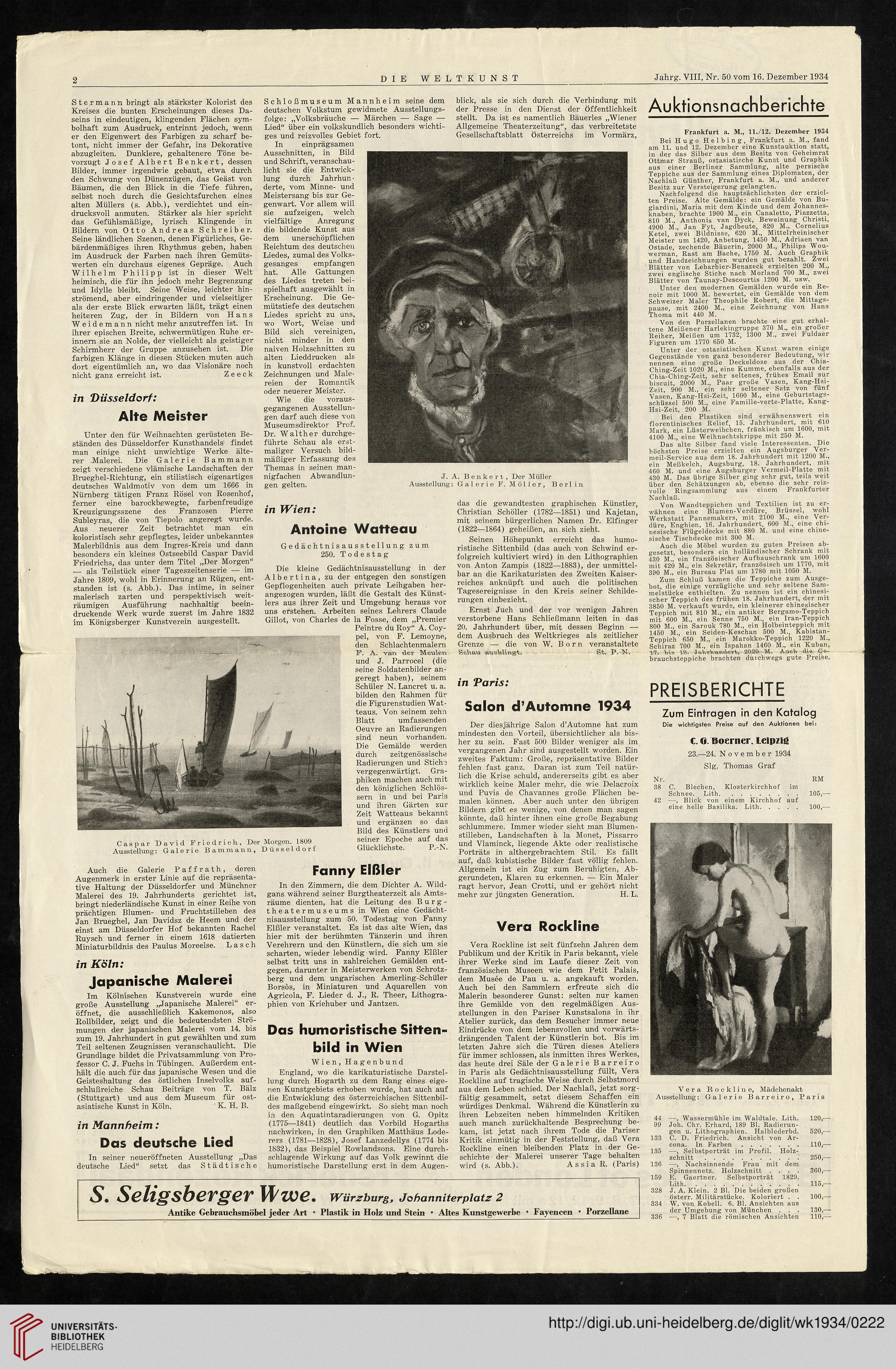2
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 50 vom 16. Dezember 1934
Stermann bringt als stärkster Kolorist des
Kreises die bunten Erscheinungen dieses Da-
seins in eindeutigen, klingenden Flächen sym-
bolhaft zum Ausdruck, entrinnt jedoch, wenn
er den Eigenwert des Farbigen zu scharf be-
tont, nicht immer der Gefahr, ins Dekorative
abzugleiten. Dunklere, gehaltenere Töne be-
vorzugt Josef Albert Benkert, dessen
Bilder, immer irgendwie gebaut, etwa durch
den Schwung von Dünenzügen, das Geäst von
Bäumen, die den Blick in die Tiefe führen,
selbst noch durch die Gesichtsfurchen eines
alten Müllers (s. Abb.), verdichtet und ein-
drucksvoll anmuten. Stärker als hier spricht
das Gefühlsmäßige, lyrisch Klingende in
Bildern von Otto Andreas Schreiber.
Seine ländlichen Szenen, denen Figürliches, Ge-
bärdenmäßiges ihren Rhythmus geben, haben
im Ausdruck der Farben nach ihren Gemüts-
werten ein durchaus eigenes Gepräge. Auch
Wilhelm Philipp ist in dieser Welt
heimisch, die für ihn jedoch mehr Begrenzung
und Idylle bleibt. Seine Weise, leichter hin-
strömend, aber eindringender und vielseitiger
als der erste Blick erwarten läßt, trägt einen
heiteren Zug, der in Bildern von Hans
Weidemann nicht mehr anzutreffen ist. In
ihrer epischen Breite, schwermütigen Ruhe er-
innern sie an Nolde, der vielleicht als geistiger
Schirmherr der Gruppe anzusehen ist. Die
farbigen Klänge in diesen Stücken muten auch
dort eigentümlich an, wo das Visionäre noch
nicht ganz erreicht ist. Z e e c k
in ‘Düsseldorf:
Alte Meister
Unter den für Weihnachten gerüsteten Be-
ständen des Düsseldorfer Kunsthandels findet
man einige nicht unwichtige Werke älte-
rer .Malerei. Die Galerie Bammann
zeigt verschiedene vlämische Landschaften der
Brueghel-Richtung, ein stilistisch eigenartiges
deutsches Waldmotiv von dem um 1666 in
Nürnberg tätigen Franz Rösel von Rosenhof,
ferner eine barockbewegte, farbenfreudige
Kreuzigungsszene des Franzosen Pierre
Subleyras, die von Tiepolo angeregt wurde.
Aus neuerer Zeit betrachtet man ein
koloristisch sehr gepflegtes, leider unbekanntes
Malerbildnis aus dem Ingres-Kreis und dann
besonders ein kleines Ostseebild Caspar David
Friedrichs, das unter dem Titel „Der Morgen“
— als Teilstück einer Tageszeitenserie — im
Jahre 1809, wohl in Erinnerung an Rügen, ent-
standen ist (s. Abb.). Das intime, in seiner
malerisch zarten und perspektivisch weit-
räumigen Ausführung nachhaltig beein-
druckende Werk wurde zuerst im Jahre 1832
im Königsberger Kunstverein ausgestellt.
Auch die Galerie Paffrath, deren
Augenmerk in erster Linie auf die repräsenta-
tive Haltung der Düsseldorfer und Münchner
Malerei des 19. Jahrhunderts gerichtet ist,
bringt niederländische Kunst in einer Reihe von
prächtigen Blumen- und Fruchtstilleben des
Jan Brueghel, Jan Davidsz de Heem und der
einst am Düsseldorfer Hof bekannten Rachel
Ruysch und ferner in einem 1618 datierten
Miniaturbildnis des Paulus Moreelse. Lasch
in Köln:
Japanische Malerei
Im Kölnischen Kunstverein wurde eine
große Ausstellung „Japanische Malerei“ er-
öffnet, die ausschließlich Kakemonos, also
Rollbilder, zeigt und die bedeutendsten Strö-
mungen der japanischen Malerei vom 14. bis
zum 19. Jahrhundert in gut gewählten und zum
Teil seltenen Zeugnissen veranschaulicht. Die
Grundlage bildet die Privatsammlung von Pro-
fessor C. J. Fuchs in Tübingen. Außerdem ent-
hält die auch für das japanische Wesen und die
Geisteshaltung des östlichen Inselvolks auf-
schlußreiche Schau Beiträge von T. Bälz
(Stuttgart) und aus dem Museum für ost-
asiatische Kunst in Köln. ' K. H. B.
in Mannheim:
Das deutsche Lied
In seiner neueröffneten Ausstellung „Das
deutsche Lied“ setzt das Städtische
Schloßmuseum Mannheim seine dem
deutschen Volkstum gewidmete Ausstellungs-
folge: „Volksbräuche — Märchen — Sage —
Lied“ über ein volkskundlich besonders wichti-
ges und reizvolles Gebiet fort.
In einprägsamen
Ausschnitten, in Bild
und Schrift, veranschau¬
licht sie die Entwick¬
lung durch Jahrhun¬
derte, vom Minne- und
Meistersang bis zur Ge¬
genwart. Vor allem will
sie aufzeigen, welch
vielfältige Anregung
die bildende Kunst aus
dem unerschöpflichen
Reichtum des deutschen
Liedes, zumal des Volks¬
gesanges empfangen
hat. Alle Gattungen
des Liedes treten bei¬
spielhaft ausgewählt in
Erscheinung. Die Ge¬
mütstiefe des deutschen
Liedes spricht zu uns,
wo Wort, Weise und
Bild sich vereinigen,
nicht minder in den
naiven Holzschnitten zu
alten Lieddrucken als
in kunstvoll erdachten
Zeichnungen und Male¬
reien der Romantik
oder neuerer Meister.
Wie die voraus-
gegangenen Ausstellun¬
gen darf auch diese von
Museumsdirektor Prof.
Dr. Walther durchge¬
führte Schau als erst¬
maliger Versuch bild¬
mäßiger Erfassung des
Themas in seinen man-
nigfachen Abwandlun¬
gen gelten.
in Wien:
Antoine Watteau
Gedächtnisausstellung zum
250. Todestag
Die kleine Gedächtnisausstellung in der
Albertina, zu der entgegen den sonstigen
Gepflogenheiten auch private Leihgaben her-
angezogen wurden, läßt die Gestalt des Künst-
lers aus ihrer Zeit und Umgebung heraus vor
uns erstehen. Arbeiten seines Lehrers Claude
Gillot, von Charles de la Fosse, dem „Premier
Peintre du Roy“ A. Coy-
pel, von F. Lemoyne,
den Schlachtenmalern
F. A. van der Meuten
und J. Parrocel (die
seine Soldatenbilder an-
geregt haben), seinem
Schüler N. Lancret u. a.
bilden den Rahmen für
die Figurenstudien Wat-
teaus. Von seinem zehn
Blatt umfassenden
Oeuvre an Radierungen
sind neun vorhanden.
Die Gemälde werden
durch zeitgenössische
Radierungen und Stiche
vergegenwärtigt. Gra-
phiken machen auch mit
den königlichen Schlös-
sern in und bei Paris
und ihren Gärten zur
Zeit Watteaus bekannt
und ergänzen so das
Bild des Künstlers und
seiner Epoche auf das
Glücklichste. P.-N.
Fanny Elßler
In den Zimmern, die dem Dichter A. Wild-
gans während seiner Burgtheaterzeit als Amts-
räume dienten, hat die Leitung des Burg-
theatermuseums in Wien eine Gedächt-
nisausstellung zum 50. Todestag von Fanny
Elßler veranstaltet. Es ist das alte Wien, das
hier mit der berühmten Tänzerin und ihren
Verehrern und den Künstlern, die sich um sie
scharten, wieder lebendig wird. Fanny Elßler
selbst tritt uns in zahlreichen Gemälden ent-
gegen, darunter in Meisterwerken von Sehrotz-
berg und dem ungarischen Amerling-Schüler
Borsös, in Miniaturen und Aquarellen von
Agricola, F. Lieder d. J., R. Theer, Lithogra-
phien von Kriehuber und Jantzen.
Das humoristische Sitten-
bild in Wien
Wien, Hagenbund
England, wo die karikaturistische Darstel-
lung durch Hogarth zu dem Rang eines eige-
nen Kunstgebiets erhoben wurde, hat auch auf
die Entwicklung des österreichischen Sittenbil-
des maßgebend eingewirkt. So sieht man noch
in den Aquatintaradierungen von G. Opitz
(1775—-1841) deutlich das Vorbild Hogarths
nachwirken, in den Graphiken Matthäus Lode-
rers (1781—1828), Josef Lanzedellys (1774 bis
1832), das Beispiel Rowlandsons. Eine durch-
schlagende Wirkung auf das Volk gewinnt die
humoristische Darstellung erst in dem Augen-
blick, als sie sich durch die Verbindung mit
der Presse in den Dienst der Öffentlichkeit
stellt. Da ist es namentlich Bäuerles „Wiener
Allgemeine Theaterzeitung“, das verbreitetste
Gesellschaftsblatt Österreichs im Vormärz,
das die gewandtesten graphischen Künstler,
Christian Schöller (1782—1851) und Kajetan,
mit seinem bürgerlichen Namen Dr. Eifinger
(1822—1864) geheißen, an sich zieht.
Seinen Höhepunkt erreicht das humo-
ristische Sittenbild (das auch von Schwind er-
folgreich kultiviert wird) in den Lithographien
von Anton Zampis (1822—1883), der unmittel-
bar an die Karikaturisten des Zweiten Kaiser-
reiches anknüpft und auch die politischen
Tagesereignisse in den Kreis seiner Schilde-
rungen einbezieht.
Ernst Juch und der vor wenigen Jahren
verstorbene Hans Schließmann leiten in das
20. Jahrhundert über, mit dessen Beginn —
dem Ausbruch des Weltkrieges als zeitlicher
Grenze — die von W. Born veranstaltete
Selvuu ausklingt. St. P.-N.
in Paris:
Salon d’Automne 1934
Der diesjährige Salon d’Automne hat zum
mindesten den Vorteil, übersichtlicher als bis-
her zu sein. Fast 500 Bilder weniger als im
vergangenen Jahr sind ausgestellt worden. Ein
zweites Faktum: Große, repräsentative Bilder
fehlen fast ganz. Daran ist zum Teil natür-
lich die Krise schuld, andererseits gibt es aber
wirklich keine Maler mehr, die wie Delacroix
und Puvis de Chavannes große Flächen be-
malen können. Aber auch unter den übrigen
Bildern gibt es wenige, von denen man sagen
könnte, daß hinter ihnen eine große Begabung
schlummere. Immer wieder sieht man Blumen-
stilleben, Landschaften ä la Monet, Pissarro
und Vlaminck, liegende Akte oder realistische
Porträts in althergebrachtem Stil. Es fällt
auf, daß kubistische Bilder fast völlig fehlen.
Allgemein ist ein Zug zum Beruhigten, Ab-
gerundeten, Klaren zu erkennen. — Ein Maler
ragt hervor, Jean Crotti, und er gehört nicht
mehr zur jüngsten Generation. H. L.
Vera Rockline
Vera Rockline ist seit fünfzehn Jahren dem
Publikum und der Kritik in Paris bekannt, viele
ihrer Werke sind im Laufe dieser Zeit von
französischen Museen wie dem Petit Palais,
dem Musee de Pau u. a. angekauft worden.
Auch bei den Sammlern erfreute sich die
Malerin besonderer Gunst: selten nur kamen
ihre Gemälde von den regelmäßigen Aus-
stellungen in den Pariser Kunstsalons in ihr
Atelier zurück, das dem Besucher immer neue
Eindrücke von dem lebensvollen und vorwärts-
drängenden Talent der Künstlerin bot. Bis im
letzten Jahre sich die Türen dieses Ateliers
für immer schlossen, als inmitten ihres Werkes,
das heute drei Säle der Galerie Barreiro
in Paris als Gedächtnisausstellung füllt, Vera
Rockline auf tragische Weise durch Selbstmord
aus dem Leben schied. Der Nachlaß, jetzt sorg-
fältig gesammelt, setzt diesem Schaffen ein
würdiges Denkmal. Während die Künstlerin zu
ihren Lebzeiten neben himmelnden Kritiken
auch manch zurückhaltende Besprechung be-
kam, ist jetzt nach ihrem Tode die Pariser
Kritik einmütig in der Feststellung, daß Vera
Rockline einen bleibenden Platz in der Ge-
schichte der Malerei unserer Tage behalten
wird (s. Abb.). Assia R. (Paris)
Caspar David Friedrich, Der Morgen. 1809
Ausstellung: Galerie Bammann, Düsseldorf
J. A. Benkert, Der Müller
Ausstellung: Galerie F. Möller, Berlin
5. Seligsberger Uwe. Würzburg, Johanniterplatz 2
Antike Gebrauchsmöbel jeder Art • Plastik in Holz und Stein » Altes Kunstgewerbe ’ Fayencen • Porzellane
Auktionsnachberichte
Frankfurt a. M„ 11./12. Dezember 1934
Bei Hugo Helbing, Frankfurt a. M., fand
am 11. und 12. Dezember eine Kunstauktion statt,
in der das Silber aus dem Besitz von Geheimrat
Ottmar Strauß, ostasiatische Kunst und Graphik
aus einer Berliner Sammlung, alte persische
Teppiche aus der Sammlung eines Diplomaten, der
Nachlaß Günther, Frankfurt a. M„ und anderer
Besitz zur Versteigerung gelangten.
Nachfolgend die hauptsächlichsten der erziel-
ten Preise. Alte Gemälde: ein Gemälde von Bu-
giardini, Maria mit dem Kinde und dem Johannes-
knaben, brachte 1900 M., ein Canaletto, Piazzetta,
810 M., Anthonis van Dyck, Beweinung Christi,
4900 M., Jan Fyt, Jagdbeute, 820 M., Cornelius
Ketel, zwei Bildnisse, 620 M„ Mittelrheinischer
Meister um 1420, Anbetung, 1450 M., Adriaen van
Ostade, zechende Bäuerin, 2000 M„ Philips Wou-
werman, Rast am Bache, 1750 M. Auch Graphik
und Handzeichnungen wurden gut bezahlt. Zwei
Blätter von Lebarbier-Benazeck erzielten 200 M.,
zwei englische Stiche nach Morland 700 M., zwei
Blätter von Taunay-Descourtis 1200 M. usw.
Unter den modernen Gemälden wurde ein Re-
noir mit 1000 M. bewertet, ein Gemälde von dem
Schweizer Maler Theophile Robert, die Mittags-
pause, mit 2400 M., eine Zeichnung von Hans
Thoma mit 440 M.
Von den Porzellanen brachte eine gut erhal-
tene Meißener Harlekingruppe 370 M., ein großer
Reiher, Meißen um 1732, 1300 M., zwei Fuldaer
Figuren um 1770 650 M.
Unter der ostasiatischen Kunst waren einige
Gegenstände von ganz besonderer Bedeutung, wir
nennen eine große Deckeldose aus der Chia-
Ching-Zeit 1020 M„ eine Kumme, ebenfalls aus der
Chia-Ching-Zeit, sehr seltenes, frühes Email sur
biscuit, 2000 M., Paar große Vasen, Kang-Hsi-
Zeit, 900 M„ ein sehr seltener Satz von fünf
Vasen, Kang-Hsi-Zeit, 1600 M„ eine Geburtstags-
schüssel 500 M., eine Famille-verte-Platte, Kang-
Hsi-Zeit, 200 M.
Bei den Plastiken sind erwähnenswert ein
florentinisches Relief, 15. Jahrhundert, mit 610
Mark, ein Lüsterweibchen, fränkisch um 1600, mit
4100 M., eine Weihnachtskrippe mit 250 M.
Das alte Silber fand viele Interessenten. Die
höchsten Preise erzielten ein Augsburger Ver-
meil-Service aus dem 18. Jahrhundert mit 1200 M.,
ein Meßkelch, Augsburg, 18. Jahrhundert, mit
460 M. und eine Augsburger Vermeil-Platte mit
430 M. Das übrige Silber ging sehr gut, teils weit
über den Schätzungen ab, ebenso die sehr reiz-
volle Ringsammlung aus einem Frankfurter
Nachlaß.
Von Wandteppichen und Textilien ist zu er-
wähnen eine Blumen-Verdüre, Brüssel, wohl
Werkstatt Pannemakers, mit 2100 M., eine Ver-
düre, Enghien, 16. Jahrhundert, 600 M., eine chi-
nesische Flügeldecke mit 880 M. und eine chine-
sische Tischdecke mit 300 M.
Auch die Möbel wurden zu guten Preisen ab-
gesetzt, besonders ein holländischer Schrank mit
430 M., ein französischer Aufbauschrank um 1600
mit 420 M„ ein Sekretär, französisch um 1770, mit
390 M., ein Bureau Plat um 1780 mit 1050 M.
Zum Schluß kamen die Teppiche zum Ausge-
bot, die einige vorzügliche und sehr seltene Sam-
melstücke enthielten. Zu nennen ist ein chinesi-
scher Teppich des frühen 18. Jahrhundert, der mit
3850 M. verkauft wurde, ein kleinerer chinesischer
Teppich mit 810 M„ ein antiker Bergamo-Teppich
mit 600 M., ein Senne 750 M., ein Iran-Teppich
800 M., ein Sarouk 780 M„ ein Holbeinteppich mit
1450 M., ein Seiden-Keschan 500 M., Kabistan-
Teppich 650 M„ ein Marokko-Teppich _ 1220 M„
Schiraz 700 M., ein Ispahan 1460 M., ein Kuban,
17. bis 18. JahrhundeTt, 2020 M. Auch die Ge-
brauehsteppiche brachten durchwegs gute Preise.
PREISBERICHTE
Zum Einträgen in den Katalog
Die wichtigsten Preise auf den Auktionen bei:
C. G. Boerner. Leipzig
23.—24. November 1934
Slg. Thomas Graf
Nr.
RM
38 C. Blechen, Klosterkirchhof im
Schnee. Lith.
42 —, Blick von einem Kirchhof auf
eine helle Basilika. Lith.
105 —
100,—
Vera Rockline, Mädchenakt
Ausstellung: Galerie Barreiro, Paris
44 —, Wassermühle im Waldtale. Lith. 120,—
99 Joh. Chr. Erhard, 189 Bl. Radierun¬
gen u. Lithographien. Halblederbd. 520,-—
133 C. D. Friedrich. Ansicht von Ar-
cona. In Farben.110,—
135 —, Selbstporträt im Profil. Holz¬
schnitt ... 250,—
136 —, Nachsinnende Frau mit dem
Spinnennetz. Holzschnitt .... 360,—
159 E. Gaertner. Selbstporträt 1829.
Lith.115,—
328 J. A. Klein. 2 Bl. Die beiden großen
österr. Militärstücke. Koloriert . . 100,—
334 W. von. Kobell. 6. Bl. Ansichten aus
der Umgebung von München . . . 130,—
336 —, 7 Blatt die römischen Ansichten 110,—
DIE WELTKUNST
Jahrg. VIII, Nr. 50 vom 16. Dezember 1934
Stermann bringt als stärkster Kolorist des
Kreises die bunten Erscheinungen dieses Da-
seins in eindeutigen, klingenden Flächen sym-
bolhaft zum Ausdruck, entrinnt jedoch, wenn
er den Eigenwert des Farbigen zu scharf be-
tont, nicht immer der Gefahr, ins Dekorative
abzugleiten. Dunklere, gehaltenere Töne be-
vorzugt Josef Albert Benkert, dessen
Bilder, immer irgendwie gebaut, etwa durch
den Schwung von Dünenzügen, das Geäst von
Bäumen, die den Blick in die Tiefe führen,
selbst noch durch die Gesichtsfurchen eines
alten Müllers (s. Abb.), verdichtet und ein-
drucksvoll anmuten. Stärker als hier spricht
das Gefühlsmäßige, lyrisch Klingende in
Bildern von Otto Andreas Schreiber.
Seine ländlichen Szenen, denen Figürliches, Ge-
bärdenmäßiges ihren Rhythmus geben, haben
im Ausdruck der Farben nach ihren Gemüts-
werten ein durchaus eigenes Gepräge. Auch
Wilhelm Philipp ist in dieser Welt
heimisch, die für ihn jedoch mehr Begrenzung
und Idylle bleibt. Seine Weise, leichter hin-
strömend, aber eindringender und vielseitiger
als der erste Blick erwarten läßt, trägt einen
heiteren Zug, der in Bildern von Hans
Weidemann nicht mehr anzutreffen ist. In
ihrer epischen Breite, schwermütigen Ruhe er-
innern sie an Nolde, der vielleicht als geistiger
Schirmherr der Gruppe anzusehen ist. Die
farbigen Klänge in diesen Stücken muten auch
dort eigentümlich an, wo das Visionäre noch
nicht ganz erreicht ist. Z e e c k
in ‘Düsseldorf:
Alte Meister
Unter den für Weihnachten gerüsteten Be-
ständen des Düsseldorfer Kunsthandels findet
man einige nicht unwichtige Werke älte-
rer .Malerei. Die Galerie Bammann
zeigt verschiedene vlämische Landschaften der
Brueghel-Richtung, ein stilistisch eigenartiges
deutsches Waldmotiv von dem um 1666 in
Nürnberg tätigen Franz Rösel von Rosenhof,
ferner eine barockbewegte, farbenfreudige
Kreuzigungsszene des Franzosen Pierre
Subleyras, die von Tiepolo angeregt wurde.
Aus neuerer Zeit betrachtet man ein
koloristisch sehr gepflegtes, leider unbekanntes
Malerbildnis aus dem Ingres-Kreis und dann
besonders ein kleines Ostseebild Caspar David
Friedrichs, das unter dem Titel „Der Morgen“
— als Teilstück einer Tageszeitenserie — im
Jahre 1809, wohl in Erinnerung an Rügen, ent-
standen ist (s. Abb.). Das intime, in seiner
malerisch zarten und perspektivisch weit-
räumigen Ausführung nachhaltig beein-
druckende Werk wurde zuerst im Jahre 1832
im Königsberger Kunstverein ausgestellt.
Auch die Galerie Paffrath, deren
Augenmerk in erster Linie auf die repräsenta-
tive Haltung der Düsseldorfer und Münchner
Malerei des 19. Jahrhunderts gerichtet ist,
bringt niederländische Kunst in einer Reihe von
prächtigen Blumen- und Fruchtstilleben des
Jan Brueghel, Jan Davidsz de Heem und der
einst am Düsseldorfer Hof bekannten Rachel
Ruysch und ferner in einem 1618 datierten
Miniaturbildnis des Paulus Moreelse. Lasch
in Köln:
Japanische Malerei
Im Kölnischen Kunstverein wurde eine
große Ausstellung „Japanische Malerei“ er-
öffnet, die ausschließlich Kakemonos, also
Rollbilder, zeigt und die bedeutendsten Strö-
mungen der japanischen Malerei vom 14. bis
zum 19. Jahrhundert in gut gewählten und zum
Teil seltenen Zeugnissen veranschaulicht. Die
Grundlage bildet die Privatsammlung von Pro-
fessor C. J. Fuchs in Tübingen. Außerdem ent-
hält die auch für das japanische Wesen und die
Geisteshaltung des östlichen Inselvolks auf-
schlußreiche Schau Beiträge von T. Bälz
(Stuttgart) und aus dem Museum für ost-
asiatische Kunst in Köln. ' K. H. B.
in Mannheim:
Das deutsche Lied
In seiner neueröffneten Ausstellung „Das
deutsche Lied“ setzt das Städtische
Schloßmuseum Mannheim seine dem
deutschen Volkstum gewidmete Ausstellungs-
folge: „Volksbräuche — Märchen — Sage —
Lied“ über ein volkskundlich besonders wichti-
ges und reizvolles Gebiet fort.
In einprägsamen
Ausschnitten, in Bild
und Schrift, veranschau¬
licht sie die Entwick¬
lung durch Jahrhun¬
derte, vom Minne- und
Meistersang bis zur Ge¬
genwart. Vor allem will
sie aufzeigen, welch
vielfältige Anregung
die bildende Kunst aus
dem unerschöpflichen
Reichtum des deutschen
Liedes, zumal des Volks¬
gesanges empfangen
hat. Alle Gattungen
des Liedes treten bei¬
spielhaft ausgewählt in
Erscheinung. Die Ge¬
mütstiefe des deutschen
Liedes spricht zu uns,
wo Wort, Weise und
Bild sich vereinigen,
nicht minder in den
naiven Holzschnitten zu
alten Lieddrucken als
in kunstvoll erdachten
Zeichnungen und Male¬
reien der Romantik
oder neuerer Meister.
Wie die voraus-
gegangenen Ausstellun¬
gen darf auch diese von
Museumsdirektor Prof.
Dr. Walther durchge¬
führte Schau als erst¬
maliger Versuch bild¬
mäßiger Erfassung des
Themas in seinen man-
nigfachen Abwandlun¬
gen gelten.
in Wien:
Antoine Watteau
Gedächtnisausstellung zum
250. Todestag
Die kleine Gedächtnisausstellung in der
Albertina, zu der entgegen den sonstigen
Gepflogenheiten auch private Leihgaben her-
angezogen wurden, läßt die Gestalt des Künst-
lers aus ihrer Zeit und Umgebung heraus vor
uns erstehen. Arbeiten seines Lehrers Claude
Gillot, von Charles de la Fosse, dem „Premier
Peintre du Roy“ A. Coy-
pel, von F. Lemoyne,
den Schlachtenmalern
F. A. van der Meuten
und J. Parrocel (die
seine Soldatenbilder an-
geregt haben), seinem
Schüler N. Lancret u. a.
bilden den Rahmen für
die Figurenstudien Wat-
teaus. Von seinem zehn
Blatt umfassenden
Oeuvre an Radierungen
sind neun vorhanden.
Die Gemälde werden
durch zeitgenössische
Radierungen und Stiche
vergegenwärtigt. Gra-
phiken machen auch mit
den königlichen Schlös-
sern in und bei Paris
und ihren Gärten zur
Zeit Watteaus bekannt
und ergänzen so das
Bild des Künstlers und
seiner Epoche auf das
Glücklichste. P.-N.
Fanny Elßler
In den Zimmern, die dem Dichter A. Wild-
gans während seiner Burgtheaterzeit als Amts-
räume dienten, hat die Leitung des Burg-
theatermuseums in Wien eine Gedächt-
nisausstellung zum 50. Todestag von Fanny
Elßler veranstaltet. Es ist das alte Wien, das
hier mit der berühmten Tänzerin und ihren
Verehrern und den Künstlern, die sich um sie
scharten, wieder lebendig wird. Fanny Elßler
selbst tritt uns in zahlreichen Gemälden ent-
gegen, darunter in Meisterwerken von Sehrotz-
berg und dem ungarischen Amerling-Schüler
Borsös, in Miniaturen und Aquarellen von
Agricola, F. Lieder d. J., R. Theer, Lithogra-
phien von Kriehuber und Jantzen.
Das humoristische Sitten-
bild in Wien
Wien, Hagenbund
England, wo die karikaturistische Darstel-
lung durch Hogarth zu dem Rang eines eige-
nen Kunstgebiets erhoben wurde, hat auch auf
die Entwicklung des österreichischen Sittenbil-
des maßgebend eingewirkt. So sieht man noch
in den Aquatintaradierungen von G. Opitz
(1775—-1841) deutlich das Vorbild Hogarths
nachwirken, in den Graphiken Matthäus Lode-
rers (1781—1828), Josef Lanzedellys (1774 bis
1832), das Beispiel Rowlandsons. Eine durch-
schlagende Wirkung auf das Volk gewinnt die
humoristische Darstellung erst in dem Augen-
blick, als sie sich durch die Verbindung mit
der Presse in den Dienst der Öffentlichkeit
stellt. Da ist es namentlich Bäuerles „Wiener
Allgemeine Theaterzeitung“, das verbreitetste
Gesellschaftsblatt Österreichs im Vormärz,
das die gewandtesten graphischen Künstler,
Christian Schöller (1782—1851) und Kajetan,
mit seinem bürgerlichen Namen Dr. Eifinger
(1822—1864) geheißen, an sich zieht.
Seinen Höhepunkt erreicht das humo-
ristische Sittenbild (das auch von Schwind er-
folgreich kultiviert wird) in den Lithographien
von Anton Zampis (1822—1883), der unmittel-
bar an die Karikaturisten des Zweiten Kaiser-
reiches anknüpft und auch die politischen
Tagesereignisse in den Kreis seiner Schilde-
rungen einbezieht.
Ernst Juch und der vor wenigen Jahren
verstorbene Hans Schließmann leiten in das
20. Jahrhundert über, mit dessen Beginn —
dem Ausbruch des Weltkrieges als zeitlicher
Grenze — die von W. Born veranstaltete
Selvuu ausklingt. St. P.-N.
in Paris:
Salon d’Automne 1934
Der diesjährige Salon d’Automne hat zum
mindesten den Vorteil, übersichtlicher als bis-
her zu sein. Fast 500 Bilder weniger als im
vergangenen Jahr sind ausgestellt worden. Ein
zweites Faktum: Große, repräsentative Bilder
fehlen fast ganz. Daran ist zum Teil natür-
lich die Krise schuld, andererseits gibt es aber
wirklich keine Maler mehr, die wie Delacroix
und Puvis de Chavannes große Flächen be-
malen können. Aber auch unter den übrigen
Bildern gibt es wenige, von denen man sagen
könnte, daß hinter ihnen eine große Begabung
schlummere. Immer wieder sieht man Blumen-
stilleben, Landschaften ä la Monet, Pissarro
und Vlaminck, liegende Akte oder realistische
Porträts in althergebrachtem Stil. Es fällt
auf, daß kubistische Bilder fast völlig fehlen.
Allgemein ist ein Zug zum Beruhigten, Ab-
gerundeten, Klaren zu erkennen. — Ein Maler
ragt hervor, Jean Crotti, und er gehört nicht
mehr zur jüngsten Generation. H. L.
Vera Rockline
Vera Rockline ist seit fünfzehn Jahren dem
Publikum und der Kritik in Paris bekannt, viele
ihrer Werke sind im Laufe dieser Zeit von
französischen Museen wie dem Petit Palais,
dem Musee de Pau u. a. angekauft worden.
Auch bei den Sammlern erfreute sich die
Malerin besonderer Gunst: selten nur kamen
ihre Gemälde von den regelmäßigen Aus-
stellungen in den Pariser Kunstsalons in ihr
Atelier zurück, das dem Besucher immer neue
Eindrücke von dem lebensvollen und vorwärts-
drängenden Talent der Künstlerin bot. Bis im
letzten Jahre sich die Türen dieses Ateliers
für immer schlossen, als inmitten ihres Werkes,
das heute drei Säle der Galerie Barreiro
in Paris als Gedächtnisausstellung füllt, Vera
Rockline auf tragische Weise durch Selbstmord
aus dem Leben schied. Der Nachlaß, jetzt sorg-
fältig gesammelt, setzt diesem Schaffen ein
würdiges Denkmal. Während die Künstlerin zu
ihren Lebzeiten neben himmelnden Kritiken
auch manch zurückhaltende Besprechung be-
kam, ist jetzt nach ihrem Tode die Pariser
Kritik einmütig in der Feststellung, daß Vera
Rockline einen bleibenden Platz in der Ge-
schichte der Malerei unserer Tage behalten
wird (s. Abb.). Assia R. (Paris)
Caspar David Friedrich, Der Morgen. 1809
Ausstellung: Galerie Bammann, Düsseldorf
J. A. Benkert, Der Müller
Ausstellung: Galerie F. Möller, Berlin
5. Seligsberger Uwe. Würzburg, Johanniterplatz 2
Antike Gebrauchsmöbel jeder Art • Plastik in Holz und Stein » Altes Kunstgewerbe ’ Fayencen • Porzellane
Auktionsnachberichte
Frankfurt a. M„ 11./12. Dezember 1934
Bei Hugo Helbing, Frankfurt a. M., fand
am 11. und 12. Dezember eine Kunstauktion statt,
in der das Silber aus dem Besitz von Geheimrat
Ottmar Strauß, ostasiatische Kunst und Graphik
aus einer Berliner Sammlung, alte persische
Teppiche aus der Sammlung eines Diplomaten, der
Nachlaß Günther, Frankfurt a. M„ und anderer
Besitz zur Versteigerung gelangten.
Nachfolgend die hauptsächlichsten der erziel-
ten Preise. Alte Gemälde: ein Gemälde von Bu-
giardini, Maria mit dem Kinde und dem Johannes-
knaben, brachte 1900 M., ein Canaletto, Piazzetta,
810 M., Anthonis van Dyck, Beweinung Christi,
4900 M., Jan Fyt, Jagdbeute, 820 M., Cornelius
Ketel, zwei Bildnisse, 620 M„ Mittelrheinischer
Meister um 1420, Anbetung, 1450 M., Adriaen van
Ostade, zechende Bäuerin, 2000 M„ Philips Wou-
werman, Rast am Bache, 1750 M. Auch Graphik
und Handzeichnungen wurden gut bezahlt. Zwei
Blätter von Lebarbier-Benazeck erzielten 200 M.,
zwei englische Stiche nach Morland 700 M., zwei
Blätter von Taunay-Descourtis 1200 M. usw.
Unter den modernen Gemälden wurde ein Re-
noir mit 1000 M. bewertet, ein Gemälde von dem
Schweizer Maler Theophile Robert, die Mittags-
pause, mit 2400 M., eine Zeichnung von Hans
Thoma mit 440 M.
Von den Porzellanen brachte eine gut erhal-
tene Meißener Harlekingruppe 370 M., ein großer
Reiher, Meißen um 1732, 1300 M., zwei Fuldaer
Figuren um 1770 650 M.
Unter der ostasiatischen Kunst waren einige
Gegenstände von ganz besonderer Bedeutung, wir
nennen eine große Deckeldose aus der Chia-
Ching-Zeit 1020 M„ eine Kumme, ebenfalls aus der
Chia-Ching-Zeit, sehr seltenes, frühes Email sur
biscuit, 2000 M., Paar große Vasen, Kang-Hsi-
Zeit, 900 M„ ein sehr seltener Satz von fünf
Vasen, Kang-Hsi-Zeit, 1600 M„ eine Geburtstags-
schüssel 500 M., eine Famille-verte-Platte, Kang-
Hsi-Zeit, 200 M.
Bei den Plastiken sind erwähnenswert ein
florentinisches Relief, 15. Jahrhundert, mit 610
Mark, ein Lüsterweibchen, fränkisch um 1600, mit
4100 M., eine Weihnachtskrippe mit 250 M.
Das alte Silber fand viele Interessenten. Die
höchsten Preise erzielten ein Augsburger Ver-
meil-Service aus dem 18. Jahrhundert mit 1200 M.,
ein Meßkelch, Augsburg, 18. Jahrhundert, mit
460 M. und eine Augsburger Vermeil-Platte mit
430 M. Das übrige Silber ging sehr gut, teils weit
über den Schätzungen ab, ebenso die sehr reiz-
volle Ringsammlung aus einem Frankfurter
Nachlaß.
Von Wandteppichen und Textilien ist zu er-
wähnen eine Blumen-Verdüre, Brüssel, wohl
Werkstatt Pannemakers, mit 2100 M., eine Ver-
düre, Enghien, 16. Jahrhundert, 600 M., eine chi-
nesische Flügeldecke mit 880 M. und eine chine-
sische Tischdecke mit 300 M.
Auch die Möbel wurden zu guten Preisen ab-
gesetzt, besonders ein holländischer Schrank mit
430 M., ein französischer Aufbauschrank um 1600
mit 420 M„ ein Sekretär, französisch um 1770, mit
390 M., ein Bureau Plat um 1780 mit 1050 M.
Zum Schluß kamen die Teppiche zum Ausge-
bot, die einige vorzügliche und sehr seltene Sam-
melstücke enthielten. Zu nennen ist ein chinesi-
scher Teppich des frühen 18. Jahrhundert, der mit
3850 M. verkauft wurde, ein kleinerer chinesischer
Teppich mit 810 M„ ein antiker Bergamo-Teppich
mit 600 M., ein Senne 750 M., ein Iran-Teppich
800 M., ein Sarouk 780 M„ ein Holbeinteppich mit
1450 M., ein Seiden-Keschan 500 M., Kabistan-
Teppich 650 M„ ein Marokko-Teppich _ 1220 M„
Schiraz 700 M., ein Ispahan 1460 M., ein Kuban,
17. bis 18. JahrhundeTt, 2020 M. Auch die Ge-
brauehsteppiche brachten durchwegs gute Preise.
PREISBERICHTE
Zum Einträgen in den Katalog
Die wichtigsten Preise auf den Auktionen bei:
C. G. Boerner. Leipzig
23.—24. November 1934
Slg. Thomas Graf
Nr.
RM
38 C. Blechen, Klosterkirchhof im
Schnee. Lith.
42 —, Blick von einem Kirchhof auf
eine helle Basilika. Lith.
105 —
100,—
Vera Rockline, Mädchenakt
Ausstellung: Galerie Barreiro, Paris
44 —, Wassermühle im Waldtale. Lith. 120,—
99 Joh. Chr. Erhard, 189 Bl. Radierun¬
gen u. Lithographien. Halblederbd. 520,-—
133 C. D. Friedrich. Ansicht von Ar-
cona. In Farben.110,—
135 —, Selbstporträt im Profil. Holz¬
schnitt ... 250,—
136 —, Nachsinnende Frau mit dem
Spinnennetz. Holzschnitt .... 360,—
159 E. Gaertner. Selbstporträt 1829.
Lith.115,—
328 J. A. Klein. 2 Bl. Die beiden großen
österr. Militärstücke. Koloriert . . 100,—
334 W. von. Kobell. 6. Bl. Ansichten aus
der Umgebung von München . . . 130,—
336 —, 7 Blatt die römischen Ansichten 110,—