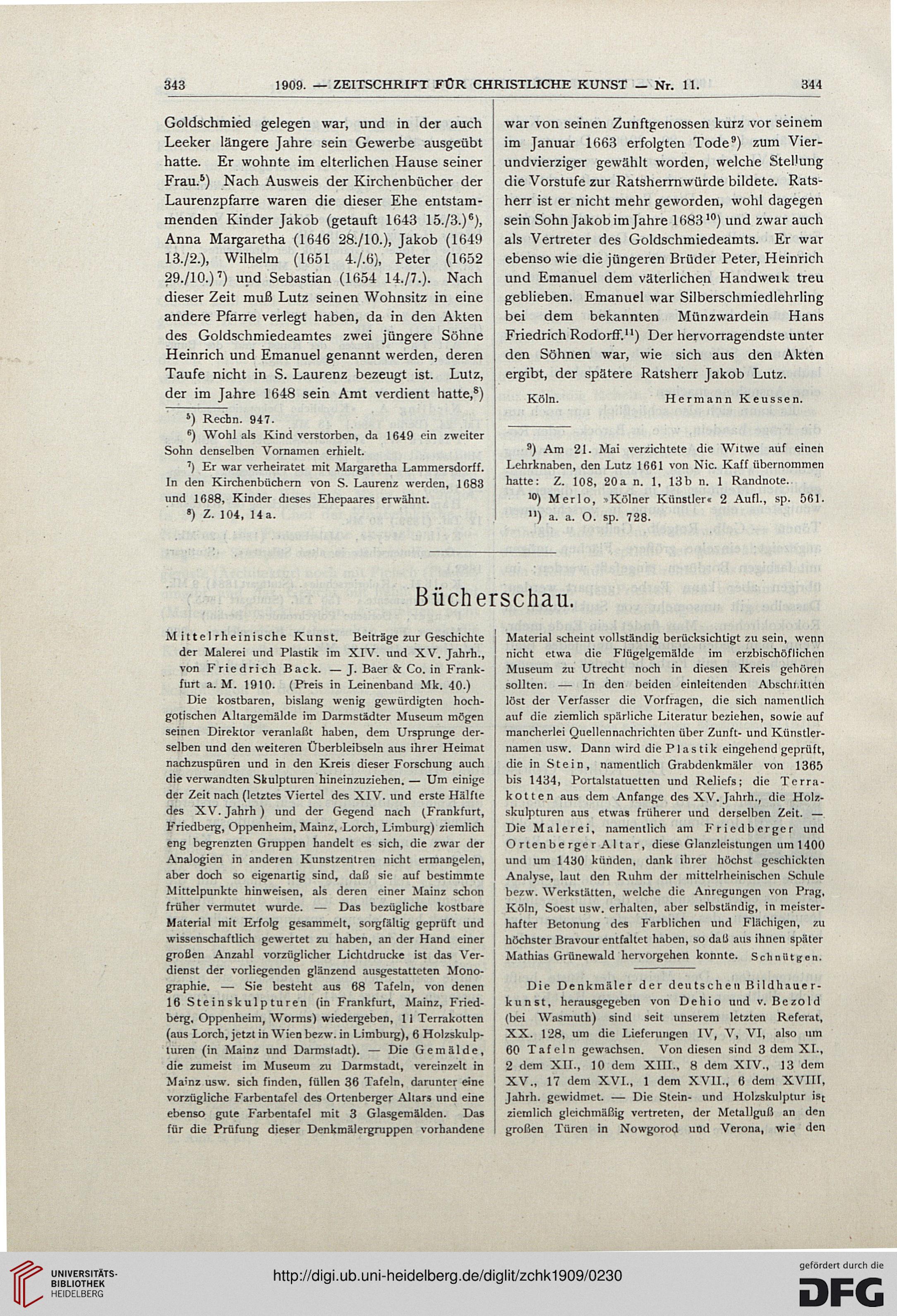343
1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
344
Goldschmied gelegen war, und in der auch
Leeker längere Jahre sein Gewerbe ausgeübt
hatte. Er wohnte im elterlichen Hause seiner
Frau.5) Nach Ausweis der Kirchenbücher der
Laurenzpfarre waren die dieser Ehe entstam-
menden Kinder Jakob (getauft 1643 15./3.)6),
Anna Margaretha (1646 28./10.), Jakob (1649
13./2.), Wilhelm (1651 4./.6), Peter (1652
29./10.)7) und Sebastian (1654 14./7.). Nach
dieser Zeit muß Lutz seinen Wohnsitz in eine
andere Pfarre verlegt haben, da in den Akten
des Goldschmiedeamtes zwei jüngere Söhne
Heinrich und Emanuel genannt werden, deren
Taufe nicht in S. Laurenz bezeugt ist. Lutz,
der im Jahre 1648 sein Amt verdient hatte,8)
>) Recbn. 947.
6) Wohl als Kind verstorben, da 1649 ein zweiter
Sohn denselben Vornamen erhielt
7) Er war verheiratet mit Margaretha Lammersdorff.
In den Kirchenbüchern von S. Laurenz werden, 1G83
und 1688, Kinder dieses Ehepaares erwähnt.
8) Z. 104, 14a.
war von seinen Zunftgenossen kurz vor seinem
im Januar 1663 erfolgten Tode9) zum Vier-
undvierziger gewählt worden, welche Stellung
die Vorstufe zur Ratsherrnwürde bildete. Rats-
herr ist er nicht mehr geworden, wohl dagegen
sein Sohn Jakob im Jahre 168310) und zwar auch
als Vertreter des Goldschmiedeamts. Er war
ebenso wie die jüngeren Brüder Peter, Heinrich
und Emanuel dem väterlichen Handweik treu
geblieben. Emanuel war Silberschmiedlehrling
bei dem bekannten Münzwardein Hans
Friedrich Rodorff.11) Der hervorragendste unter
den Söhnen war, wie sich aus den Akten
ergibt, der spätere Ratsherr Jakob Lutz.
Köln.
Hermann Keussen.
9) Am 21. Mai verzichtete die Witwe auf einen
Lehrknaben, den Lutz 1661 von Nie. Kaff übernommen
hatte: Z. 108, 20a n. 1, 13b n. 1 Randnote..
10) Merlo, ^Kölner Künstler« 2 Aufl., sp. 561.
") a. a. O. sp. 728.
Bücherschau.
M ittel rheinische Kunst. Beiträge zur Geschichte
der Malerei und Plastik im XIV. und XV. Jahrh.,
von Friedrich Back. — J. Baer & Co. in Frank-
furt a. M. 1910. (Preis in Leinenband Mk. 40.)
Die kostbaren, bislang wenig gewürdigten hoch-
gotischen Altargemälde im Darmstädter Museum mögen
seinen Direktor veranlaßt haben, dem Ursprünge der-
selben und den weiteren Überbleibseln aus ihrer Heimat
nachzuspüren und in den Kreis dieser Forschung auch
die verwandten Skulpturen hineinzuziehen. — Um einige
der Zeit nach (letztes Viertel des XFV. und erste Hälfte
des XV. Jahrh) und der Gegend nach (Frankfurt,
Friedberg, Oppenheim, Mainz, Lorch, Limburg) ziemlich
eng begrenzten Gruppen handelt es sich, die zwar der
Analogien in anderen Kunstzentren nicht ermangelen,
aber doch so eigenartig sind, daß sie auf bestimmte
Mittelpunkte hinweisen, als deren einer Mainz schon
früher vermutet wurde. — Das bezügliche kostbare
Material mit Erfolg gesammelt, sorgfältig geprüft und
wissenschaftlich gewertet zu haben, an der Hand einer
großen Anzahl vorzüglicher Lichtdrucke ist das Ver-
dienst der vorliegenden glänzend ausgestatteten Mono-
graphie. — Sie besteht aus 68 Tafeln, von denen
16 Steinskulpturen (in Frankfurt, Mainz, Fried-
berg, Oppenheim, Worms) wiedergeben, 11 Terrakotten
(aus Lorch, jetzt in Wien bezw. in Limburg), 6 Holzskulp-
luren (in Mainz und Darmsladt). — Die Gemälde,
die zumeist im Museum zu Darmstadt, vereinzelt in
Mainz usw. sich finden, füllen 36 Tafeln, darunter eine
vorzügliche Farbentafel des Ortenberger Allars und eine
ebenso gute P'arbentafel mit 3 Glasgemälden. Das
für die Prüfung dieser Denkmälergruppen vorhandene
Material scheint vollständig berücksichtigt zu sein, wenn
nicht etwa die Flügelgemälde im erzbischöflichen
Museum zu Utrecht noch in diesen Kreis gehören
sollten. — In den beiden einleitenden Abseht.itlcn
löst der Verfasser die Vorfragen, die sich namentlich
auf die ziemlich spärliche Literatur beziehen, sowie auf
mancherlei Quellennnchrichten über Zunft- und Künstler-
namen usw. Dann wird die Plastik eingehend geprüft,
die in Stein, namentlich Grabdenkmäler von 1365
bis 1434, Portalstatuetten und Reliefs; die Terra-
kotten aus dem Anfange des XV. Jahrh., die Holz-
skulpturen aus etwas früherer und derselben Zeit. —
Die Malerei, namentlich am Friedberger und
OrtenbergerAltar, diese Glanzleistungen um 1400
und um 1430 künden, dank ihrer höchst geschickten
Analyse, laut den Ruhm der mittelrheinischen Schule
bezw. Werkstätten, welche die Anregungen von Prag,
Köln, Soest usw. erhalten, aber selbständig, in meister-
hafter Betonung des Farblichen und Flächigen, zu
höchster Bravour entfaltet haben, so dall aus ihnen später
Mathias Grünewald hervorgehen konnte. Schnütgen.
Die Denkmäler der deutschen Bildhauer-
kunst, herausgegeben von Dehio und v. Bezold
(bei Wasmuth) sind seit unserem letzten Referat,
XX. 128, um die Lieferungen IV, V, VI, also um
60 Tafeln gewachsen. Von diesen sind 3 dem XL,
2 dem XII., 10 dem XIII., 8 dem XIV., 13 dem
XV., 17 dem XVI., 1 dem XVII., 6 dem XVIII,
Jahrh. gewidmet. — Die Stein- und Holzskulptur ist
ziemlich gleichmäßig vertreten, der Metallguß an den
großen Türen in Nowgorod und Verona, wie den
1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
344
Goldschmied gelegen war, und in der auch
Leeker längere Jahre sein Gewerbe ausgeübt
hatte. Er wohnte im elterlichen Hause seiner
Frau.5) Nach Ausweis der Kirchenbücher der
Laurenzpfarre waren die dieser Ehe entstam-
menden Kinder Jakob (getauft 1643 15./3.)6),
Anna Margaretha (1646 28./10.), Jakob (1649
13./2.), Wilhelm (1651 4./.6), Peter (1652
29./10.)7) und Sebastian (1654 14./7.). Nach
dieser Zeit muß Lutz seinen Wohnsitz in eine
andere Pfarre verlegt haben, da in den Akten
des Goldschmiedeamtes zwei jüngere Söhne
Heinrich und Emanuel genannt werden, deren
Taufe nicht in S. Laurenz bezeugt ist. Lutz,
der im Jahre 1648 sein Amt verdient hatte,8)
>) Recbn. 947.
6) Wohl als Kind verstorben, da 1649 ein zweiter
Sohn denselben Vornamen erhielt
7) Er war verheiratet mit Margaretha Lammersdorff.
In den Kirchenbüchern von S. Laurenz werden, 1G83
und 1688, Kinder dieses Ehepaares erwähnt.
8) Z. 104, 14a.
war von seinen Zunftgenossen kurz vor seinem
im Januar 1663 erfolgten Tode9) zum Vier-
undvierziger gewählt worden, welche Stellung
die Vorstufe zur Ratsherrnwürde bildete. Rats-
herr ist er nicht mehr geworden, wohl dagegen
sein Sohn Jakob im Jahre 168310) und zwar auch
als Vertreter des Goldschmiedeamts. Er war
ebenso wie die jüngeren Brüder Peter, Heinrich
und Emanuel dem väterlichen Handweik treu
geblieben. Emanuel war Silberschmiedlehrling
bei dem bekannten Münzwardein Hans
Friedrich Rodorff.11) Der hervorragendste unter
den Söhnen war, wie sich aus den Akten
ergibt, der spätere Ratsherr Jakob Lutz.
Köln.
Hermann Keussen.
9) Am 21. Mai verzichtete die Witwe auf einen
Lehrknaben, den Lutz 1661 von Nie. Kaff übernommen
hatte: Z. 108, 20a n. 1, 13b n. 1 Randnote..
10) Merlo, ^Kölner Künstler« 2 Aufl., sp. 561.
") a. a. O. sp. 728.
Bücherschau.
M ittel rheinische Kunst. Beiträge zur Geschichte
der Malerei und Plastik im XIV. und XV. Jahrh.,
von Friedrich Back. — J. Baer & Co. in Frank-
furt a. M. 1910. (Preis in Leinenband Mk. 40.)
Die kostbaren, bislang wenig gewürdigten hoch-
gotischen Altargemälde im Darmstädter Museum mögen
seinen Direktor veranlaßt haben, dem Ursprünge der-
selben und den weiteren Überbleibseln aus ihrer Heimat
nachzuspüren und in den Kreis dieser Forschung auch
die verwandten Skulpturen hineinzuziehen. — Um einige
der Zeit nach (letztes Viertel des XFV. und erste Hälfte
des XV. Jahrh) und der Gegend nach (Frankfurt,
Friedberg, Oppenheim, Mainz, Lorch, Limburg) ziemlich
eng begrenzten Gruppen handelt es sich, die zwar der
Analogien in anderen Kunstzentren nicht ermangelen,
aber doch so eigenartig sind, daß sie auf bestimmte
Mittelpunkte hinweisen, als deren einer Mainz schon
früher vermutet wurde. — Das bezügliche kostbare
Material mit Erfolg gesammelt, sorgfältig geprüft und
wissenschaftlich gewertet zu haben, an der Hand einer
großen Anzahl vorzüglicher Lichtdrucke ist das Ver-
dienst der vorliegenden glänzend ausgestatteten Mono-
graphie. — Sie besteht aus 68 Tafeln, von denen
16 Steinskulpturen (in Frankfurt, Mainz, Fried-
berg, Oppenheim, Worms) wiedergeben, 11 Terrakotten
(aus Lorch, jetzt in Wien bezw. in Limburg), 6 Holzskulp-
luren (in Mainz und Darmsladt). — Die Gemälde,
die zumeist im Museum zu Darmstadt, vereinzelt in
Mainz usw. sich finden, füllen 36 Tafeln, darunter eine
vorzügliche Farbentafel des Ortenberger Allars und eine
ebenso gute P'arbentafel mit 3 Glasgemälden. Das
für die Prüfung dieser Denkmälergruppen vorhandene
Material scheint vollständig berücksichtigt zu sein, wenn
nicht etwa die Flügelgemälde im erzbischöflichen
Museum zu Utrecht noch in diesen Kreis gehören
sollten. — In den beiden einleitenden Abseht.itlcn
löst der Verfasser die Vorfragen, die sich namentlich
auf die ziemlich spärliche Literatur beziehen, sowie auf
mancherlei Quellennnchrichten über Zunft- und Künstler-
namen usw. Dann wird die Plastik eingehend geprüft,
die in Stein, namentlich Grabdenkmäler von 1365
bis 1434, Portalstatuetten und Reliefs; die Terra-
kotten aus dem Anfange des XV. Jahrh., die Holz-
skulpturen aus etwas früherer und derselben Zeit. —
Die Malerei, namentlich am Friedberger und
OrtenbergerAltar, diese Glanzleistungen um 1400
und um 1430 künden, dank ihrer höchst geschickten
Analyse, laut den Ruhm der mittelrheinischen Schule
bezw. Werkstätten, welche die Anregungen von Prag,
Köln, Soest usw. erhalten, aber selbständig, in meister-
hafter Betonung des Farblichen und Flächigen, zu
höchster Bravour entfaltet haben, so dall aus ihnen später
Mathias Grünewald hervorgehen konnte. Schnütgen.
Die Denkmäler der deutschen Bildhauer-
kunst, herausgegeben von Dehio und v. Bezold
(bei Wasmuth) sind seit unserem letzten Referat,
XX. 128, um die Lieferungen IV, V, VI, also um
60 Tafeln gewachsen. Von diesen sind 3 dem XL,
2 dem XII., 10 dem XIII., 8 dem XIV., 13 dem
XV., 17 dem XVI., 1 dem XVII., 6 dem XVIII,
Jahrh. gewidmet. — Die Stein- und Holzskulptur ist
ziemlich gleichmäßig vertreten, der Metallguß an den
großen Türen in Nowgorod und Verona, wie den