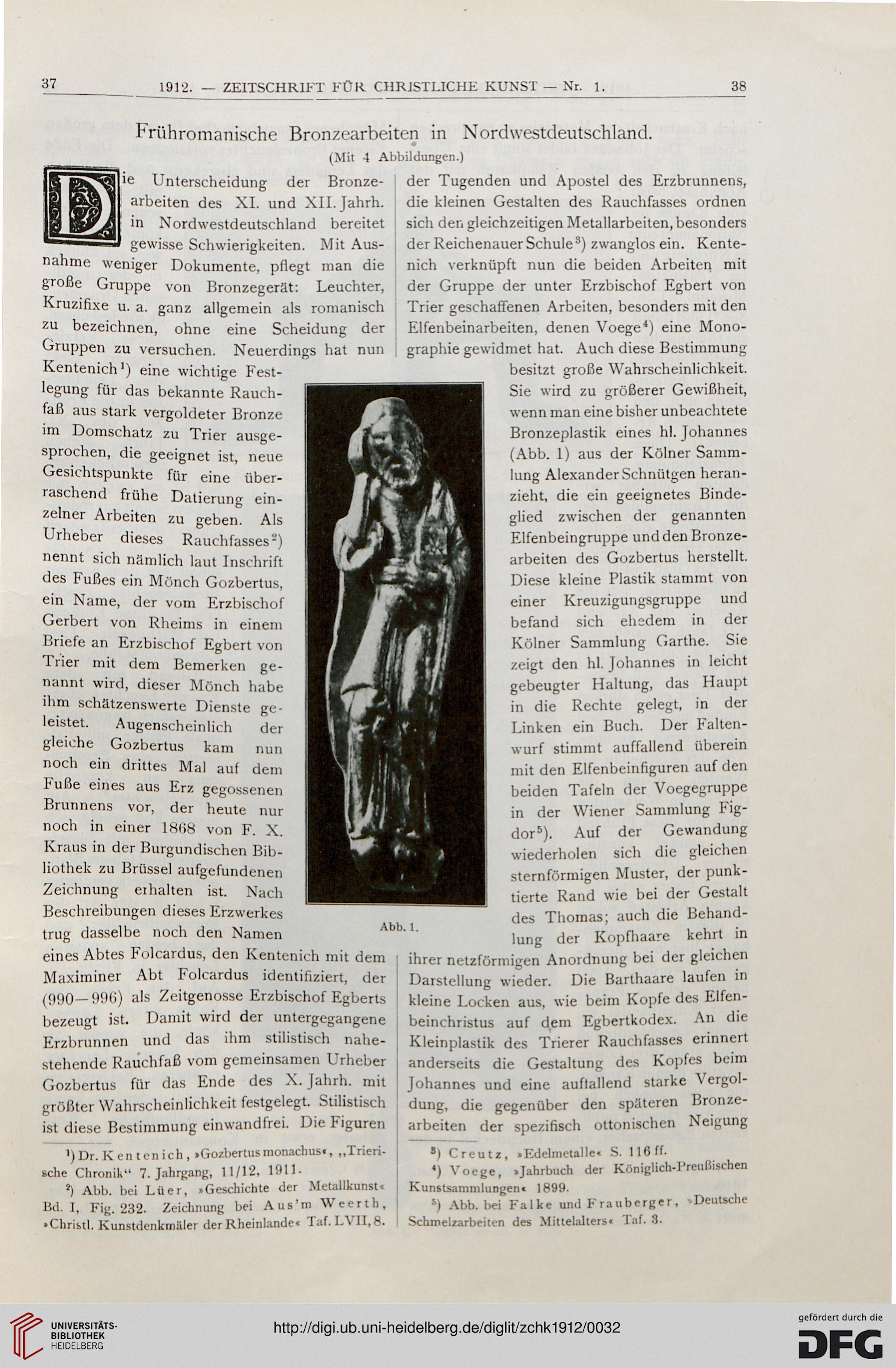37
1912. — ZEITSCHRIFT KÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
38
Frühromanische Bronzearbeiten in Nordwestdeutschland.
(Mit 4 Abbildungen.)
'e Unterscheidung der Bronze-
arbeiten des XI. und XILJahrh.
in Nordwestdeutschland bereitet
gewisse Schwierigkeiten. Mit Aus-
der Tugenden und Apostel des Erzbrunnens,
die kleinen Gestalten des Rauchfasses ordnen
sich den gleichzeitigen Metallarbeiten, besonders
der Reichenauer Schule 3) zwanglos ein. Kente-
nich verknüpft nun die beiden Arbeiten mit
nähme weniger Dokumente, pflegt man dij
große Gruppe von Bronzegerät: Leuchter, der Gruppe der unter Erzbischof Egbert von
Kruzifixe u. a. ganz allgemein als romanisch Trier geschaffenen Arbeiten, besonders mit den
zu bezeichnen, ohne eine Scheidung der Elfenbeinarbeiten, denen Voege4) eine Mono-
Gruppen zu versuchen. Neuerdings hat nun | graphie gewidmet hat. Auch diese Bestimmun
Kenternd!1) eine wichtige Fest-
legung für das bekannte Rauch-
faß aus stark vergoldeter Bronze
im Domschatz zu Trier ausge-
sprochen, die geeignet ist, neue
Gesichtspunkte für eine über-
raschend frühe Datierung ein-
zelner Arbeiten zu geben. Als
Urheber dieses Rauchfasses'-)
nennt sich nämlich laut Inschrift
des Fußes ein Mönch Gozbertus,
ein Name, der vom Erzbischof
Gerbert von Rheims in einem
Briefe an Erzbischof Egbert von
Trier mit dem Bemerken ge-
nannt wird, dieser Mönch habe
ihm schätzenswerte Dienste ge-
leistet. Augenscheinlich der
gleiche Gozbertus kam nun
noch ein drittes Mal auf dem
Fuße eines aus Erz gegossenen
Brunnens vor, der heute nur
noch in einer 18(18 von F. X.
Kraus in der Burgundischen Bib-
liothek zu Brüssel aufgefundenen
Zeichnung eihalten ist. Nach
Beschreibungen dieses Erzwerkes
trug dasselbe noch den Namen
eines Abtes Folcardus, den Kentenich mit dem
Maximiner Abt Folcardus identifiziert, der
(990— 996) als Zeitgenosse Erzbischof Egberts
besitzt große Wahrscheinlichkeit.
Sie wird zu größerer Gewißheit,
wenn man eine bisher unbeachtete
Bronzeplastik eines hl. Johannes
(Abb. 1) aus der Kölner Samm-
lung Alexander Schnütgen heran-
zieht, die ein geeignetes Binde-
glied zwischen der genannten
Elfenbeingruppe und den Bronze-
arbeiten des Gozbertus herstellt.
Diese kleine Plastik stammt von
einer Kreuzigungsgruppe und
befand sich ehedem in der
Kölner Sammlung Garthe. Sie
zeigt den hl. Johannes in leicht
gebeugter Haltung, das Haupt
in die Rechte gelegt, in der
Linken ein Buch. Der Falten-
wurf stimmt auffallend überein
mit den Elfenbeinfiguren auf den
beiden Tafeln der Voegegruppe
in der Wiener Sammlung Fig-
dor6). Auf der Gewandung
wiederholen sich die gleichen
sternförmigen Muster, der punk-
tierte Rand wie bei der Gestalt
des Thomas; auch die Behand-
lung der Kopfhaare kehrt in
ihrer netzförmigen Anordnung bei der gleichen
Darstellung wieder. Die Barthaare laufen in
^----------------------- Kleine Locken aus, wie beim Kopfe des Elfen-
bezeugt »st. Damit wird der untergegangene | beinchristus auf dem Egbertkodex. An die
Abb. 1.
Erzbrunnen und das ihm stilistisch nahe-
stehende Rauchfaß vom gemeinsamen Urheber
Gozbertus für das Ende des X. Jahrh. mit
größter Wahrscheinlichkeit festgelegt. Stilistisch
ist diese Bestimmung einwandfrei. Die Figuren
'! Dr. K <-n tenich, »Gozbertusmonachusi, „Trieri-
sche Chronik" 7. Jahrgang, 11/12, 1811-
2) Abb. bei Lüer, »Geschichte der Mefllltuntt«
Bd. 1, Fi». 232. Zeichnung bei Aus'm Wecrth,
»Christi. Kunstdenkmäler der Rheinlande« Taf.LVII,8.
Kleinplastik des Trierer Rauchfasses erinnert
anderseits die Gestaltung des Kopfes beim
Johannes und eine auflallend starke Vergol-
dung, die gegenüber den späteren Bronze-
arbeiten der spezifisch ottonischen Neigung
») Crcut*, »Edelmetalle. S. 116 ff.
4) Voege, »Jahrbuch der Königlich-Preußischen
Kunstsammlungen« 1899.
i Abb. bei Falke und F rauberger, Deutsche
Schmelzarbeiten des Mittelalters« Tat". 3.
1912. — ZEITSCHRIFT KÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
38
Frühromanische Bronzearbeiten in Nordwestdeutschland.
(Mit 4 Abbildungen.)
'e Unterscheidung der Bronze-
arbeiten des XI. und XILJahrh.
in Nordwestdeutschland bereitet
gewisse Schwierigkeiten. Mit Aus-
der Tugenden und Apostel des Erzbrunnens,
die kleinen Gestalten des Rauchfasses ordnen
sich den gleichzeitigen Metallarbeiten, besonders
der Reichenauer Schule 3) zwanglos ein. Kente-
nich verknüpft nun die beiden Arbeiten mit
nähme weniger Dokumente, pflegt man dij
große Gruppe von Bronzegerät: Leuchter, der Gruppe der unter Erzbischof Egbert von
Kruzifixe u. a. ganz allgemein als romanisch Trier geschaffenen Arbeiten, besonders mit den
zu bezeichnen, ohne eine Scheidung der Elfenbeinarbeiten, denen Voege4) eine Mono-
Gruppen zu versuchen. Neuerdings hat nun | graphie gewidmet hat. Auch diese Bestimmun
Kenternd!1) eine wichtige Fest-
legung für das bekannte Rauch-
faß aus stark vergoldeter Bronze
im Domschatz zu Trier ausge-
sprochen, die geeignet ist, neue
Gesichtspunkte für eine über-
raschend frühe Datierung ein-
zelner Arbeiten zu geben. Als
Urheber dieses Rauchfasses'-)
nennt sich nämlich laut Inschrift
des Fußes ein Mönch Gozbertus,
ein Name, der vom Erzbischof
Gerbert von Rheims in einem
Briefe an Erzbischof Egbert von
Trier mit dem Bemerken ge-
nannt wird, dieser Mönch habe
ihm schätzenswerte Dienste ge-
leistet. Augenscheinlich der
gleiche Gozbertus kam nun
noch ein drittes Mal auf dem
Fuße eines aus Erz gegossenen
Brunnens vor, der heute nur
noch in einer 18(18 von F. X.
Kraus in der Burgundischen Bib-
liothek zu Brüssel aufgefundenen
Zeichnung eihalten ist. Nach
Beschreibungen dieses Erzwerkes
trug dasselbe noch den Namen
eines Abtes Folcardus, den Kentenich mit dem
Maximiner Abt Folcardus identifiziert, der
(990— 996) als Zeitgenosse Erzbischof Egberts
besitzt große Wahrscheinlichkeit.
Sie wird zu größerer Gewißheit,
wenn man eine bisher unbeachtete
Bronzeplastik eines hl. Johannes
(Abb. 1) aus der Kölner Samm-
lung Alexander Schnütgen heran-
zieht, die ein geeignetes Binde-
glied zwischen der genannten
Elfenbeingruppe und den Bronze-
arbeiten des Gozbertus herstellt.
Diese kleine Plastik stammt von
einer Kreuzigungsgruppe und
befand sich ehedem in der
Kölner Sammlung Garthe. Sie
zeigt den hl. Johannes in leicht
gebeugter Haltung, das Haupt
in die Rechte gelegt, in der
Linken ein Buch. Der Falten-
wurf stimmt auffallend überein
mit den Elfenbeinfiguren auf den
beiden Tafeln der Voegegruppe
in der Wiener Sammlung Fig-
dor6). Auf der Gewandung
wiederholen sich die gleichen
sternförmigen Muster, der punk-
tierte Rand wie bei der Gestalt
des Thomas; auch die Behand-
lung der Kopfhaare kehrt in
ihrer netzförmigen Anordnung bei der gleichen
Darstellung wieder. Die Barthaare laufen in
^----------------------- Kleine Locken aus, wie beim Kopfe des Elfen-
bezeugt »st. Damit wird der untergegangene | beinchristus auf dem Egbertkodex. An die
Abb. 1.
Erzbrunnen und das ihm stilistisch nahe-
stehende Rauchfaß vom gemeinsamen Urheber
Gozbertus für das Ende des X. Jahrh. mit
größter Wahrscheinlichkeit festgelegt. Stilistisch
ist diese Bestimmung einwandfrei. Die Figuren
'! Dr. K <-n tenich, »Gozbertusmonachusi, „Trieri-
sche Chronik" 7. Jahrgang, 11/12, 1811-
2) Abb. bei Lüer, »Geschichte der Mefllltuntt«
Bd. 1, Fi». 232. Zeichnung bei Aus'm Wecrth,
»Christi. Kunstdenkmäler der Rheinlande« Taf.LVII,8.
Kleinplastik des Trierer Rauchfasses erinnert
anderseits die Gestaltung des Kopfes beim
Johannes und eine auflallend starke Vergol-
dung, die gegenüber den späteren Bronze-
arbeiten der spezifisch ottonischen Neigung
») Crcut*, »Edelmetalle. S. 116 ff.
4) Voege, »Jahrbuch der Königlich-Preußischen
Kunstsammlungen« 1899.
i Abb. bei Falke und F rauberger, Deutsche
Schmelzarbeiten des Mittelalters« Tat". 3.