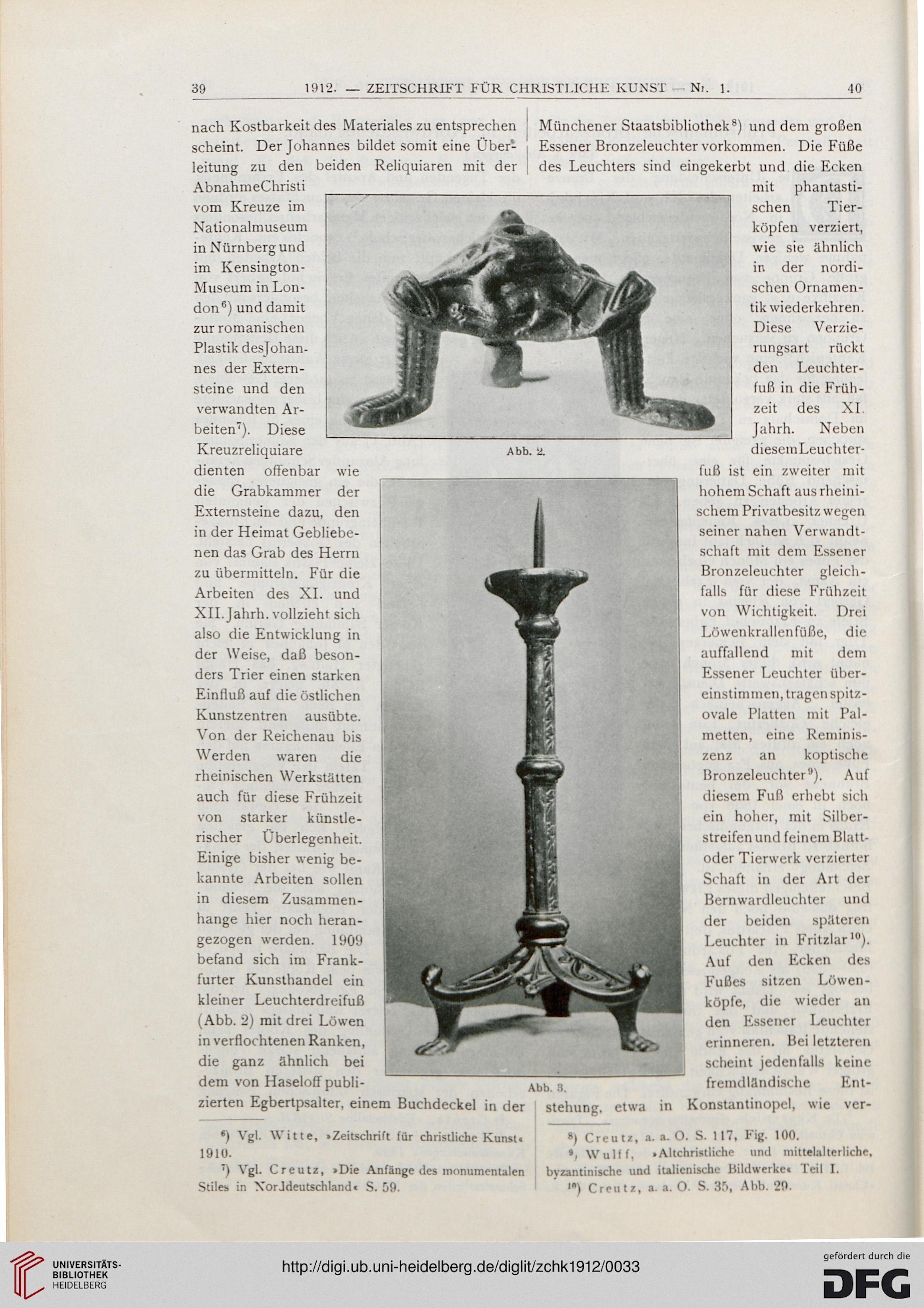39
1912.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Ni. 1.
40
wie
der
Abb.
nach Kostbarkeit des Materiales zu entsprechen
scheint. Der Johannes bildet somit eine Über-
leitung zu den beiden Reliquiaren mit der
AbnahmeChristi
vom Kreuze im
Nationalmuseum
in Nürnberg und
im Kensington-
Museum in Lon-
don6) und damit
zurromanischen
Plastik desJohan-
nes der Extern-
steine und den
verwandten Ar-
beiten"). Diese
Kreuzreliquiare
dienten offenbar
die Grabkammer
Externsteine dazu, den
in der Heimat Gebliebe-
nen das Grab des Herrn
zu übermitteln. Für die
Arbeiten des XI. und
XII. Jahrh. vollzieht sich
also die Entwicklung in
der Weise, daß beson-
ders Trier einen starken
Einfluß auf die östlichen
Kunstzentren ausübte.
Von der Reichenau bis
Werden waren die
rheinischen Werkstätten
auch für diese Frühzeit
von starker künstle-
rischer Überlegenheit.
Einige bisher wenig be-
kannte Arbeiten sollen
in diesem Zusammen-
hange hier noch heran-
gezogen werden. 1909
befand sich im Frank-
furter Kunsthandel ein
kleiner Leuchterdreifuß
(Abb. 2) mit drei Löwen
in verflochtenen Ranken,
die ganz ähnlich bei
dem von Haseloff publi-
zierten Egbertpsalter, einem Buchdeckel in der
') VK'- Witte, »Zeitschrift für christliche Kunstt
1910.
") Vgl. Creutz, «Die Anfänge des monumentalen
Stiles in XorJdeutschlancU S. 09.
Münchener Staatsbibliothek8) und dem großen
Essener Bronzeleuchter vorkommen. Die Füße
des Leuchters sind eingekerbt und die Ecken
mit phantasti-
schen Tier-
köpfen verziert,
wie sie ähnlich
in der nordi-
schen Ornamen-
tikwiederkehren.
Diese Verzie-
rungsart rückt
den Leuchter-
fuß in die Früh-
zeit des X1
Jahrh. Neben
diesemLeuchter-
fuß ist ein zweiter mit
hohem Schaft aus rheini-
schem Privatbesitz wegen
seiner nahen Verwandt-
schaft mit dem Essener
Bronzeleuchter gleich-
falls für diese Frühzeil
von Wichtigkeit. Drei
Löwenkrallenfüße, die
auffallend mit dem
Essener Leuchter über-
einstimmen, tragen spitz*
ovale Platten mit Pal-
metten, eine Reminis-
zenz an koptisi he
Bronzeleuchter*). Auf
diesem Fuß erhebt sich
ein hoher, mit Silber«
streifen und feinem Blatt-
oder Tierwerk verzierte]
S( halt in der Art der
Bernwardleuchter und
der beiden spateren
Leuchter in Fritzlar "'i.
Aut den Ecken des
Fußes sitzen Löwen-
kopfe, die wieder an
den Essener Leuchtet
erinneren. Hei letzteren
m beint jedenfalls keine
fremdländisi he Ent-
stehung, etwa in Konstantinnpel. wie ver-
») Creutz, a. S.O. S. 117, «g. 100.
», Wulff, »Altchristliclir utnl trHttsliJttrUdie,
bvzantinische und italienische Hildweikr. IVil I.
'•) Cr out?, ;< .'■ <» s. 86, AM». 29.
Abb.
1912.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Ni. 1.
40
wie
der
Abb.
nach Kostbarkeit des Materiales zu entsprechen
scheint. Der Johannes bildet somit eine Über-
leitung zu den beiden Reliquiaren mit der
AbnahmeChristi
vom Kreuze im
Nationalmuseum
in Nürnberg und
im Kensington-
Museum in Lon-
don6) und damit
zurromanischen
Plastik desJohan-
nes der Extern-
steine und den
verwandten Ar-
beiten"). Diese
Kreuzreliquiare
dienten offenbar
die Grabkammer
Externsteine dazu, den
in der Heimat Gebliebe-
nen das Grab des Herrn
zu übermitteln. Für die
Arbeiten des XI. und
XII. Jahrh. vollzieht sich
also die Entwicklung in
der Weise, daß beson-
ders Trier einen starken
Einfluß auf die östlichen
Kunstzentren ausübte.
Von der Reichenau bis
Werden waren die
rheinischen Werkstätten
auch für diese Frühzeit
von starker künstle-
rischer Überlegenheit.
Einige bisher wenig be-
kannte Arbeiten sollen
in diesem Zusammen-
hange hier noch heran-
gezogen werden. 1909
befand sich im Frank-
furter Kunsthandel ein
kleiner Leuchterdreifuß
(Abb. 2) mit drei Löwen
in verflochtenen Ranken,
die ganz ähnlich bei
dem von Haseloff publi-
zierten Egbertpsalter, einem Buchdeckel in der
') VK'- Witte, »Zeitschrift für christliche Kunstt
1910.
") Vgl. Creutz, «Die Anfänge des monumentalen
Stiles in XorJdeutschlancU S. 09.
Münchener Staatsbibliothek8) und dem großen
Essener Bronzeleuchter vorkommen. Die Füße
des Leuchters sind eingekerbt und die Ecken
mit phantasti-
schen Tier-
köpfen verziert,
wie sie ähnlich
in der nordi-
schen Ornamen-
tikwiederkehren.
Diese Verzie-
rungsart rückt
den Leuchter-
fuß in die Früh-
zeit des X1
Jahrh. Neben
diesemLeuchter-
fuß ist ein zweiter mit
hohem Schaft aus rheini-
schem Privatbesitz wegen
seiner nahen Verwandt-
schaft mit dem Essener
Bronzeleuchter gleich-
falls für diese Frühzeil
von Wichtigkeit. Drei
Löwenkrallenfüße, die
auffallend mit dem
Essener Leuchter über-
einstimmen, tragen spitz*
ovale Platten mit Pal-
metten, eine Reminis-
zenz an koptisi he
Bronzeleuchter*). Auf
diesem Fuß erhebt sich
ein hoher, mit Silber«
streifen und feinem Blatt-
oder Tierwerk verzierte]
S( halt in der Art der
Bernwardleuchter und
der beiden spateren
Leuchter in Fritzlar "'i.
Aut den Ecken des
Fußes sitzen Löwen-
kopfe, die wieder an
den Essener Leuchtet
erinneren. Hei letzteren
m beint jedenfalls keine
fremdländisi he Ent-
stehung, etwa in Konstantinnpel. wie ver-
») Creutz, a. S.O. S. 117, «g. 100.
», Wulff, »Altchristliclir utnl trHttsliJttrUdie,
bvzantinische und italienische Hildweikr. IVil I.
'•) Cr out?, ;< .'■ <» s. 86, AM». 29.
Abb.