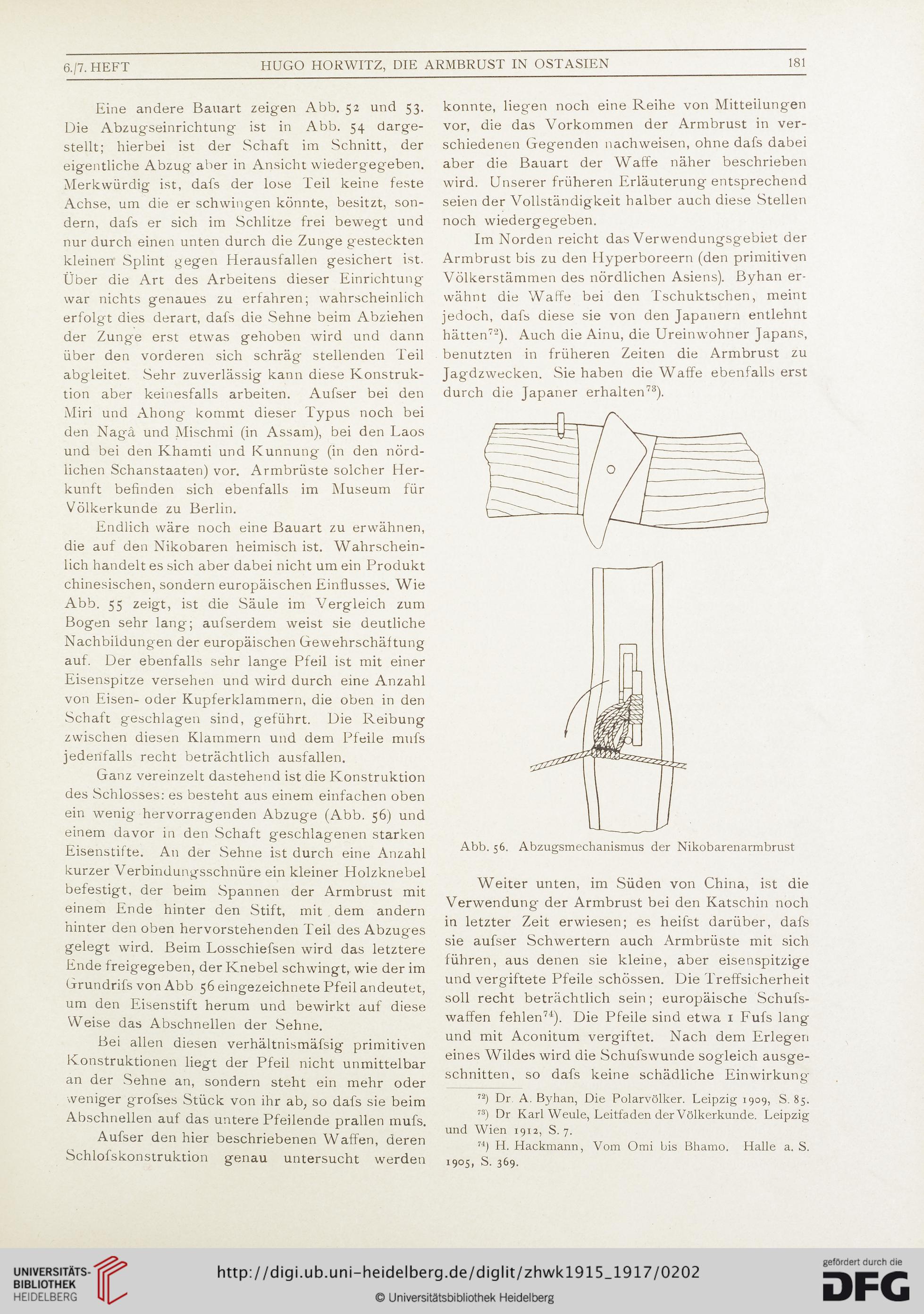6./7. HEFT
HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN
181
Eine andere Bauart zeigen Abb. 52 und 53.
Die Abzugseinrichtung ist in Abb. 54 darge-
stellt; hierbei ist der Schaft im Schnitt, der
eigentliche Abzug aber in Ansicht wiedergegeben.
Merkwürdig ist, dafs der lose Teil keine feste
Achse, um die er schwingen könnte, besitzt, son-
dern, dafs er sich im Schlitze frei bewegt und
nur durch einen unten durch die Zunge gesteckten
kleinen Splint gegen Herausfallen gesichert ist.
Über die Art des Arbeitens dieser Einrichtung
war nichts genaues zu erfahren; wahrscheinlich
erfolgt dies derart, dafs die Sehne beim Abziehen
der Zunge erst etwas gehoben wird und dann
über den vorderen sich schräg stellenden Teil
abgleitet. Sehr zuverlässig kann diese Konstruk-
tion aber keinesfalls arbeiten. Aufser bei den
Miri und xYhong kommt dieser Typus noch bei
den Nagä und Mischmi (in Assam), bei den Laos
und bei den Khamti und Kunnung (in den nörd-
lichen Schanstaaten) vor. Armbrüste solcher Her-
kunft befinden sich ebenfalls im Museum für
Völkerkunde zu Berlin.
Endlich wäre noch eine Bauart zu erwähnen,
die auf den Nikobaren heimisch ist. Wahrschein-
lich handelt es sich aber dabei nicht um ein Produkt
chinesischen, sondern europäischen Einflusses. Wie
Abb. 55 zeigt, ist die Säule im Vergleich zum
Bogen sehr lang; aufserdem weist sie deutliche
Nachbildung'en der europäischen Gewehrschäftung
auf. Der ebenfalls sehr lange Pfeil ist mit einer
Eisenspitze versehen und wird durch eine Anzahl
von Eisen- oder Kupferklammern, die oben in den
Schaft geschlagen sind, geführt. Die Reibung
zwischen diesen Klammern und dem Pfeile mufs
jedenfalls recht beträchtlich ausfallen.
Ganz vereinzelt dastehend ist die Konstruktion
des Schlosses: es besteht aus einem einfachen oben
ein wenig hervorragenden Abzüge (Abb. 56) und
einem davor in den Schaft geschlagenen starken
Eisenstifte. An der Sehne ist durch eine Anzahl
kurzer Verbindungsschnüre ein kleiner Holzknebel
befestigt, der beim Spannen der Armbrust mit
einem Ende hinter den Stift, mit dem andern
hinter den oben hervorstehen den Teil des Abzuges
gelegt wird. Beim Losschiefsen wird das letztere
Ende freigegeben, der Knebel schwingt, wie der im
Grundrifs von Abb 56 eingezeichnete Pfeil andeutet,
um den Eisenstift herum und bewirkt auf diese
Weise das Abschnellen der Sehne.
Bei allen diesen verhältnismäfsig primitiven
Konstruktionen liegt der Pfeil nicht unmittelbar
an der Sehne an, sondern steht ein mehr oder
weniger grofses Stück von ihr ab, so dafs sie beim
Abschnellen auf das untere Pfeilende prallen mufs.
Aufser den hier beschriebenen Waffen, deren
Schlofskonstruktion genau untersucht werden
konnte, liegen noch eine Reihe von Mitteilungen
vor, die das Vorkommen der Armbrust in ver-
schiedenen Gegenden nachweisen, ohne dafs dabei
aber die Bauart der Waffe näher beschrieben
wird. Unserer früheren Erläuterung entsprechend
seien der Vollständigkeit halber auch diese Stellen
noch wiedergegeben.
Im Norden reicht das Verwendungsgebiet der
Armbrust bis zu den Hyperboreern (den primitiven
Völkerstämmen des nördlichen Asiens). Byhan er-
wähnt die Waffe bei den Tschuktschen, meint
jedoch, dafs diese sie von den Japanern entlehnt
hätten72). Auch die Ainu, die Ureinwohner Japans,
benutzten in früheren Zeiten die Armbrust zu
Jagdzwecken. Sie haben die Waffe ebenfalls erst
durch die Japaner erhalten73).
Abb. 56. Abzugsmechanismus der Nikobarenarmbrust
Weiter unten, im Süden von China, ist die
Verwendung der Armbrust bei den Katschin noch
in letzter Zeit erwiesen; es heilst darüber, dafs
sie aufser Schwertern auch Armbrüste mit sich
führen, aus denen sie kleine, aber eisenspitzige
und vergiftete Pfeile schössen. Die Treffsicherheit
soll recht beträchtlich sein; europäische Schufs-
waffen fehlen74). Die Pfeile sind etwa 1 Fufs lang
und mit Aconitum vergiftet. Nach dem Erlegen
eines Wildes wird die Schufswunde sogleich ausge-
schnitten, so dafs keine schädliche Einwirkung
n) Dr. A. Byhan, Die Polarvölker. Leipzig 1909, S. 85.
7S) Dr Karl Weule, Leitfaden der Völkerkunde. Leipzig
und Wien 1912, S. 7.
74) H. Hackmann, Vom Omi bis Bhamo, Halle a. S.
1905, S. 369.
HUGO HORWITZ, DIE ARMBRUST IN OSTASIEN
181
Eine andere Bauart zeigen Abb. 52 und 53.
Die Abzugseinrichtung ist in Abb. 54 darge-
stellt; hierbei ist der Schaft im Schnitt, der
eigentliche Abzug aber in Ansicht wiedergegeben.
Merkwürdig ist, dafs der lose Teil keine feste
Achse, um die er schwingen könnte, besitzt, son-
dern, dafs er sich im Schlitze frei bewegt und
nur durch einen unten durch die Zunge gesteckten
kleinen Splint gegen Herausfallen gesichert ist.
Über die Art des Arbeitens dieser Einrichtung
war nichts genaues zu erfahren; wahrscheinlich
erfolgt dies derart, dafs die Sehne beim Abziehen
der Zunge erst etwas gehoben wird und dann
über den vorderen sich schräg stellenden Teil
abgleitet. Sehr zuverlässig kann diese Konstruk-
tion aber keinesfalls arbeiten. Aufser bei den
Miri und xYhong kommt dieser Typus noch bei
den Nagä und Mischmi (in Assam), bei den Laos
und bei den Khamti und Kunnung (in den nörd-
lichen Schanstaaten) vor. Armbrüste solcher Her-
kunft befinden sich ebenfalls im Museum für
Völkerkunde zu Berlin.
Endlich wäre noch eine Bauart zu erwähnen,
die auf den Nikobaren heimisch ist. Wahrschein-
lich handelt es sich aber dabei nicht um ein Produkt
chinesischen, sondern europäischen Einflusses. Wie
Abb. 55 zeigt, ist die Säule im Vergleich zum
Bogen sehr lang; aufserdem weist sie deutliche
Nachbildung'en der europäischen Gewehrschäftung
auf. Der ebenfalls sehr lange Pfeil ist mit einer
Eisenspitze versehen und wird durch eine Anzahl
von Eisen- oder Kupferklammern, die oben in den
Schaft geschlagen sind, geführt. Die Reibung
zwischen diesen Klammern und dem Pfeile mufs
jedenfalls recht beträchtlich ausfallen.
Ganz vereinzelt dastehend ist die Konstruktion
des Schlosses: es besteht aus einem einfachen oben
ein wenig hervorragenden Abzüge (Abb. 56) und
einem davor in den Schaft geschlagenen starken
Eisenstifte. An der Sehne ist durch eine Anzahl
kurzer Verbindungsschnüre ein kleiner Holzknebel
befestigt, der beim Spannen der Armbrust mit
einem Ende hinter den Stift, mit dem andern
hinter den oben hervorstehen den Teil des Abzuges
gelegt wird. Beim Losschiefsen wird das letztere
Ende freigegeben, der Knebel schwingt, wie der im
Grundrifs von Abb 56 eingezeichnete Pfeil andeutet,
um den Eisenstift herum und bewirkt auf diese
Weise das Abschnellen der Sehne.
Bei allen diesen verhältnismäfsig primitiven
Konstruktionen liegt der Pfeil nicht unmittelbar
an der Sehne an, sondern steht ein mehr oder
weniger grofses Stück von ihr ab, so dafs sie beim
Abschnellen auf das untere Pfeilende prallen mufs.
Aufser den hier beschriebenen Waffen, deren
Schlofskonstruktion genau untersucht werden
konnte, liegen noch eine Reihe von Mitteilungen
vor, die das Vorkommen der Armbrust in ver-
schiedenen Gegenden nachweisen, ohne dafs dabei
aber die Bauart der Waffe näher beschrieben
wird. Unserer früheren Erläuterung entsprechend
seien der Vollständigkeit halber auch diese Stellen
noch wiedergegeben.
Im Norden reicht das Verwendungsgebiet der
Armbrust bis zu den Hyperboreern (den primitiven
Völkerstämmen des nördlichen Asiens). Byhan er-
wähnt die Waffe bei den Tschuktschen, meint
jedoch, dafs diese sie von den Japanern entlehnt
hätten72). Auch die Ainu, die Ureinwohner Japans,
benutzten in früheren Zeiten die Armbrust zu
Jagdzwecken. Sie haben die Waffe ebenfalls erst
durch die Japaner erhalten73).
Abb. 56. Abzugsmechanismus der Nikobarenarmbrust
Weiter unten, im Süden von China, ist die
Verwendung der Armbrust bei den Katschin noch
in letzter Zeit erwiesen; es heilst darüber, dafs
sie aufser Schwertern auch Armbrüste mit sich
führen, aus denen sie kleine, aber eisenspitzige
und vergiftete Pfeile schössen. Die Treffsicherheit
soll recht beträchtlich sein; europäische Schufs-
waffen fehlen74). Die Pfeile sind etwa 1 Fufs lang
und mit Aconitum vergiftet. Nach dem Erlegen
eines Wildes wird die Schufswunde sogleich ausge-
schnitten, so dafs keine schädliche Einwirkung
n) Dr. A. Byhan, Die Polarvölker. Leipzig 1909, S. 85.
7S) Dr Karl Weule, Leitfaden der Völkerkunde. Leipzig
und Wien 1912, S. 7.
74) H. Hackmann, Vom Omi bis Bhamo, Halle a. S.
1905, S. 369.