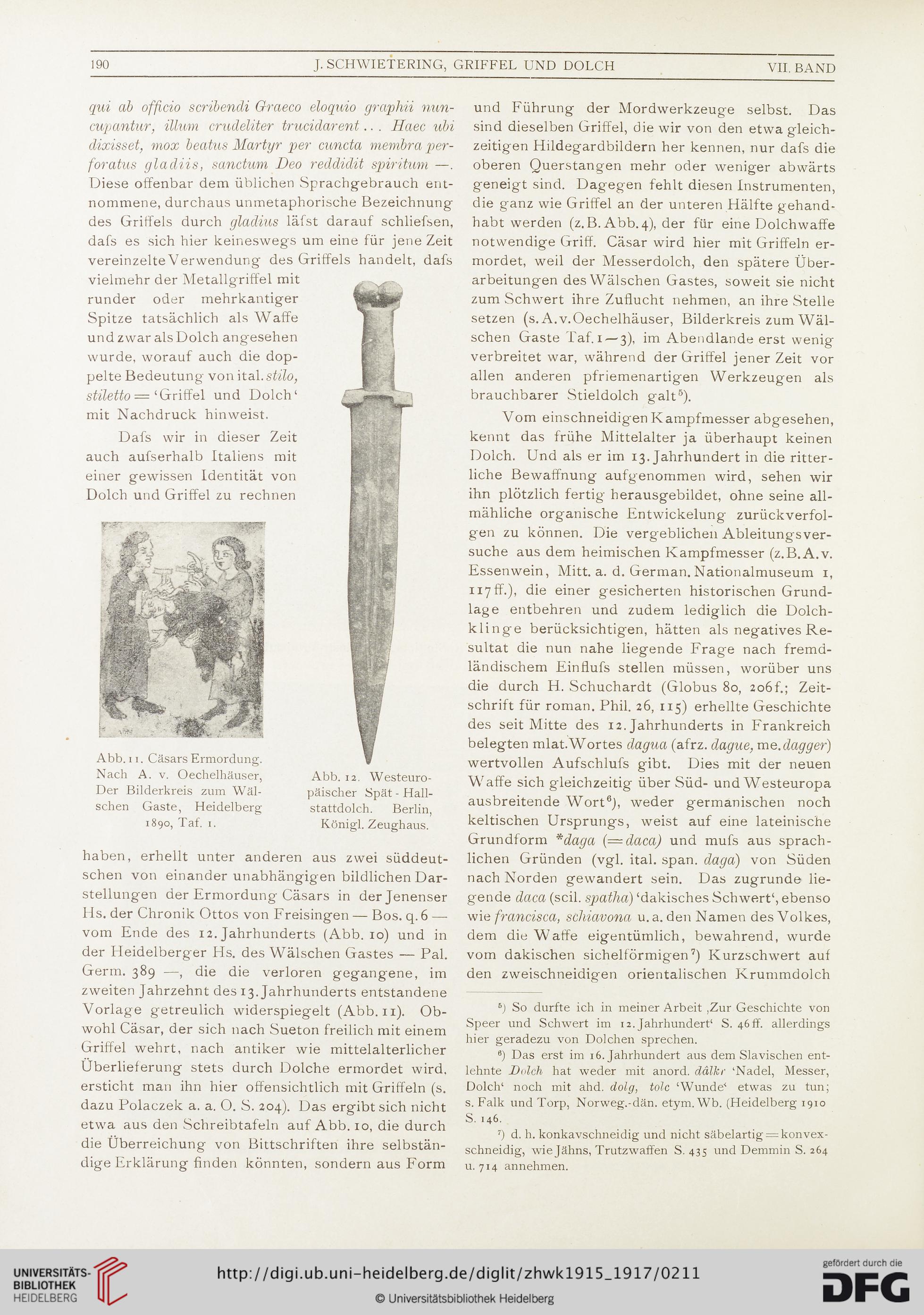190
J. SCHWIETERING, GRIFFEL UND DOLCH
VII. BAND
qui ab officio scribendi Oraeco eloquio graphii nun-
cupantur, illum crudeliter trucidarent.. . Haec ubi
dixisset, mox beatus Martyr per cunctci membra per-
foratus gladiis, sanctum Deo reddidit spirituni —.
Diese offenbar dem üblichen Sprachgebrauch ent-
nommene, durchaus unmetaphorische Bezeichnung
des Griffels durch gladius läfst darauf schliefsen,
dafs es sich hier keineswegs um eine für jene Zeit
vereinzelte Verwendung des Griffels handelt, dafs
vielmehr der Metallgriffel mit
runder oder mehrkantiger
Spitze tatsächlich als Waffe
und zwar als Dolch angesehen
wurde, worauf auch die dop-
pelte Bedeutung von ital. stilo,
stiletto=lGriffel und Dolch1
mit Nachdruck hinweist.
Dafs wir in dieser Zeit
auch aufserhalb Italiens mit
einer gewissen Identität von
Dolch und Griffel zu rechnen
Abb. 11. Cäsars Ermordung.
Nach A. v. Oechelhäuser, Abb. 12. Westeuro-
Der Bilderkreis zum Wäl- päischer Spät - Hall-
schen Gaste, Heidelberg stattdolch. Berlin,
1890, Tat. 1. Königl. Zeughaus.
haben, erhellt unter anderen aus zwei süddeut-
schen von einander unabhängigen bildlichen Dar-
stellungen der Ermordung Cäsars in der Jenenser
Hs. der Chronik Ottos von Freisingen — Bos. q. 6 —
vom Ende des 12. Jahrhunderts (Abb. 10) und in
der Heidelberger Hs. des Wälschen Gastes — Pal.
Germ. 389 —, die die verloren gegangene, im
zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts entstandene
Vorlage getreulich widerspiegelt (Abb. 11). Ob-
wohl Cäsar, der sich nach Sueton freilich mit einem
Griffel wehrt, nach antiker wie mittelalterlicher
Überlieferung stets durch Dolche ermordet wird,
ersticht man ihn hier offensichtlich mit Griffeln (s.
dazu Polaczek a. a. O. S. 204). Das ergibt sich nicht
etwa aus den Schreibtafeln auf Abb. 10, die durch
die Überreichung von Bittschriften ihre selbstän-
dige Erklärung finden könnten, sondern aus Form
und Führung der Mordwerkzeuge selbst. Das
sind dieselben Griffel, die wir von den etwa gleich-
zeitigen Hildegardbildern her kennen, nur dafs die
oberen Querstangen mehr oder weniger abwärts
geneigt sind. Dagegen fehlt diesen Instrumenten,
die ganz wie Griffel an der unteren Hälfte gehand-
habt werden (z.B.Abb.4), der für eine Dolchwaffe
notwendige Griff. Cäsar wird hier mit Griffeln er-
mordet, weil der Messerdolch, den spätere Über-
arbeitungen des Wälschen Gastes, soweit sie nicht
zum Schwert ihre Zuflucht nehmen, an ihre Stelle
setzen (s. A.v.Oechelhäuser, Bilderkreis zum Wäl-
schen Gaste Taf. 1 — 3), im Abendlande erst wenig
verbreitet war, während der Griffel jener Zeit vor
allen anderen pfriemenartigen Werkzeugen als
brauchbarer Stieldolch galt5).
Vom einschneidigen Kampfmesser abgesehen,
kennt das frühe Mittelalter ja überhaupt keinen
Dolch. Und als er im 13. Jahrhundert in die ritter-
liche Bewaffnung aufgenommen wird, sehen wir
ihn plötzlich fertig herausgebildet, ohne seine all-
mähliche organische Entwickelung zurückverfol-
gen zu können. Die vergeblichen Ableitungsver-
suche aus dem heimischen Kampfmesser (z.B.A.v.
Essenwein, Mitt. a. d. German.Nationalmuseum 1,
iiyff.), die einer gesicherten historischen Grund-
lage entbehren und zudem lediglich die Dolch-
klinge berücksichtigen, hätten als negatives Re-
sultat die nun nahe liegende Frage nach fremd-
ländischem Einflufs stellen müssen, worüber uns
die durch H. Schuchardt (Globus 80, 2o6f.; Zeit-
schrift für roman. Phil. 26, 115) erhellte Geschichte
des seit Mitte des 12. Jahrhunderts in Frankreich
belegten mlat.Wortes dagua (afrz. dague, me.dagger)
wertvollen Aufschlufs gibt. Dies mit der neuen
Waffe sich gleichzeitig über Süd- und Westeuropa
ausbreitende Wort6), weder germanischen noch
keltischen Ursprungs, weist auf eine lateinische
Grundform *daga (—daca) und mufs aus sprach-
lichen Gründen (vgl. ital. span, daga) von Süden
nach Norden gewandert sein. Das zugrunde lie-
gende daca (seil, spatha) ‘dakisches Schwert4, ebenso
wie francisca, schiavona u.a. den Namen des Volkes,
dem die Waffe eigentümlich, bewahrend, wurde
vom dakischen sichelförmigen7) Kurzschwert auf
den zweischneidigen orientalischen Krummdolch
5) So durfte ich in meiner Arbeit ,Zur Geschichte von
Speer und Schwert im 12. Jahrhundert1 S. 46 ff. allerdings
hier geradezu von Dolchen sprechen.
8) Das erst im 16. Jahrhundert aus dem Slavischen ent-
lehnte Dolch hat weder mit anord. dälkr ‘Nadel, Messer,
Dolch1 noch mit ahd. dolg, tolc tWunde< etwas zu tun;
s. Falk und Torp, Norweg.-dän. etym.Wb. (Heidelberg 1910
S.146.
7) d. h. konkavschneidig und nicht säbelartig = konvex-
schneidig, wiejähns, Trutzwaffen S. 435 und Demmin S. 264
u. 714 annehmen.
J. SCHWIETERING, GRIFFEL UND DOLCH
VII. BAND
qui ab officio scribendi Oraeco eloquio graphii nun-
cupantur, illum crudeliter trucidarent.. . Haec ubi
dixisset, mox beatus Martyr per cunctci membra per-
foratus gladiis, sanctum Deo reddidit spirituni —.
Diese offenbar dem üblichen Sprachgebrauch ent-
nommene, durchaus unmetaphorische Bezeichnung
des Griffels durch gladius läfst darauf schliefsen,
dafs es sich hier keineswegs um eine für jene Zeit
vereinzelte Verwendung des Griffels handelt, dafs
vielmehr der Metallgriffel mit
runder oder mehrkantiger
Spitze tatsächlich als Waffe
und zwar als Dolch angesehen
wurde, worauf auch die dop-
pelte Bedeutung von ital. stilo,
stiletto=lGriffel und Dolch1
mit Nachdruck hinweist.
Dafs wir in dieser Zeit
auch aufserhalb Italiens mit
einer gewissen Identität von
Dolch und Griffel zu rechnen
Abb. 11. Cäsars Ermordung.
Nach A. v. Oechelhäuser, Abb. 12. Westeuro-
Der Bilderkreis zum Wäl- päischer Spät - Hall-
schen Gaste, Heidelberg stattdolch. Berlin,
1890, Tat. 1. Königl. Zeughaus.
haben, erhellt unter anderen aus zwei süddeut-
schen von einander unabhängigen bildlichen Dar-
stellungen der Ermordung Cäsars in der Jenenser
Hs. der Chronik Ottos von Freisingen — Bos. q. 6 —
vom Ende des 12. Jahrhunderts (Abb. 10) und in
der Heidelberger Hs. des Wälschen Gastes — Pal.
Germ. 389 —, die die verloren gegangene, im
zweiten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts entstandene
Vorlage getreulich widerspiegelt (Abb. 11). Ob-
wohl Cäsar, der sich nach Sueton freilich mit einem
Griffel wehrt, nach antiker wie mittelalterlicher
Überlieferung stets durch Dolche ermordet wird,
ersticht man ihn hier offensichtlich mit Griffeln (s.
dazu Polaczek a. a. O. S. 204). Das ergibt sich nicht
etwa aus den Schreibtafeln auf Abb. 10, die durch
die Überreichung von Bittschriften ihre selbstän-
dige Erklärung finden könnten, sondern aus Form
und Führung der Mordwerkzeuge selbst. Das
sind dieselben Griffel, die wir von den etwa gleich-
zeitigen Hildegardbildern her kennen, nur dafs die
oberen Querstangen mehr oder weniger abwärts
geneigt sind. Dagegen fehlt diesen Instrumenten,
die ganz wie Griffel an der unteren Hälfte gehand-
habt werden (z.B.Abb.4), der für eine Dolchwaffe
notwendige Griff. Cäsar wird hier mit Griffeln er-
mordet, weil der Messerdolch, den spätere Über-
arbeitungen des Wälschen Gastes, soweit sie nicht
zum Schwert ihre Zuflucht nehmen, an ihre Stelle
setzen (s. A.v.Oechelhäuser, Bilderkreis zum Wäl-
schen Gaste Taf. 1 — 3), im Abendlande erst wenig
verbreitet war, während der Griffel jener Zeit vor
allen anderen pfriemenartigen Werkzeugen als
brauchbarer Stieldolch galt5).
Vom einschneidigen Kampfmesser abgesehen,
kennt das frühe Mittelalter ja überhaupt keinen
Dolch. Und als er im 13. Jahrhundert in die ritter-
liche Bewaffnung aufgenommen wird, sehen wir
ihn plötzlich fertig herausgebildet, ohne seine all-
mähliche organische Entwickelung zurückverfol-
gen zu können. Die vergeblichen Ableitungsver-
suche aus dem heimischen Kampfmesser (z.B.A.v.
Essenwein, Mitt. a. d. German.Nationalmuseum 1,
iiyff.), die einer gesicherten historischen Grund-
lage entbehren und zudem lediglich die Dolch-
klinge berücksichtigen, hätten als negatives Re-
sultat die nun nahe liegende Frage nach fremd-
ländischem Einflufs stellen müssen, worüber uns
die durch H. Schuchardt (Globus 80, 2o6f.; Zeit-
schrift für roman. Phil. 26, 115) erhellte Geschichte
des seit Mitte des 12. Jahrhunderts in Frankreich
belegten mlat.Wortes dagua (afrz. dague, me.dagger)
wertvollen Aufschlufs gibt. Dies mit der neuen
Waffe sich gleichzeitig über Süd- und Westeuropa
ausbreitende Wort6), weder germanischen noch
keltischen Ursprungs, weist auf eine lateinische
Grundform *daga (—daca) und mufs aus sprach-
lichen Gründen (vgl. ital. span, daga) von Süden
nach Norden gewandert sein. Das zugrunde lie-
gende daca (seil, spatha) ‘dakisches Schwert4, ebenso
wie francisca, schiavona u.a. den Namen des Volkes,
dem die Waffe eigentümlich, bewahrend, wurde
vom dakischen sichelförmigen7) Kurzschwert auf
den zweischneidigen orientalischen Krummdolch
5) So durfte ich in meiner Arbeit ,Zur Geschichte von
Speer und Schwert im 12. Jahrhundert1 S. 46 ff. allerdings
hier geradezu von Dolchen sprechen.
8) Das erst im 16. Jahrhundert aus dem Slavischen ent-
lehnte Dolch hat weder mit anord. dälkr ‘Nadel, Messer,
Dolch1 noch mit ahd. dolg, tolc tWunde< etwas zu tun;
s. Falk und Torp, Norweg.-dän. etym.Wb. (Heidelberg 1910
S.146.
7) d. h. konkavschneidig und nicht säbelartig = konvex-
schneidig, wiejähns, Trutzwaffen S. 435 und Demmin S. 264
u. 714 annehmen.