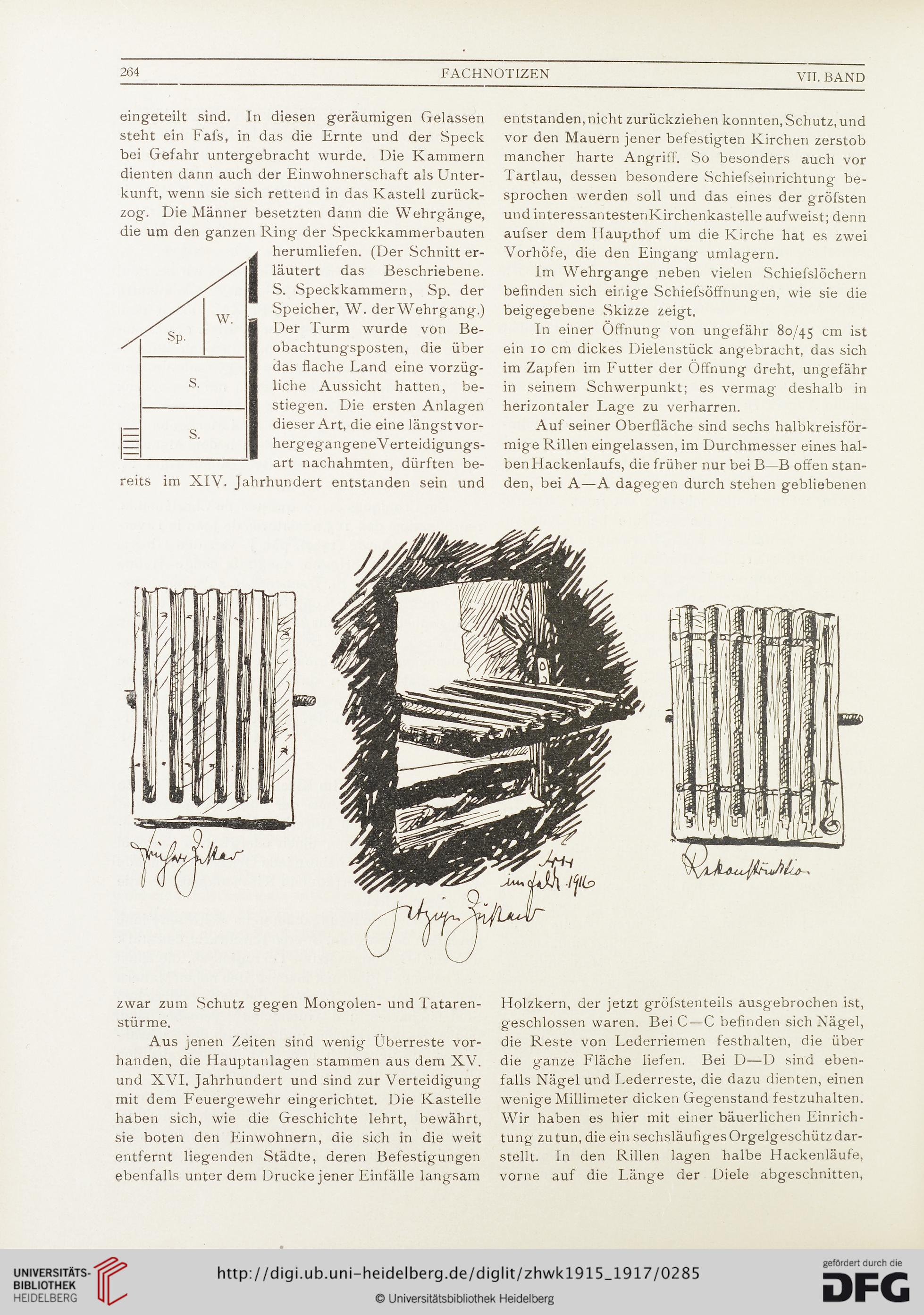264
FACHNOTIZEN
VII. BAND
eingeteilt sind. In diesen geräumigen Gelassen
steht ein Fafs, in das die Ernte und der Speck
bei Gefahr untergebracht wurde. Die Kammern
dienten dann auch der Einwohnerschaft als Unter-
kunft, wenn sie sich rettend in das Kastell zurück-
zog. Die Männer besetzten dann die VVehrgänge,
die um den ganzen Ring der Speckkammerbauten
herumliefen. (Der Schnitt er-
läutert das Beschriebene.
S. Speckkammern, Sp. der
Speicher, W. der Wehrgang.)
Der Turm wurde von Be-
obachtungsposten, die über
das flache Land eine vorzüg-
liche Aussicht hatten, be-
stiegen. Die ersten Anlagen
dieser Art, die eine längst vor-
hergegangen eVerteidigungs-
art nachahmten, dürften be-
reits im XIV. Jahrhundert entstanden sein und
entstanden, nicht zurückziehen konnten, Schutz,und
vor den Mauern jener befestigten Kirchen zerstob
mancher harte Angriff. So besonders auch vor
Tartlau, dessen besondere Schiefseinrichtung be-
sprochen werden soll und das eines der gröfsten
und interessantestenKirchenkastelle aufweist; denn
aufser dem Haupthof um die Kirche hat es zwei
Vorhöfe, die den Eingang umlagern.
Im Wehrgange neben vielen Schiefslöchern
befinden sich einige Schiefsöffnungen, wie sie die
beigegebene Skizze zeigt.
In einer Öffnung von ungefähr 80/45 cm ist
ein 10 cm dickes Dielenstück angebracht, das sich
im Zapfen im Futter der Öffnung dreht, ungefähr
in seinem Schwerpunkt; es vermag deshalb in
herizontaler Lage zu verharren.
Auf seiner Oberfläche sind sechs halbkreisför-
mige Rillen eingelassen, im Durchmesser eines hal-
ben Hackenlaufs, die früher nur bei B B offen stan-
den, bei A—A dagegen durch stehen gebliebenen
zwar zum Schutz gegen Mongolen- und Tataren-
stürme.
Aus jenen Zeiten sind wenig Überreste vor-
handen, die Hauptanlagen stammen aus dem XV.
und XVI. Jahrhundert und sind zur Verteidigung
mit dem Feuergewehr eingerichtet. Die Kastelle
haben sich, wie die Geschichte lehrt, bewährt,
sie boten den Einwohnern, die sich in die weit
entfernt liegenden Städte, deren Befestigungen
ebenfalls unter dem Drucke jener Einfälle langsam
Holzkern, der jetzt gröfstenteils ausgebrochen ist,
geschlossen waren. Bei C—C befinden sich Nägel,
die Reste von Lederriemen festhalten, die über
die ganze Fläche liefen. Bei D—D sind eben-
falls Nägel und Lederreste, die dazu dienten, einen
wenige Millimeter dicken Gegenstand festzuhalten.
Wir haben es hier mit einer bäuerlichen Einrich-
tung zutun, die ein sechsläufiges Orgelgeschütz dar-
stellt. In den Rillen lagen halbe Hackenläufe,
vorne auf die Länge der Diele abgeschnitten,
FACHNOTIZEN
VII. BAND
eingeteilt sind. In diesen geräumigen Gelassen
steht ein Fafs, in das die Ernte und der Speck
bei Gefahr untergebracht wurde. Die Kammern
dienten dann auch der Einwohnerschaft als Unter-
kunft, wenn sie sich rettend in das Kastell zurück-
zog. Die Männer besetzten dann die VVehrgänge,
die um den ganzen Ring der Speckkammerbauten
herumliefen. (Der Schnitt er-
läutert das Beschriebene.
S. Speckkammern, Sp. der
Speicher, W. der Wehrgang.)
Der Turm wurde von Be-
obachtungsposten, die über
das flache Land eine vorzüg-
liche Aussicht hatten, be-
stiegen. Die ersten Anlagen
dieser Art, die eine längst vor-
hergegangen eVerteidigungs-
art nachahmten, dürften be-
reits im XIV. Jahrhundert entstanden sein und
entstanden, nicht zurückziehen konnten, Schutz,und
vor den Mauern jener befestigten Kirchen zerstob
mancher harte Angriff. So besonders auch vor
Tartlau, dessen besondere Schiefseinrichtung be-
sprochen werden soll und das eines der gröfsten
und interessantestenKirchenkastelle aufweist; denn
aufser dem Haupthof um die Kirche hat es zwei
Vorhöfe, die den Eingang umlagern.
Im Wehrgange neben vielen Schiefslöchern
befinden sich einige Schiefsöffnungen, wie sie die
beigegebene Skizze zeigt.
In einer Öffnung von ungefähr 80/45 cm ist
ein 10 cm dickes Dielenstück angebracht, das sich
im Zapfen im Futter der Öffnung dreht, ungefähr
in seinem Schwerpunkt; es vermag deshalb in
herizontaler Lage zu verharren.
Auf seiner Oberfläche sind sechs halbkreisför-
mige Rillen eingelassen, im Durchmesser eines hal-
ben Hackenlaufs, die früher nur bei B B offen stan-
den, bei A—A dagegen durch stehen gebliebenen
zwar zum Schutz gegen Mongolen- und Tataren-
stürme.
Aus jenen Zeiten sind wenig Überreste vor-
handen, die Hauptanlagen stammen aus dem XV.
und XVI. Jahrhundert und sind zur Verteidigung
mit dem Feuergewehr eingerichtet. Die Kastelle
haben sich, wie die Geschichte lehrt, bewährt,
sie boten den Einwohnern, die sich in die weit
entfernt liegenden Städte, deren Befestigungen
ebenfalls unter dem Drucke jener Einfälle langsam
Holzkern, der jetzt gröfstenteils ausgebrochen ist,
geschlossen waren. Bei C—C befinden sich Nägel,
die Reste von Lederriemen festhalten, die über
die ganze Fläche liefen. Bei D—D sind eben-
falls Nägel und Lederreste, die dazu dienten, einen
wenige Millimeter dicken Gegenstand festzuhalten.
Wir haben es hier mit einer bäuerlichen Einrich-
tung zutun, die ein sechsläufiges Orgelgeschütz dar-
stellt. In den Rillen lagen halbe Hackenläufe,
vorne auf die Länge der Diele abgeschnitten,