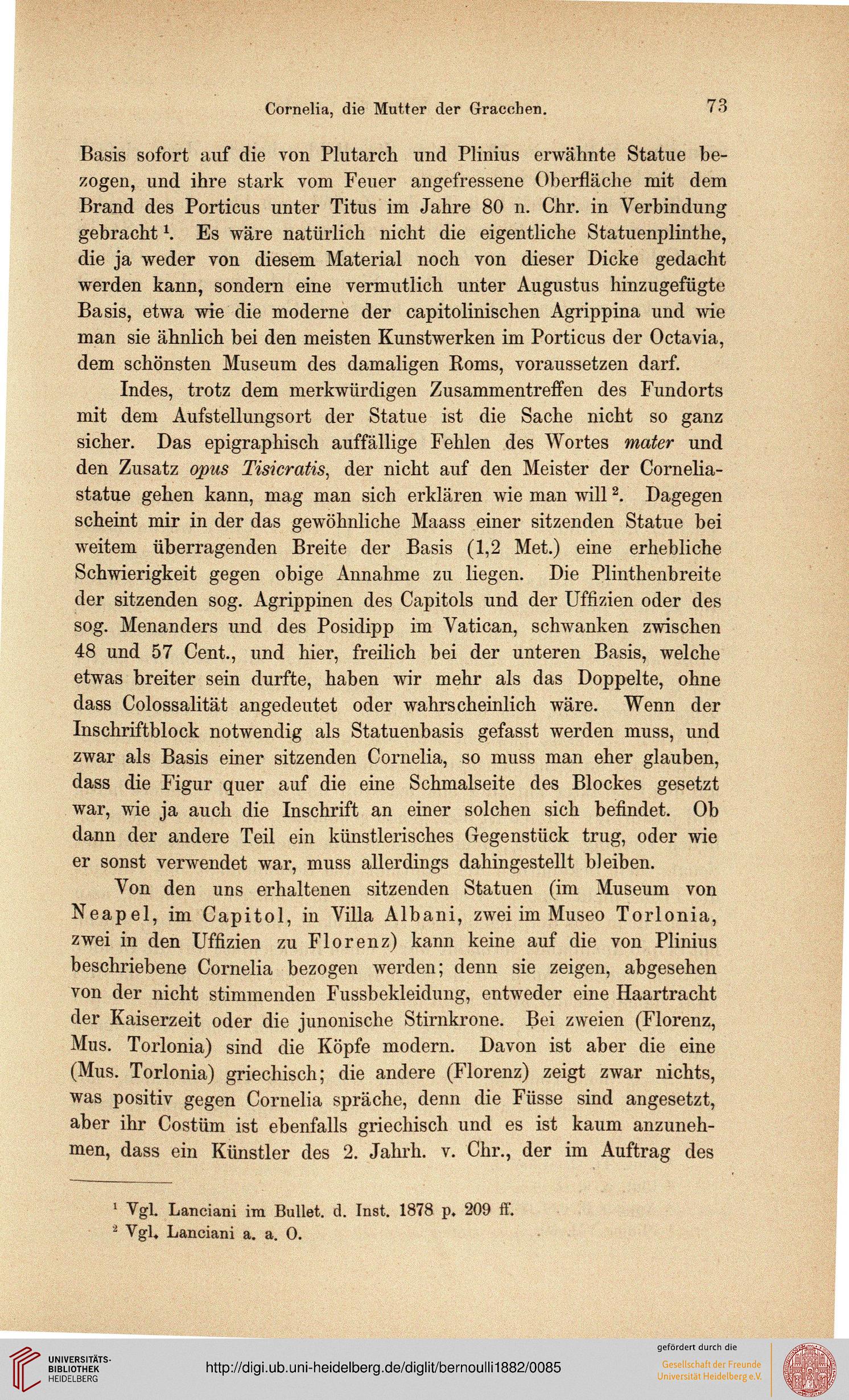Cornelia, die Mutter der Graceben.
73
Basis sofort auf die von Plutarch und Plinius erwähnte Statue be-
zogen, und ihre stark vom Feuer angefressene Oberfläche mit dem
Brand des Porticus unter Titus im Jahre 80 n. Chr. in Verbindung
gebracht *. Es wäre natürlich nicht die eigentliche Statuenplinthe,
die ja weder von diesem Material noch von dieser Dicke gedacht
werden kann, sondern eine vermutlich unter Augustus hinzugefügte
Basis, etwa wie die moderne der capitolinischen Agrippina und wie
man sie ähnlich bei den meisten Kunstwerken im Porticus der Octavia,
dem schönsten Museum des damaligen Borns, voraussetzen darf.
Indes, trotz dem merkwürdigen Zusammentreffen des Fundorts
mit dem Aufstellungsort der Statue ist die Sache nicht so ganz
sicher. Das epigraphisch auffällige Fehlen des Wortes mater und
den Zusatz opus Tisicratis, der nicht auf den Meister der Cornelia-
statue gehen kann, mag man sich erklären wie man will2. Dagegen
scheint mir in der das gewöhnliche Maass einer sitzenden Statue bei
weitem überragenden Breite der Basis (1,2 Met.) eine erhebliche
Schwierigkeit gegen obige Annahme zu liegen. Die Plinthenbreite
der sitzenden sog. Agrippinen des Capitols und der Uffizien oder des
sog. Menanders und des Posidipp im Vatican, schwanken zwischen
48 und 57 Cent., und hier, freilich bei der unteren Basis, welche
etwas breiter sein durfte, haben wir mehr als das Doppelte, ohne
dass Colossalität angedeutet oder wahrscheinlich wäre. Wenn der
Inschriftblock notwendig als Statuenbasis gefasst werden muss, und
zwar als Basis einer sitzenden Cornelia, so muss man eher glauben,
dass die Figur quer auf die eine Schmalseite des Blockes gesetzt
war, wie ja auch die Inschrift an einer solchen sich befindet. Ob
dann der andere Teil ein künstlerisches Gegenstück trug, oder wie
er sonst verwendet war, muss allerdings dahingestellt bleiben.
Von den uns erhaltenen sitzenden Statuen (im Museum von
Neapel, im Capitol, in Villa Albani, zwei im Museo Torlonia,
zwei in den Uffizien zu Florenz) kann keine auf die von Plinius
beschriebene Cornelia bezogen werden; denn sie zeigen, abgesehen
von der nicht stimmenden Fussbekleidung, entweder eine Haartracht
der Kaiserzeit oder die junonische Stirnkrone. Bei zweien (Florenz,
Mus. Torlonia) sind die Köpfe modern. Davon ist aber die eine
(Mus. Torlonia) griechisch; die andere (Florenz) zeigt zwar nichts,
was positiv gegen Cornelia spräche, denn die Füsse sind angesetzt,
aber ihr Costüm ist ebenfalls griechisch und es ist kaum anzuneh-
men, dass ein Künstler des 2. Jahrh. v. Chr., der im Auftrag des
1 Vgl. Lanciani im Bullet, d. Inst. 1878 p. 209 ff.
ä "Vgl. Lanciani a. a. 0.
73
Basis sofort auf die von Plutarch und Plinius erwähnte Statue be-
zogen, und ihre stark vom Feuer angefressene Oberfläche mit dem
Brand des Porticus unter Titus im Jahre 80 n. Chr. in Verbindung
gebracht *. Es wäre natürlich nicht die eigentliche Statuenplinthe,
die ja weder von diesem Material noch von dieser Dicke gedacht
werden kann, sondern eine vermutlich unter Augustus hinzugefügte
Basis, etwa wie die moderne der capitolinischen Agrippina und wie
man sie ähnlich bei den meisten Kunstwerken im Porticus der Octavia,
dem schönsten Museum des damaligen Borns, voraussetzen darf.
Indes, trotz dem merkwürdigen Zusammentreffen des Fundorts
mit dem Aufstellungsort der Statue ist die Sache nicht so ganz
sicher. Das epigraphisch auffällige Fehlen des Wortes mater und
den Zusatz opus Tisicratis, der nicht auf den Meister der Cornelia-
statue gehen kann, mag man sich erklären wie man will2. Dagegen
scheint mir in der das gewöhnliche Maass einer sitzenden Statue bei
weitem überragenden Breite der Basis (1,2 Met.) eine erhebliche
Schwierigkeit gegen obige Annahme zu liegen. Die Plinthenbreite
der sitzenden sog. Agrippinen des Capitols und der Uffizien oder des
sog. Menanders und des Posidipp im Vatican, schwanken zwischen
48 und 57 Cent., und hier, freilich bei der unteren Basis, welche
etwas breiter sein durfte, haben wir mehr als das Doppelte, ohne
dass Colossalität angedeutet oder wahrscheinlich wäre. Wenn der
Inschriftblock notwendig als Statuenbasis gefasst werden muss, und
zwar als Basis einer sitzenden Cornelia, so muss man eher glauben,
dass die Figur quer auf die eine Schmalseite des Blockes gesetzt
war, wie ja auch die Inschrift an einer solchen sich befindet. Ob
dann der andere Teil ein künstlerisches Gegenstück trug, oder wie
er sonst verwendet war, muss allerdings dahingestellt bleiben.
Von den uns erhaltenen sitzenden Statuen (im Museum von
Neapel, im Capitol, in Villa Albani, zwei im Museo Torlonia,
zwei in den Uffizien zu Florenz) kann keine auf die von Plinius
beschriebene Cornelia bezogen werden; denn sie zeigen, abgesehen
von der nicht stimmenden Fussbekleidung, entweder eine Haartracht
der Kaiserzeit oder die junonische Stirnkrone. Bei zweien (Florenz,
Mus. Torlonia) sind die Köpfe modern. Davon ist aber die eine
(Mus. Torlonia) griechisch; die andere (Florenz) zeigt zwar nichts,
was positiv gegen Cornelia spräche, denn die Füsse sind angesetzt,
aber ihr Costüm ist ebenfalls griechisch und es ist kaum anzuneh-
men, dass ein Künstler des 2. Jahrh. v. Chr., der im Auftrag des
1 Vgl. Lanciani im Bullet, d. Inst. 1878 p. 209 ff.
ä "Vgl. Lanciani a. a. 0.