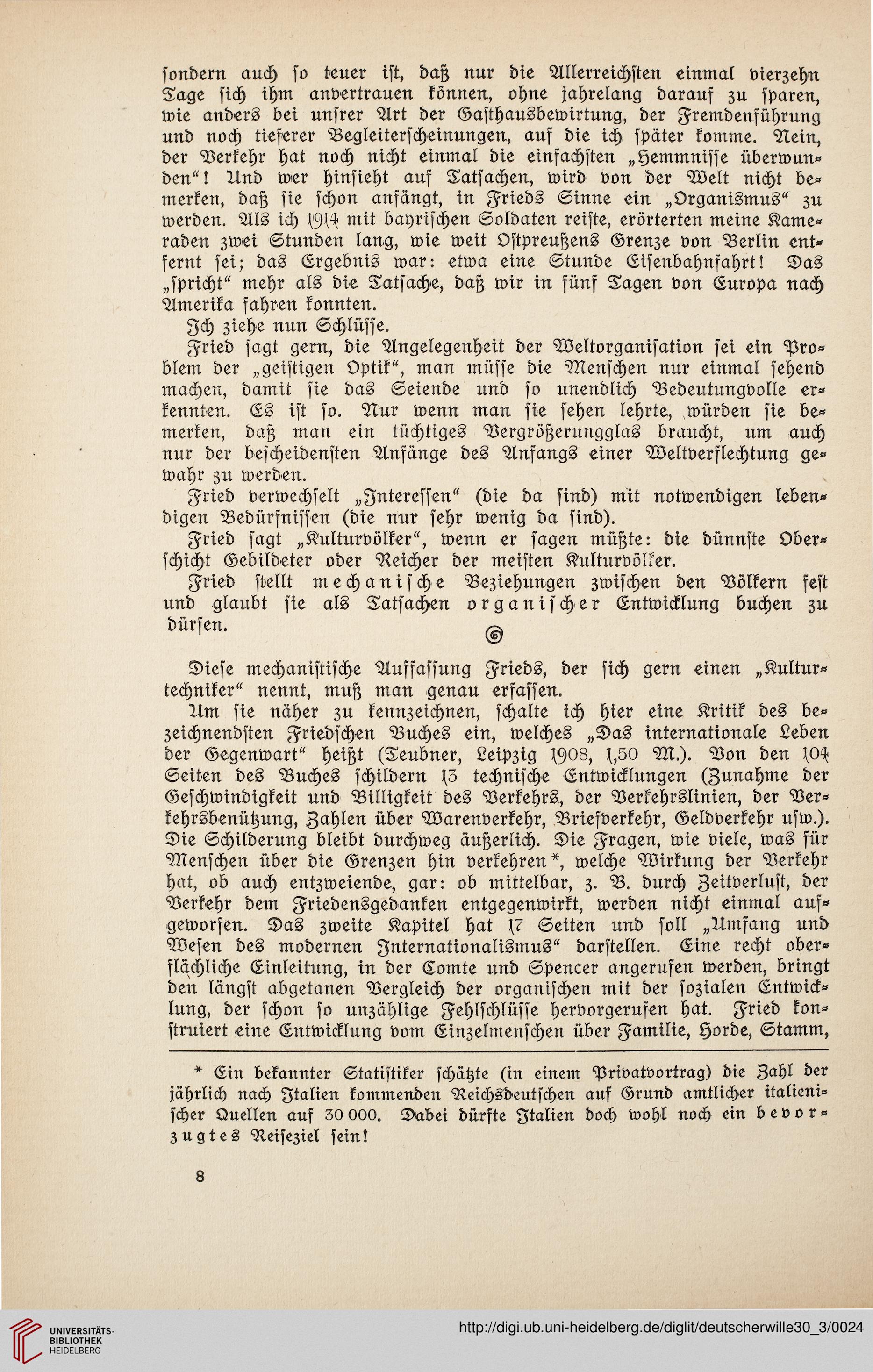sondern auch so teuer ist, daß nur die Allerreichsten einmal vierzehn
Tage sich ihm anvertrauen können, ohne jahrelang darauf zu sparen,
wie anders bei unsrer Art der Gasthausbewirtung, der Fremdenführung
und noch tieferer Begleiterscheinungen, auf die ich später komme. Bein,
der Verkehr hat noch nicht einmal die einfachsten „Hemmnisse überwun«
den"! lind wer hinsieht auf Tatsachen, wird von der Welt nicht be-
merken, daß sie schon anfängt, in Frieds Sinne ein „Organismus" zu
werden. Als ich nrit bayrischen Soldaten reiste, erörterten meine Kame»
raden zwei Stunden lang, wie weit Ostpreußens Grenze von Berlin ent»
fernt sei; das Ergebnis war: etwa eine Stunde Eisenbahnfahrt! Das
„spricht" mehr als die Tatsache, daß wir in fünf Tagen von Europa nach
Amerika fahren konnten.
Ich ziehe nun Schlüsse.
Fried sagt gern, die Angelegenheit der Weltorganisation sei ein Pro-
blem der „geistigen Optik", man müsse die Menschen nur einmal sehend
machen, damit sie das Seiende und so unendlich Bedeutungvolle er>
kennten. Ls ist so. Nur wenn man sie sehen lehrte, würden sie be-
merken, daß man ein tüchtiges Vergrößerungglas braucht, um auch
nur der bescheidensten Anfänge des Anfangs einer Weltverflechtung ge-
wahr zu werden.
Fried verwechselt „Interessen" (die da sind) mit notwendigen leben-
digen Bedürfnissen (die nur sehr wenig da sind).
Fried sagt „Kulturvölker", wenn er sagen müßte: die dünnste Ober-
schicht Gebildeter oder Reicher der meisten Kulturvölker.
Fried stellt mechanische Beziehungen zwischen den Völkern fest
und glaubt sie als Tatsachen organischer (Lntwicklung buchen zu
dürfen. ^
Diese mechanistische Auffassung Frieds, der sich gern einen „Kultur-
techniker" nennt, muß man genau erfassen.
Um sie näher zu kennzeichnen, schalte ich hier eine Kritik des be-
zeichnendsten Friedschen Buches ein, welches „Das internationale Leben
der Gegenwart" heißt (Teubner, Leipzig (908, (,50 M.). Von den (0^
Seiten des Buches schildern (3 technische Lntwicklungen (Zunahme der
Geschwindigkeit und Billigkeit des Verkehrs, der Verkehrslinien, der Ver-
kehrsbenützung, Zahlen über Warenverkehr, Briefverkehr, Geldverkehr usw.).
Die Schilderung bleibt durchweg äußerlich. Die Fragen, wie viele, was für
Menschen über die Grenzen hin verkehren*, welche Wirkung der Verkehr
hat, ob auch entzweiende, gar: ob mittelbar, z. B. durch Zeitverlust, der
Verkehr dem Friedensgedanken entgegenwirkt, werden nicht einmal auf-
geworsen. Das zweite Kapitel hat (7 Seiten und soll „Umfang und
Wesen des modernen Internationalismus" darstellen. Eine recht ober-
flächliche Linleitung, in der Comte und Spencer angerufen werden, bringt
den längst abgetanen Vergleich der organrschen mit der sozialen Entwick-
lung, der schon so unzählige Fehlschlüsse hervorgerufen hat. Fried kon-
struiert eine Entwicklung vom Einzelmenschen über Familie, tzorde, Stamm,
^ Ein bekannter Statistiker schätzte (in einem Privatvortrag) die Zahl der
jährlich nach Italien kommenden Reichsdeutschen auf Grund amtlicher italieni-
scher Ouellen auf 30 000. Dabei dürfte Italien doch wohl noch ein bevor»
zugtes Reiseziel sein!
8
Tage sich ihm anvertrauen können, ohne jahrelang darauf zu sparen,
wie anders bei unsrer Art der Gasthausbewirtung, der Fremdenführung
und noch tieferer Begleiterscheinungen, auf die ich später komme. Bein,
der Verkehr hat noch nicht einmal die einfachsten „Hemmnisse überwun«
den"! lind wer hinsieht auf Tatsachen, wird von der Welt nicht be-
merken, daß sie schon anfängt, in Frieds Sinne ein „Organismus" zu
werden. Als ich nrit bayrischen Soldaten reiste, erörterten meine Kame»
raden zwei Stunden lang, wie weit Ostpreußens Grenze von Berlin ent»
fernt sei; das Ergebnis war: etwa eine Stunde Eisenbahnfahrt! Das
„spricht" mehr als die Tatsache, daß wir in fünf Tagen von Europa nach
Amerika fahren konnten.
Ich ziehe nun Schlüsse.
Fried sagt gern, die Angelegenheit der Weltorganisation sei ein Pro-
blem der „geistigen Optik", man müsse die Menschen nur einmal sehend
machen, damit sie das Seiende und so unendlich Bedeutungvolle er>
kennten. Ls ist so. Nur wenn man sie sehen lehrte, würden sie be-
merken, daß man ein tüchtiges Vergrößerungglas braucht, um auch
nur der bescheidensten Anfänge des Anfangs einer Weltverflechtung ge-
wahr zu werden.
Fried verwechselt „Interessen" (die da sind) mit notwendigen leben-
digen Bedürfnissen (die nur sehr wenig da sind).
Fried sagt „Kulturvölker", wenn er sagen müßte: die dünnste Ober-
schicht Gebildeter oder Reicher der meisten Kulturvölker.
Fried stellt mechanische Beziehungen zwischen den Völkern fest
und glaubt sie als Tatsachen organischer (Lntwicklung buchen zu
dürfen. ^
Diese mechanistische Auffassung Frieds, der sich gern einen „Kultur-
techniker" nennt, muß man genau erfassen.
Um sie näher zu kennzeichnen, schalte ich hier eine Kritik des be-
zeichnendsten Friedschen Buches ein, welches „Das internationale Leben
der Gegenwart" heißt (Teubner, Leipzig (908, (,50 M.). Von den (0^
Seiten des Buches schildern (3 technische Lntwicklungen (Zunahme der
Geschwindigkeit und Billigkeit des Verkehrs, der Verkehrslinien, der Ver-
kehrsbenützung, Zahlen über Warenverkehr, Briefverkehr, Geldverkehr usw.).
Die Schilderung bleibt durchweg äußerlich. Die Fragen, wie viele, was für
Menschen über die Grenzen hin verkehren*, welche Wirkung der Verkehr
hat, ob auch entzweiende, gar: ob mittelbar, z. B. durch Zeitverlust, der
Verkehr dem Friedensgedanken entgegenwirkt, werden nicht einmal auf-
geworsen. Das zweite Kapitel hat (7 Seiten und soll „Umfang und
Wesen des modernen Internationalismus" darstellen. Eine recht ober-
flächliche Linleitung, in der Comte und Spencer angerufen werden, bringt
den längst abgetanen Vergleich der organrschen mit der sozialen Entwick-
lung, der schon so unzählige Fehlschlüsse hervorgerufen hat. Fried kon-
struiert eine Entwicklung vom Einzelmenschen über Familie, tzorde, Stamm,
^ Ein bekannter Statistiker schätzte (in einem Privatvortrag) die Zahl der
jährlich nach Italien kommenden Reichsdeutschen auf Grund amtlicher italieni-
scher Ouellen auf 30 000. Dabei dürfte Italien doch wohl noch ein bevor»
zugtes Reiseziel sein!
8