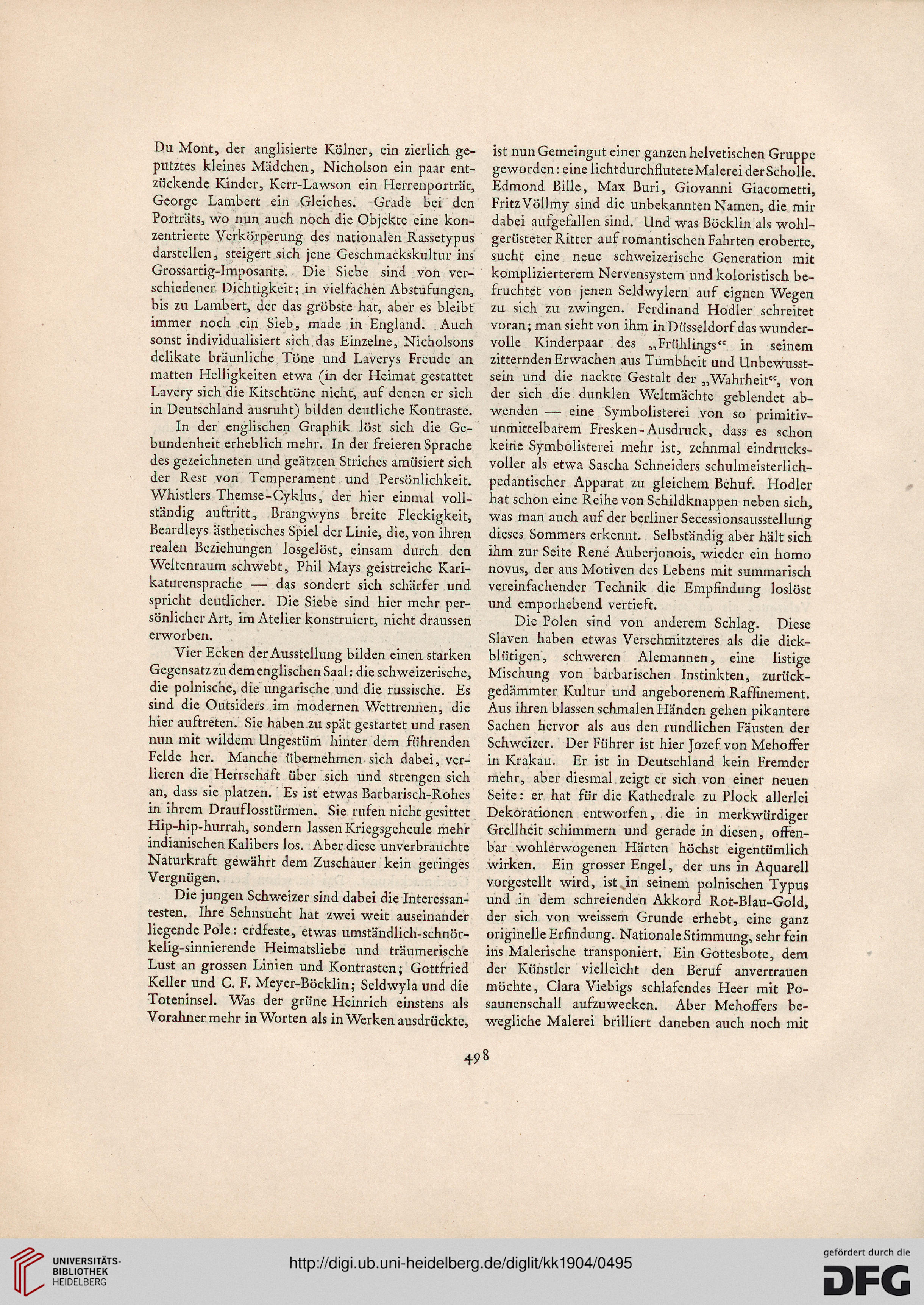Du Mont, der anglisierte Kölner, ein zierlich ge-
putztes kleines Mädchen, Nicholson ein paar ent-
zückende Kinder, Kerr-Lawson ein Herrenporträt,
George Lambert ein Gleiches. Grade bei den
Porträts, wo nun auch noch die Objekte eine kon-
zentrierte Verkörperung des nationalen Rassetypus
darstellen, steigert sich jene Geschmackskultur ins'
Grossartig-Imposante. Die Siebe sind von ver-
schiedener Dichtigkeit; in vielfachen Abstufungen,
bis zu Lambert, der das gröbste hat, aber es bleibt
immer noch ein Sieb, made in England. Auch
sonst individualisiert sich das Einzelne, Nicholsons
delikate bräunliche Töne und Laverys Freude an
matten Helligkeiten etwa (in der Heimat gestattet
Lavery sich die Kitschtöne nicht, auf denen er sich
in Deutschland ausruht) bilden deutliche Kontraste.
In der englischen Graphik löst sich die Ge-
bundenheit erheblich mehr. In der freieren Sprache
des gezeichneten und geätzten Striches amüsiert sich
der Rest von Temperament und Persönlichkeit.
Whistlers Themse-Cyklus, der hier einmal voll-
ständig auftritt, Brangwyns breite Fleckigkeit,
Beardleys ästhetisches Spiel der Linie, die, von ihren
realen Beziehungen losgelöst, einsam durch den
Weltenraum schwebt, Phil Mays geistreiche Kari-
katurensprache — das sondert sich schärfer und
spricht deutlicher. Die Siebe sind hier mehr per-
sönlicher Art, im Atelier konstruiert, nicht draussen
erworben.
Vier Ecken der Ausstellung bilden einen starken
Gegensatz zu dem englischen Saal: die schweizerische,
die polnische, die ungarische und die russische. Es
sind die Outsiders im modernen Wettrennen, die
hier auftreten. Sie haben zu spät gestartet und rasen
nun mit wildem Ungestüm hinter dem führenden
Felde her. Manche übernehmen sich dabei, ver-
lieren die Herrschaft über sich und strengen sich
an, dass sie platzen. Es ist etwas Barbarisch-Rohes
in ihrem Drauflosstürmen. Sie rufen nicht gesittet
Hip-hip-hurrah, sondern lassen Kriegsgeheule mehr
indianischen Kalibers los. Aber diese unverbrauchte
Naturkraft gewährt dem Zuschauer kein geringes
Vergnügen.
Die jungen Schweizer sind dabei die Interessan-
testen. Ihre Sehnsucht hat zwei weit auseinander
liegende Pole: erdfeste, etwas umständlich-schnür-
kelig-sinnierende Heimatsliebe und träumerische
Lust an grossen Linien und Kontrasten; Gottfried
Keller und C. F. Meyer-Böcklin; Seldwyla und die
Toteninsel. Was der grüne Heinrich einstens als
Vorahner mehr in Worten als in Werken ausdrückte,
ist nun Gemeingut einer ganzen helvetischen Gruppe
geworden: eine lichtdurchflutete Malerei der Scholle.
Edmond Bille, Max Buri, Giovanni Giacometti,
Fritz Völlmy sind die unbekannten Namen, die mir
dabei aufgefallen sind. Und was Böcklin als wohl-
gerüsteter Ritter auf romantischen Fahrten eroberte,
sucht eine neue schweizerische Generation mit
komplizierterem Nervensystem und koloristisch be-
fruchtet von jenen Seldwylern auf eignen Wegen
zu sich zu zwingen. Ferdinand Hodler schreitet
voran; man sieht von ihm inDüsseldorf das wunder-
volle Kinderpaar des „Frühlings" in seinem
zitternden Erwachen aus Tumbheit und Unbewusst-
sein und die nackte Gestalt der „Wahrheit", von
der sich die dunklen Weltmächte geblendet ab-
wenden — eine Symbolisterei von so primitiv-
unmittelbarem Fresken-Ausdruck, dass es schon
keine Symbolisterei mehr ist, zehnmal eindrucks-
voller als etwa Sascha Schneiders schulmeisterlich-
pedantischer Apparat zu gleichem Behuf. Hodler
hat schon eine Reihe von Schildknappen neben sich,
was man auch auf der berliner Secessionsausstellung
dieses Sommers erkennt. Selbständig aber hält sich
ihm zur Seite Rene Auberjonois, wieder ein homo
novus, der aus Motiven des Lebens mit summarisch
vereinfachender Technik die Empfindung loslöst
und emporhebend vertieft.
Die Polen sind von anderem Schlag. Diese
Slaven haben etwas Verschmitzteres als die dick-
blütigen, schweren Alemannen, eine listige
Mischung von barbarischen Instinkten, zurück-
gedämmter Kultur und angeborenem Raffinement.
Aus ihren blassen schmalen Händen gehen pikantere
Sachen hervor als aus den rundlichen Fäusten der
Schweizer. Der Führer ist hier Jozef von Mehoffer
in Krakau. Er ist in Deutschland kein Fremder
mehr, aber diesmal zeigt er sich von einer neuen
Seite: er hat für die Kathedrale zu Plock allerlei
Dekorationen entworfen, die in merkwürdiger
Grellheit schimmern und gerade in diesen, offen-
bar wohlerwogenen Härten höchst eigentümlich
wirken. Ein grosser Engel, der uns in Aquarell
vorgestellt wird, ist „in seinem polnischen Typus
und in dem schreienden Akkord Rot-Blau-Gold,
der sich von weissem Grunde erhebt, eine ganz
originelle Erfindung. Nationale Stimmung, sehr fein
ins Malerische transponiert. Ein Gottesbote, dem
der Künstler vielleicht den Beruf anvertrauen
möchte, Clara Viebigs schlafendes Heer mit Po-
saunenschall aufzuwecken. Aber Mehoffers be-
wegliche Malerei brilliert daneben auch noch mit
498
putztes kleines Mädchen, Nicholson ein paar ent-
zückende Kinder, Kerr-Lawson ein Herrenporträt,
George Lambert ein Gleiches. Grade bei den
Porträts, wo nun auch noch die Objekte eine kon-
zentrierte Verkörperung des nationalen Rassetypus
darstellen, steigert sich jene Geschmackskultur ins'
Grossartig-Imposante. Die Siebe sind von ver-
schiedener Dichtigkeit; in vielfachen Abstufungen,
bis zu Lambert, der das gröbste hat, aber es bleibt
immer noch ein Sieb, made in England. Auch
sonst individualisiert sich das Einzelne, Nicholsons
delikate bräunliche Töne und Laverys Freude an
matten Helligkeiten etwa (in der Heimat gestattet
Lavery sich die Kitschtöne nicht, auf denen er sich
in Deutschland ausruht) bilden deutliche Kontraste.
In der englischen Graphik löst sich die Ge-
bundenheit erheblich mehr. In der freieren Sprache
des gezeichneten und geätzten Striches amüsiert sich
der Rest von Temperament und Persönlichkeit.
Whistlers Themse-Cyklus, der hier einmal voll-
ständig auftritt, Brangwyns breite Fleckigkeit,
Beardleys ästhetisches Spiel der Linie, die, von ihren
realen Beziehungen losgelöst, einsam durch den
Weltenraum schwebt, Phil Mays geistreiche Kari-
katurensprache — das sondert sich schärfer und
spricht deutlicher. Die Siebe sind hier mehr per-
sönlicher Art, im Atelier konstruiert, nicht draussen
erworben.
Vier Ecken der Ausstellung bilden einen starken
Gegensatz zu dem englischen Saal: die schweizerische,
die polnische, die ungarische und die russische. Es
sind die Outsiders im modernen Wettrennen, die
hier auftreten. Sie haben zu spät gestartet und rasen
nun mit wildem Ungestüm hinter dem führenden
Felde her. Manche übernehmen sich dabei, ver-
lieren die Herrschaft über sich und strengen sich
an, dass sie platzen. Es ist etwas Barbarisch-Rohes
in ihrem Drauflosstürmen. Sie rufen nicht gesittet
Hip-hip-hurrah, sondern lassen Kriegsgeheule mehr
indianischen Kalibers los. Aber diese unverbrauchte
Naturkraft gewährt dem Zuschauer kein geringes
Vergnügen.
Die jungen Schweizer sind dabei die Interessan-
testen. Ihre Sehnsucht hat zwei weit auseinander
liegende Pole: erdfeste, etwas umständlich-schnür-
kelig-sinnierende Heimatsliebe und träumerische
Lust an grossen Linien und Kontrasten; Gottfried
Keller und C. F. Meyer-Böcklin; Seldwyla und die
Toteninsel. Was der grüne Heinrich einstens als
Vorahner mehr in Worten als in Werken ausdrückte,
ist nun Gemeingut einer ganzen helvetischen Gruppe
geworden: eine lichtdurchflutete Malerei der Scholle.
Edmond Bille, Max Buri, Giovanni Giacometti,
Fritz Völlmy sind die unbekannten Namen, die mir
dabei aufgefallen sind. Und was Böcklin als wohl-
gerüsteter Ritter auf romantischen Fahrten eroberte,
sucht eine neue schweizerische Generation mit
komplizierterem Nervensystem und koloristisch be-
fruchtet von jenen Seldwylern auf eignen Wegen
zu sich zu zwingen. Ferdinand Hodler schreitet
voran; man sieht von ihm inDüsseldorf das wunder-
volle Kinderpaar des „Frühlings" in seinem
zitternden Erwachen aus Tumbheit und Unbewusst-
sein und die nackte Gestalt der „Wahrheit", von
der sich die dunklen Weltmächte geblendet ab-
wenden — eine Symbolisterei von so primitiv-
unmittelbarem Fresken-Ausdruck, dass es schon
keine Symbolisterei mehr ist, zehnmal eindrucks-
voller als etwa Sascha Schneiders schulmeisterlich-
pedantischer Apparat zu gleichem Behuf. Hodler
hat schon eine Reihe von Schildknappen neben sich,
was man auch auf der berliner Secessionsausstellung
dieses Sommers erkennt. Selbständig aber hält sich
ihm zur Seite Rene Auberjonois, wieder ein homo
novus, der aus Motiven des Lebens mit summarisch
vereinfachender Technik die Empfindung loslöst
und emporhebend vertieft.
Die Polen sind von anderem Schlag. Diese
Slaven haben etwas Verschmitzteres als die dick-
blütigen, schweren Alemannen, eine listige
Mischung von barbarischen Instinkten, zurück-
gedämmter Kultur und angeborenem Raffinement.
Aus ihren blassen schmalen Händen gehen pikantere
Sachen hervor als aus den rundlichen Fäusten der
Schweizer. Der Führer ist hier Jozef von Mehoffer
in Krakau. Er ist in Deutschland kein Fremder
mehr, aber diesmal zeigt er sich von einer neuen
Seite: er hat für die Kathedrale zu Plock allerlei
Dekorationen entworfen, die in merkwürdiger
Grellheit schimmern und gerade in diesen, offen-
bar wohlerwogenen Härten höchst eigentümlich
wirken. Ein grosser Engel, der uns in Aquarell
vorgestellt wird, ist „in seinem polnischen Typus
und in dem schreienden Akkord Rot-Blau-Gold,
der sich von weissem Grunde erhebt, eine ganz
originelle Erfindung. Nationale Stimmung, sehr fein
ins Malerische transponiert. Ein Gottesbote, dem
der Künstler vielleicht den Beruf anvertrauen
möchte, Clara Viebigs schlafendes Heer mit Po-
saunenschall aufzuwecken. Aber Mehoffers be-
wegliche Malerei brilliert daneben auch noch mit
498