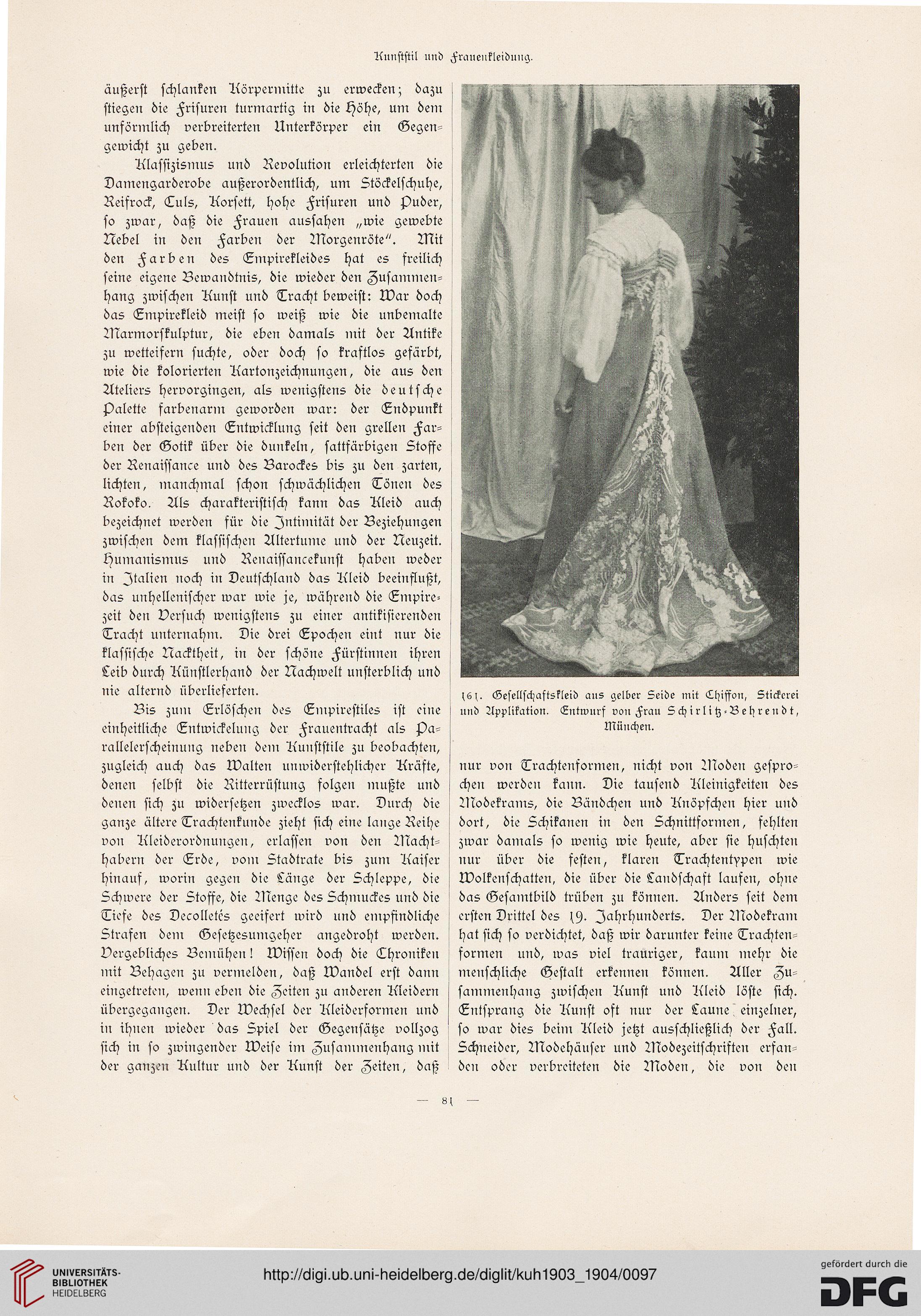Aunststil und Frcmeukleiduug.
äußerst schlanken Körpermitte zu erwecken; dazu
stiegen die Frisuren turmartig in die k)öhe, um dem
unförmlich verbreiterten Unterkörper ein Gegen-
gewicht zu geben.
Klassizismus und Revolution erleichterten die
Damengarderobe außerordentlich, um Stöckelschuhe,
Reisrock, Euls, Korsett, hohe Frisuren und Puder,
so zwar, daß die grauen aussahen „wie gewebte
Nebel in den Farben der Morgenröte". Mit
den Farben des Empirekleides hat es freilich
seine eigene Bewandtnis, die wieder den Zusammen-
hang zwischen Kunst und Tracht beweist: War doch
das Empirekleid meist so weiß wie die unbemalte
Marmorskulptur, die eben damals mit der Antike
zu wetteifern suchte, oder doch so kraftlos gefärbt,
wie die kolorierten Kartonzeichnungen, die aus den
Ateliers hervorgingen, als wenigstens die deutsche
Palette farbenarin geworden war: der Endpunkt
einer absteigenden Entwicklung seit den grellen Far-
ben der Gotik über die dunkeln, sattsärbigen Stoffe
der Renaissance und des Barockes bis zu den zarten,
lichten, manchmal schon schwächlichen Tönen des
Rokoko. Als charakteristisch kann das Kleid auch
bezeichnet werden für die Intimität der Beziehungen
zwischen dem klassischen Altertums und der Neuzeit.
Humanismus und Rcnaiffancekunst haben weder
in Italien noch in Deutschland das Kleid beeinflußt,
das unhellenischer war wie je, während die Empire-
zeit den Versuch wenigstens zu einer antikisierenden
Tracht unternahm. Die drei Epochen eint nur dis
klassische Nacktheit, in der schöne Fürstinnen ihren
Leib durch Künstlerhand der Nachwelt unsterblich und
nie alternd überlieferten.
Bis zum Erlöschen des Empirestiles ist eine
einheitliche Entwickelung der Frauentracht als Pa-
rallelerscheinung neben dem Kunststile zu beobachten,
zugleich auch das Walten unwiderstehlicher Kräfte,
denen selbst die Ritterrüstung folgen mußte und
denen sich zu widersetzen zwecklos war. Durch die
ganze ältere Trachtenkunde zieht sich eine lange Reihe
von Kleiderordnungen, erlassen von den Macht-
habern der Erde, vom Stadtrate bis zum Kaiser
hinauf, worin gegen die Länge der Schleppe, die
Schwere der Stoffe, die Menge des Schmuckes und die
Tiefe des Decolletes geeifert wird und empfindliche
Strafen dem Gesetzesumgeher angedroht werden.
Vergebliches Bemühen! Wissen doch die Ehronike»
mit Behagen zu vermelden, daß Wandel erst dann
eingetreten, wenn eben die Zeiten zu anderen Kleidern
übergegangen. Der Wechsel der Kleiderformen und
in ihnen wieder das Spiel der Gegensätze vollzog
sich in so zwingender Weise im Zusammenhang mit
der ganzen Kultur und der Kunst der Zeiten, daß
ZS;. Gesellschaftskleid aus gelber Seide mit Ehiffon, Stickerei
und Applikation. Entwurf von Frau Schirlitz-Behrendt,
München.
nur von Trachtenformen, nicht von Blöden gespro-
chen werden kann. Die tausend Kleinigkeiten des
Modekrams, die Bändchen und Knöpfchen hier und
dort, die Schikanen in den Schnittformen, fehlten
zwar damals so wenig wie heute, aber sie huschten
nur über die festen, klaren Trachtentypen wie
Wolkenschatten, die über die Landschaft laufeil, ohne
das Gesanltbild trüben zu können. Anders feit dem
ersten Drittel des fst. Jahrhunderts. Der Modekranr
hat sich so verdichtet, daß wir darunter keine Trachten-
formen und, was viel trauriger, kaum mehr die
lnenschliche Gestalt erkennen können. Aller Zu
sammenhang zwischen Kunst und Kleid löste sich.
Entsprang die Kunst oft nur der Laune einzelner,
so war dies beinr Kleid jetzt ausschließlich der Fall.
Schileider, Modehäuser llnd Modezeitschristeil erfan-
den oder verbreiteten die Moden, die von den
äußerst schlanken Körpermitte zu erwecken; dazu
stiegen die Frisuren turmartig in die k)öhe, um dem
unförmlich verbreiterten Unterkörper ein Gegen-
gewicht zu geben.
Klassizismus und Revolution erleichterten die
Damengarderobe außerordentlich, um Stöckelschuhe,
Reisrock, Euls, Korsett, hohe Frisuren und Puder,
so zwar, daß die grauen aussahen „wie gewebte
Nebel in den Farben der Morgenröte". Mit
den Farben des Empirekleides hat es freilich
seine eigene Bewandtnis, die wieder den Zusammen-
hang zwischen Kunst und Tracht beweist: War doch
das Empirekleid meist so weiß wie die unbemalte
Marmorskulptur, die eben damals mit der Antike
zu wetteifern suchte, oder doch so kraftlos gefärbt,
wie die kolorierten Kartonzeichnungen, die aus den
Ateliers hervorgingen, als wenigstens die deutsche
Palette farbenarin geworden war: der Endpunkt
einer absteigenden Entwicklung seit den grellen Far-
ben der Gotik über die dunkeln, sattsärbigen Stoffe
der Renaissance und des Barockes bis zu den zarten,
lichten, manchmal schon schwächlichen Tönen des
Rokoko. Als charakteristisch kann das Kleid auch
bezeichnet werden für die Intimität der Beziehungen
zwischen dem klassischen Altertums und der Neuzeit.
Humanismus und Rcnaiffancekunst haben weder
in Italien noch in Deutschland das Kleid beeinflußt,
das unhellenischer war wie je, während die Empire-
zeit den Versuch wenigstens zu einer antikisierenden
Tracht unternahm. Die drei Epochen eint nur dis
klassische Nacktheit, in der schöne Fürstinnen ihren
Leib durch Künstlerhand der Nachwelt unsterblich und
nie alternd überlieferten.
Bis zum Erlöschen des Empirestiles ist eine
einheitliche Entwickelung der Frauentracht als Pa-
rallelerscheinung neben dem Kunststile zu beobachten,
zugleich auch das Walten unwiderstehlicher Kräfte,
denen selbst die Ritterrüstung folgen mußte und
denen sich zu widersetzen zwecklos war. Durch die
ganze ältere Trachtenkunde zieht sich eine lange Reihe
von Kleiderordnungen, erlassen von den Macht-
habern der Erde, vom Stadtrate bis zum Kaiser
hinauf, worin gegen die Länge der Schleppe, die
Schwere der Stoffe, die Menge des Schmuckes und die
Tiefe des Decolletes geeifert wird und empfindliche
Strafen dem Gesetzesumgeher angedroht werden.
Vergebliches Bemühen! Wissen doch die Ehronike»
mit Behagen zu vermelden, daß Wandel erst dann
eingetreten, wenn eben die Zeiten zu anderen Kleidern
übergegangen. Der Wechsel der Kleiderformen und
in ihnen wieder das Spiel der Gegensätze vollzog
sich in so zwingender Weise im Zusammenhang mit
der ganzen Kultur und der Kunst der Zeiten, daß
ZS;. Gesellschaftskleid aus gelber Seide mit Ehiffon, Stickerei
und Applikation. Entwurf von Frau Schirlitz-Behrendt,
München.
nur von Trachtenformen, nicht von Blöden gespro-
chen werden kann. Die tausend Kleinigkeiten des
Modekrams, die Bändchen und Knöpfchen hier und
dort, die Schikanen in den Schnittformen, fehlten
zwar damals so wenig wie heute, aber sie huschten
nur über die festen, klaren Trachtentypen wie
Wolkenschatten, die über die Landschaft laufeil, ohne
das Gesanltbild trüben zu können. Anders feit dem
ersten Drittel des fst. Jahrhunderts. Der Modekranr
hat sich so verdichtet, daß wir darunter keine Trachten-
formen und, was viel trauriger, kaum mehr die
lnenschliche Gestalt erkennen können. Aller Zu
sammenhang zwischen Kunst und Kleid löste sich.
Entsprang die Kunst oft nur der Laune einzelner,
so war dies beinr Kleid jetzt ausschließlich der Fall.
Schileider, Modehäuser llnd Modezeitschristeil erfan-
den oder verbreiteten die Moden, die von den