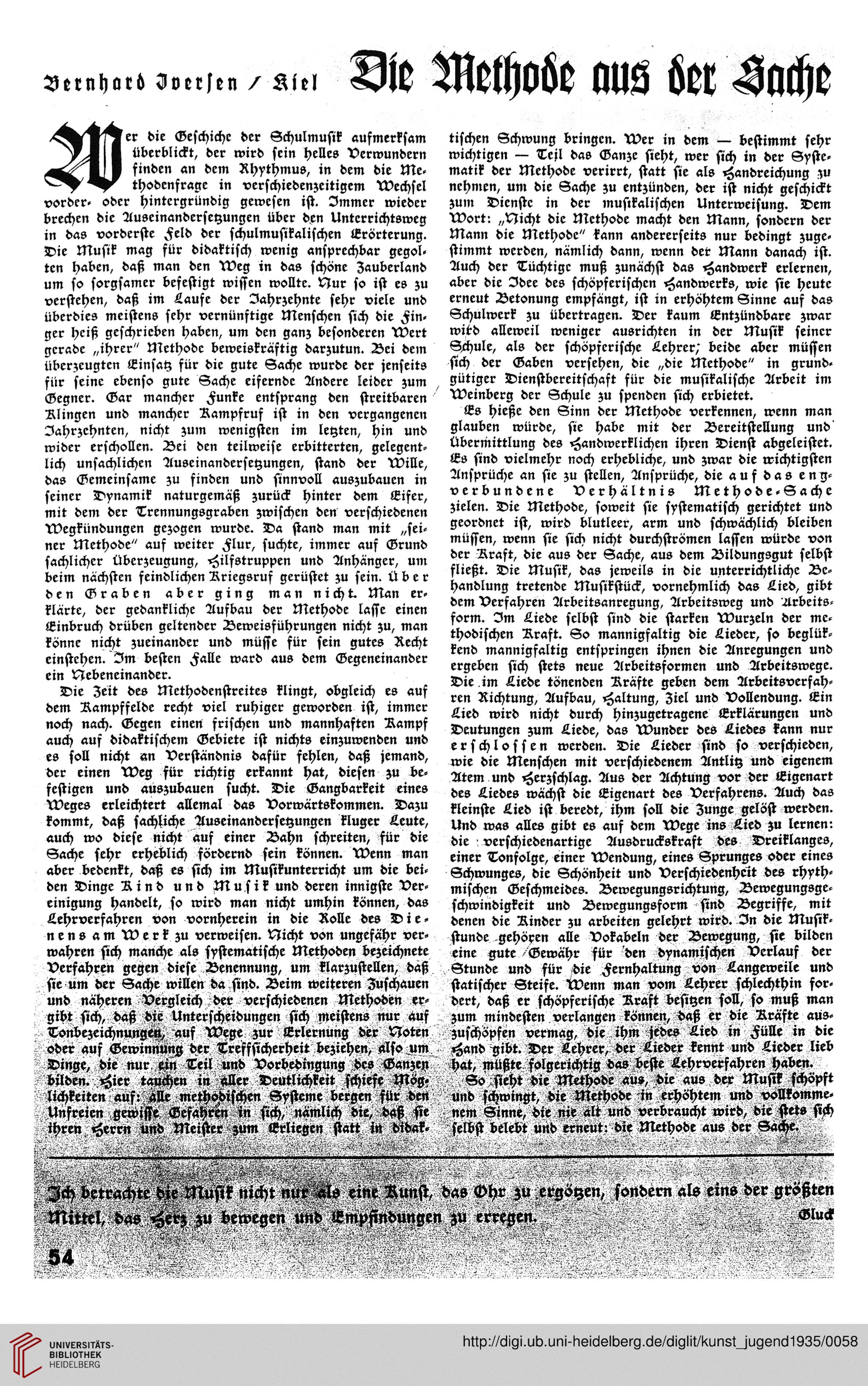Vernharö Iversen / Siel
>le MthoSe aus Ser Lache
ser die Geschichc der Schulmusik aufmerksam
iiberblickt, der wird scin hellcs Vcrwundern
sinden an dcm Rhythmus, in dem die Me.
thodcnfragc in verschiedenzeitiAem wechsel
vordcr- oder hintergründig gewcsen ist. Jmmer wicdcr
brechen dic Auseinandcrsetzungen über den Untcrrichtsweg
in das vorderste Feld der schulmusikalischen Erörterung.
Die Musik mag für didaktisch weni§ ansprechbar yegol.
ten haben, daß man den weg in das schöne Zauberland
um so sorgsamer befestigt wiffen wollte. Nur so ist es ;u
verstehen, daß im Laufe der Iahrzehnte sehr viele und
überdies meistens sehr vernünftige Menschen sich die Fin.
ger heiß geschrieben haben, um den ganz besonderen wert
gcrade „ihrer" Methode beweiskräftig darzutun. Bei dem
übcrzeugtcn Einsatz für dic gute Sache wurde der jenseits
für seine ebenso gute Sache eifernde Andere leider zum
Gegner. Gar mancher Funke entsprang den streitbaren
Rlingen und mancher Rampfruf ist in den vcrgangenen
Iahrzchnten, nicht zum wenigsten im letzten, hin und
wider crschollen. Bei den teilweise erbitterten, gelegent-
lich unsachlichen Auseinandersetzungen, stand der wille,
das Gemcinsame ;u finden und sinnvoll auszubauen in
seiner Dynamik naturgemäß zurück hinter dem Eifer,
mit dem der Trennungsgraben zwischen den verschiedenen
Wegkündungen gezogen wurde. Da stand man mit „sei-
ner Methode" auf weiter Flur, suchte, immer auf Grund
sachlichcr llberzeugung, Hilfstruppen und Anhänger, um
beim nächstcn feindlichen Rriegsruf gerüstet ;u sein. Über
den Graben aber ging man nicht. Man er-
klärtc, der gedanklichc Aufbau der Methode laffe einen
Einbruch drüben geltender Beweisführungen nicht ;u, man
könnc nicht zueinander und müffe für sein gutcs Recht
einstchen. 2m besten Falle ward aus dem Gegeneinander
ein Nebeneinander.
Die Zeit des Methodenstreites klingt, obgleich es auf
dem Rampffelde recht viel ruhiger geworden ist, immcr
noch nach. Gegen eineN frischen und mannhaftcn Rampf
auch auf didaktischem Gebiete ist nichts einzuwenden und
es soll nicht an Verständnis dafür fehlen, daß jemand,
der einen weg für richtig erkannt hat, diesen ;u be-
festigen und auszubauen sucht. Die Gangbarkeit eines
weges erleichtert allemal das Vorwärtskommen. Dazu
kommt, daß fachliche Auseinandersetzungen kluger Leute,
auch wo diese nicht auf einer Bahn schreiten, für die
Sache sehr erheblich fördernd sein können. wenn man
aber bedenkt, daß es sich im Musikunterricht um die bei-
den Dinge Rind und Musik und deren innigste Ver-
einigung handelt, so wird man nicht umhin können, das
Lehrverfahren von vornherein in die Rolle des Die-
nensamwerkzu verweisen. Nicht von ungefähr ver-
wahren sich manche als systematische Methoden bezeichncte
Verfahren gegen diese Benennung, um klarzustellen, daß
sie um der Sache willen da sind. Beim weiteren Zuschauen
und näheren Vergleich der verschicdenen Methoden er-
gibt sich, daß die Unterscheidungen sich meistens nur auf
Tonbezcichnungen, auf wege zur Lrlernung der Noten
oder auf Gewinnung der Treffsicherheit beziehen, also,um
Dinge, die nur ein Teil und Vorbedingung des Ganzen
bilden. Hier tauche» in Mer Deutlichkeit schiese Mög.
lichkeiten auf: alle methodischen Systeme bergen für den
Unfreien gewiffe Gefahren in sich, nämlich die, daß sie
jhren Herrn und Meister zum Erlietzen statt in didak-
tischen Schwung bringcn. wer in dem — bestimmt sehr
wichtigen — Tejl das Ganze sieht, wer sich in der Syste-
matik der Methode verirrt, ftatt sie als Handreichung zu
nchmen, un> die Sache ;u entzünden, der ist nicht geschickt
zum Dicnstc in der musikalischen Unterweisung. Dem
wort: „Vkicht dic Methode macht den Mann, sondern der
Mann die Methodc" kann andererseits nur bedingt zuge-
stimmt werden, nämlich dann, wenn der Mann danach ist.
Auch dcr Tüchtigc muß zunächst das Handwerk erlernen,
aber die 2dee des schöpferischcn Handwerks, wie sie heute
erneut Betonung empfängt, ist in erhöhtem Sinne auf das
Schulwerk zu übertragen. Der kaum Entzündbare zwar
wibd alleweil weniger ausrichten in der Musik seincr
Schulc, als der schöpfcrische Lehrer,' beide aber müffen
sich der Gaben versehen, die „die Methode" in grund-
gütiger Dienstbereitschaft für die musikalische Arbeit im
weinberg der Schule zu spenden sich erbietet.
Es hieße den Sinn der Mcthode verkennen, wenn man
glauben würde, sie habe mit der Bereitstellung und
Übermittlung des Handwerklichen ihren Dienst abgeleistet.
Es sind vielmehr noch erhebliche, und zwar die wichtigsten
Ansprüche an sie ;u stellen, Ansprüche, die auf das eng-
verbundene Verhältnis Methode-Sachc
zielen. Die Methode, soweit sie systematisch gerichtet und
geordnet ist, wird blutleer, arm und schwächlich bleiben
müffen, wenn sie sich nicht durchströmen laffen würde von
der Rraft, die aus der Sache, aus dem Bildungsgut selbst
fließt. Die Musik, das jeweils in die unterrichtlichc Bc°
handlung tretcnde Musikstück, vornehmlich das Lied, gibt
dem Verfahren Arbeitsanregung, Arbeitsweg und Arbeits-
form. 2m Liede sclbft sind die starken wurzeln der mc-
thodischen Rraft. So mannigfaltig die Lieder, so beglük-
kend mannigfaltig entspringen ihnen die Anregungen und
ergeben sich stets neue Arbeitsformen und Arbeitswege.
Die im Liedc tönenden Rräfte geben dem Arbeitsverfah-
rcn Richtung, Aufbau, Haltung, Ziel und Vollendung. Ein
Lied wird nicht durch hinzugetragene Erklärungen und
Deutungen zum Liede, das wunder des Liedes kann nur
erschlossen werden. Die Lieder sind so verschieden,
wie die Menschen mit verschiedenem Antlitz ünd eigenem
Atem und Herzschlag. Aus der Achtung vor der Eigenart
des Liedes wächst die Eigenart des Verfahrens. Auch das
kleinste Lied ist beredt, ihm soll die Zunge gelöst werden.
Und was alles gibt es auf dem wege ins Lied zu lernen:
die verschiedenartige Ausdruckskraft des Dreiklanges,
einer Tonfolge, einer wendung, eines Sprunges oder eines
Schwunges, die Schönheit und Verschiedenhcit des rhyth-
mischen Geschmeides. Bewegungsrichtung, Bewegungsge-
schwindigkeit und Bewegungsform sind Begriffe, mit
denen die Rinder zu arbeiten gelehrt wird. 2n die Musik-
stunde gehöpen alle Vokabeln der Bewegung, sie bilden
eine gute Gewähr für den dynamischen Verlauf der
Stunde und für die Fernhaltung von Langewcile und
statischer Steife. Wenn man vom Lehrer schlechthin for-
dert, daß er schöpferische Rraft besitzen soll, so muß man
zum mindesten verlangen können, daß er die Rräfte aüs-
zuschöpfen vermag, die ihm jcdes Lied in Fülle in die
Hand gibt. Der Lehrcr, der Lieder kennt und Lieder lieb
hat, müßte folgerichtig das bcste Lehrverfahren haben.
So sieht die Methode aü», die aus der Musik schöpft
und schwingt, die Methode in erhöhtem und vollkomme-
nem Sinne, -ie nie alt und verbraucht wird, die stet» sich
selbst belebt und erneut: die Methode aus der Sache.
____
betrachte die Musrk „icht nur als eine Runst, das Okr zu ergoyen, sondcrn als cins der größtcn
el, das
M
S4 ^
i zu bewegen und Empfindungen zu erreyen.
MWW
K»
>le MthoSe aus Ser Lache
ser die Geschichc der Schulmusik aufmerksam
iiberblickt, der wird scin hellcs Vcrwundern
sinden an dcm Rhythmus, in dem die Me.
thodcnfragc in verschiedenzeitiAem wechsel
vordcr- oder hintergründig gewcsen ist. Jmmer wicdcr
brechen dic Auseinandcrsetzungen über den Untcrrichtsweg
in das vorderste Feld der schulmusikalischen Erörterung.
Die Musik mag für didaktisch weni§ ansprechbar yegol.
ten haben, daß man den weg in das schöne Zauberland
um so sorgsamer befestigt wiffen wollte. Nur so ist es ;u
verstehen, daß im Laufe der Iahrzehnte sehr viele und
überdies meistens sehr vernünftige Menschen sich die Fin.
ger heiß geschrieben haben, um den ganz besonderen wert
gcrade „ihrer" Methode beweiskräftig darzutun. Bei dem
übcrzeugtcn Einsatz für dic gute Sache wurde der jenseits
für seine ebenso gute Sache eifernde Andere leider zum
Gegner. Gar mancher Funke entsprang den streitbaren
Rlingen und mancher Rampfruf ist in den vcrgangenen
Iahrzchnten, nicht zum wenigsten im letzten, hin und
wider crschollen. Bei den teilweise erbitterten, gelegent-
lich unsachlichen Auseinandersetzungen, stand der wille,
das Gemcinsame ;u finden und sinnvoll auszubauen in
seiner Dynamik naturgemäß zurück hinter dem Eifer,
mit dem der Trennungsgraben zwischen den verschiedenen
Wegkündungen gezogen wurde. Da stand man mit „sei-
ner Methode" auf weiter Flur, suchte, immer auf Grund
sachlichcr llberzeugung, Hilfstruppen und Anhänger, um
beim nächstcn feindlichen Rriegsruf gerüstet ;u sein. Über
den Graben aber ging man nicht. Man er-
klärtc, der gedanklichc Aufbau der Methode laffe einen
Einbruch drüben geltender Beweisführungen nicht ;u, man
könnc nicht zueinander und müffe für sein gutcs Recht
einstchen. 2m besten Falle ward aus dem Gegeneinander
ein Nebeneinander.
Die Zeit des Methodenstreites klingt, obgleich es auf
dem Rampffelde recht viel ruhiger geworden ist, immcr
noch nach. Gegen eineN frischen und mannhaftcn Rampf
auch auf didaktischem Gebiete ist nichts einzuwenden und
es soll nicht an Verständnis dafür fehlen, daß jemand,
der einen weg für richtig erkannt hat, diesen ;u be-
festigen und auszubauen sucht. Die Gangbarkeit eines
weges erleichtert allemal das Vorwärtskommen. Dazu
kommt, daß fachliche Auseinandersetzungen kluger Leute,
auch wo diese nicht auf einer Bahn schreiten, für die
Sache sehr erheblich fördernd sein können. wenn man
aber bedenkt, daß es sich im Musikunterricht um die bei-
den Dinge Rind und Musik und deren innigste Ver-
einigung handelt, so wird man nicht umhin können, das
Lehrverfahren von vornherein in die Rolle des Die-
nensamwerkzu verweisen. Nicht von ungefähr ver-
wahren sich manche als systematische Methoden bezeichncte
Verfahren gegen diese Benennung, um klarzustellen, daß
sie um der Sache willen da sind. Beim weiteren Zuschauen
und näheren Vergleich der verschicdenen Methoden er-
gibt sich, daß die Unterscheidungen sich meistens nur auf
Tonbezcichnungen, auf wege zur Lrlernung der Noten
oder auf Gewinnung der Treffsicherheit beziehen, also,um
Dinge, die nur ein Teil und Vorbedingung des Ganzen
bilden. Hier tauche» in Mer Deutlichkeit schiese Mög.
lichkeiten auf: alle methodischen Systeme bergen für den
Unfreien gewiffe Gefahren in sich, nämlich die, daß sie
jhren Herrn und Meister zum Erlietzen statt in didak-
tischen Schwung bringcn. wer in dem — bestimmt sehr
wichtigen — Tejl das Ganze sieht, wer sich in der Syste-
matik der Methode verirrt, ftatt sie als Handreichung zu
nchmen, un> die Sache ;u entzünden, der ist nicht geschickt
zum Dicnstc in der musikalischen Unterweisung. Dem
wort: „Vkicht dic Methode macht den Mann, sondern der
Mann die Methodc" kann andererseits nur bedingt zuge-
stimmt werden, nämlich dann, wenn der Mann danach ist.
Auch dcr Tüchtigc muß zunächst das Handwerk erlernen,
aber die 2dee des schöpferischcn Handwerks, wie sie heute
erneut Betonung empfängt, ist in erhöhtem Sinne auf das
Schulwerk zu übertragen. Der kaum Entzündbare zwar
wibd alleweil weniger ausrichten in der Musik seincr
Schulc, als der schöpfcrische Lehrer,' beide aber müffen
sich der Gaben versehen, die „die Methode" in grund-
gütiger Dienstbereitschaft für die musikalische Arbeit im
weinberg der Schule zu spenden sich erbietet.
Es hieße den Sinn der Mcthode verkennen, wenn man
glauben würde, sie habe mit der Bereitstellung und
Übermittlung des Handwerklichen ihren Dienst abgeleistet.
Es sind vielmehr noch erhebliche, und zwar die wichtigsten
Ansprüche an sie ;u stellen, Ansprüche, die auf das eng-
verbundene Verhältnis Methode-Sachc
zielen. Die Methode, soweit sie systematisch gerichtet und
geordnet ist, wird blutleer, arm und schwächlich bleiben
müffen, wenn sie sich nicht durchströmen laffen würde von
der Rraft, die aus der Sache, aus dem Bildungsgut selbst
fließt. Die Musik, das jeweils in die unterrichtlichc Bc°
handlung tretcnde Musikstück, vornehmlich das Lied, gibt
dem Verfahren Arbeitsanregung, Arbeitsweg und Arbeits-
form. 2m Liede sclbft sind die starken wurzeln der mc-
thodischen Rraft. So mannigfaltig die Lieder, so beglük-
kend mannigfaltig entspringen ihnen die Anregungen und
ergeben sich stets neue Arbeitsformen und Arbeitswege.
Die im Liedc tönenden Rräfte geben dem Arbeitsverfah-
rcn Richtung, Aufbau, Haltung, Ziel und Vollendung. Ein
Lied wird nicht durch hinzugetragene Erklärungen und
Deutungen zum Liede, das wunder des Liedes kann nur
erschlossen werden. Die Lieder sind so verschieden,
wie die Menschen mit verschiedenem Antlitz ünd eigenem
Atem und Herzschlag. Aus der Achtung vor der Eigenart
des Liedes wächst die Eigenart des Verfahrens. Auch das
kleinste Lied ist beredt, ihm soll die Zunge gelöst werden.
Und was alles gibt es auf dem wege ins Lied zu lernen:
die verschiedenartige Ausdruckskraft des Dreiklanges,
einer Tonfolge, einer wendung, eines Sprunges oder eines
Schwunges, die Schönheit und Verschiedenhcit des rhyth-
mischen Geschmeides. Bewegungsrichtung, Bewegungsge-
schwindigkeit und Bewegungsform sind Begriffe, mit
denen die Rinder zu arbeiten gelehrt wird. 2n die Musik-
stunde gehöpen alle Vokabeln der Bewegung, sie bilden
eine gute Gewähr für den dynamischen Verlauf der
Stunde und für die Fernhaltung von Langewcile und
statischer Steife. Wenn man vom Lehrer schlechthin for-
dert, daß er schöpferische Rraft besitzen soll, so muß man
zum mindesten verlangen können, daß er die Rräfte aüs-
zuschöpfen vermag, die ihm jcdes Lied in Fülle in die
Hand gibt. Der Lehrcr, der Lieder kennt und Lieder lieb
hat, müßte folgerichtig das bcste Lehrverfahren haben.
So sieht die Methode aü», die aus der Musik schöpft
und schwingt, die Methode in erhöhtem und vollkomme-
nem Sinne, -ie nie alt und verbraucht wird, die stet» sich
selbst belebt und erneut: die Methode aus der Sache.
____
betrachte die Musrk „icht nur als eine Runst, das Okr zu ergoyen, sondcrn als cins der größtcn
el, das
M
S4 ^
i zu bewegen und Empfindungen zu erreyen.
MWW
K»