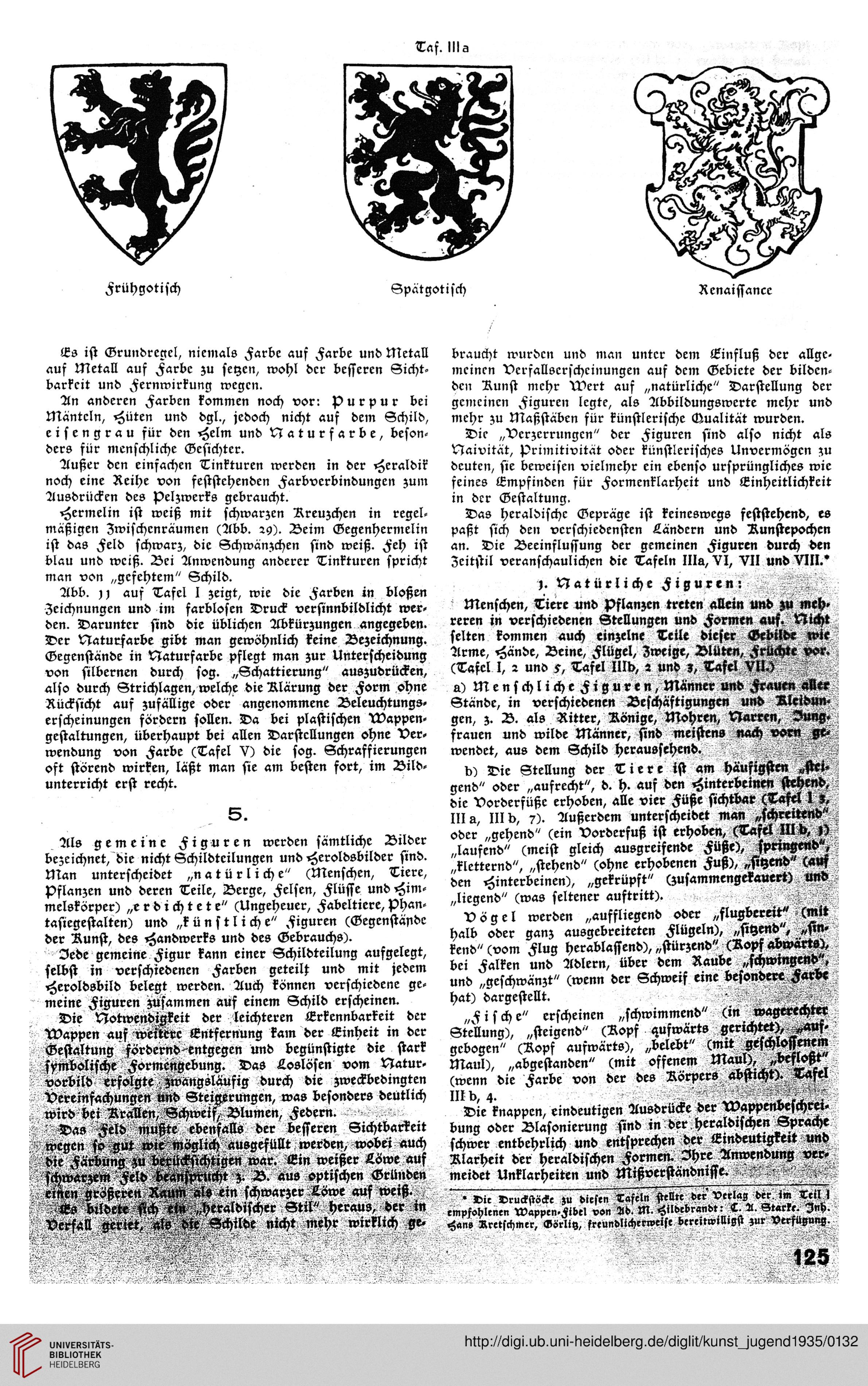Taf. III s
Friihgotisch
Spätgotisch
Rcnaissancc
Es ist Grundregel, niemals Farbe auf Farbe und Mctall
auf Metall auf Farbc ;u seycn, wohl dcr besscren Sicht-
barkcit und Fernwirkung wegcn.
An anderen Farben kommen noch vor: Purpur bei
Mäntcln, Hüten und dgl., jedoch nicht auf dem Schild,
cisengrau für dcn Helm und Naturfarbe, beson-
ders für menschliche Gesichter.
Außer den einfachen Tinkturen werden in der Heraldik
noch eine Reihe von feststehenden Farbverbindungen zum
Ausdrücken des pelzwerks gebraucht.
Hermelin ist weiß mit schwarzen Rreuzchen in regel.
mäßigen Zwischcnräumen (Abb. rg). Beim Gegenhermelin
ist das Feld schwarz, die Schwänzchen stnd weiß. Feh ist
blau und wciß. Bei Anwcndung anderer Tinkturen spricht
man von „gefehtcm" Schild.
Abb. 11 auf Tafel I zeigt, wie die Farben in bloßen
Zeichnungen und im farblosen Druck verstnnbildlicht wer.
den. Darunter sind die üblichen Abkürzungen angegeben.
Der Natucfarbe gibt man gewöhnlich keine Dezeichnung.
Gegenstände in Naturfarbc pflegt man zur Unterscheidung
von silbernen durch sog. „Schattierung" auszudrücken,
also durch Strichlagen, welche die Rlärung der Form ohne
Rücksicht aus zufällige oder angenommene Beleuchtungs-
erscheinungen fürdern sollen. Da bei plastischen wappen-
gestaltungen, überhaupt bei allcn Darstellungen ohne Ver>
wendung von Farbe (Tafel V) die sog. Schraffierungen
oft störend wirken, läßt man sie am besten fort, im Bild>
unterricht erst recht.
s.
2lls gemeinc Figuren werden sämtliche Bilder
be;eichnet, die nicht Schildtcilungen und Heroldsbilder sind.
Man unterscheidet „natürliche" (Menschen, Tierc,
pflanzen und deren Deile, Bcrge, Felsen, Flüffe und Him-
mclskörper) „erdrchtete" (Ungeheuer, Fabeltiere, phan>
tasiegestalten) und „künstliche" Figuren (Gegenstäpdc
der Runst, des Handwerks und des Gebrauchs).
Iede gemcine Figur kann einer Schildteilung aufgelegt,
selbst in verschiedenen Farben geteils und mit jedem
Heroldsbild belegt werden. Auch können verschiedene ge-
meine Figuren zusammen aüf einem Schild erscheinen.
Die NotwenhiHkeit der leichteren Erkennbarkeit der
Mappen auf-weWüc Entfernung kam dec Einheit in der
Gestaltung fördernd entgegen und begünstigte die stark
sßmbolische Formcngebung. Das Loslösen vom Natur.
vorbild erfolgte - zwÄNgslchifig durch die zweckbedingten
Vereinfachungen tmd Steigerungen, was besonders deütlich
wird bei Lrallen, Schweif, Blumen, Fedcrn. -
Das Feld mußrc ebenfalls der besseren Sichtbarkeit
wegen so gut mie müglich «usgefüllt werden, wobei auch
die Fardung ;u bcrucksicbtigen war. Ein weißcc Lowc auf
^ "schwarzem Feld beanfprucht B. aus sptischen Gründen
auf weiß.
Es bildete sich ein „hcraldifcher Stil bcraus. dcr in
Verfall geriet, als die Schilde nicht mchr wirklich ge>
- Lv-7- - -
braucht wurdcn und man untcr dem Einfluß der allgc-
mcincn Vcrfallserschcinungen auf dcm Gebicte der bildcn-
dcn Runst mchr wert auf „natürliche" Darstellung der
gcmcincn Figuren Icgte, als Abbildungswerte mchr und
mchr ;u Maßstäbcn für künstlerische Gualität wurden.
Die „Verzerrungcn" der Figuren sind also nicht als
Naivität, primitivität oder künstlerisches Unvcrmögcn ;u
deutcn, sie beweisen vielmchr ein ebenso ursprüngliches wic
feines Empfinden für Formcnklarheit und Einheitlichkeit
in dcr Gestaltung.
Das heraldischc Gepräge ist keineswegs feststehend, es
paßt sich den verschicdensten Ländcrn und Lunstepochcn
an. Die Beeinflussung der gcmeinen Figuren durch den
Zeitstil veranschaulichen dic Dafeln Ills, VI, Vll und Vlll.*
1. Vlatürliche Figuren; -7
Menschen, Tiere und pflanzcn treten allein und zu meh-
reren in verschiedenen Stellungen und Formen auf. Ntcht
selten kommen auch einzelne Tcile diefrr Grbilde wie
2lrme, Hände, Beine, Flügel, Zweige, Llüten, Früchte por.
(Tafel I, - und 5, Tafel Mb, r und r, Tafel Vtt.)
L) Menschliche Figuren, Männer vnd Lrauen aürr
Stände, in verschiedenen Leschäftigungrn und LleidtM-
gen, ;. B. als Rittrr, Lönige, Mohren, vlarrrn, Svng.
frauen und wilde Männrr, sind meistens nach vorn ge>
wendet, aus dem Schild heraussehcnd.
d) Die Stellung der Tiere ist am häufigsten .,stei>
gend" oder „aufrecht", d. h. auf den Hinterbeinen strhrnd,,
die Vorderfüße erhoben, alle vicr Füße sichtbak fsI,
Ill s, III b, 7). Außerdem unterscheidet män „fchreitend"
oder „gehend" (ein Vorderfuß ist erhoben, (Tafrl llld, »
„laufend" (meist gleich ausgreifende Füße), springend".
„kletternd", „ftehend" (ohne erhobenen Fuß), „sitzend" (avf
den Hinterbeinen), „gekrüpft" (zusammengekauert) and
„liegend" (was seltener auftritt). -7
Vögel werden „auffliegend oder „flugbereit" (mit
halb oder gan; ausgebreiteten Flügeln), „sitzend", «sin«
kend" (vom Flug herablaffend), „stürzend" (Ropf abwärts),
bei Falken und Adlern, Lber dem Raube „schwingend"M
und „geschwänzt" (wenn der Schweif eine besondere Farbr
hat) dargestellt. -
„F ische" crscheinen „schwimmend" (in wagerechter
Stellung), „steigend" (Ropf -;ufwärts gerichtet), ^auf»
gebogen" (Ropf aufwärts), „belebt" (mit grschlossenrm
Maul), „abgestanden" (mit offenem Maul), „befloßt"
(wenn die Farbe von der des Rörpers absticht). Tafel
II! l», 4.
Die knappen, rindeutigen Ausdrücke der wappenbeschrei«
bung oder Blasonierung sind in der heraldischrn Sprache
schwer entbehrlich und entsprechen der Eindeutigkeit «nd
Rlarheit der heraldischen Formen. Phre Anwendung ver-
meidet Unklarheiten und Mißverständniffe.
' Dir Druckstürkc zu dicsrn lafeln stcllrc der Vcrlag dcr. im Tcil I
cmpfshlenen wappcn.Ftbel von Ad. M. Hildebrandr: L. L. Starkc. Jnh.
Hans Lretschmcr, «srlty, frcundlicherweise bcreitwilligst ;ur Verfügnng.
I2S
Friihgotisch
Spätgotisch
Rcnaissancc
Es ist Grundregel, niemals Farbe auf Farbe und Mctall
auf Metall auf Farbc ;u seycn, wohl dcr besscren Sicht-
barkcit und Fernwirkung wegcn.
An anderen Farben kommen noch vor: Purpur bei
Mäntcln, Hüten und dgl., jedoch nicht auf dem Schild,
cisengrau für dcn Helm und Naturfarbe, beson-
ders für menschliche Gesichter.
Außer den einfachen Tinkturen werden in der Heraldik
noch eine Reihe von feststehenden Farbverbindungen zum
Ausdrücken des pelzwerks gebraucht.
Hermelin ist weiß mit schwarzen Rreuzchen in regel.
mäßigen Zwischcnräumen (Abb. rg). Beim Gegenhermelin
ist das Feld schwarz, die Schwänzchen stnd weiß. Feh ist
blau und wciß. Bei Anwcndung anderer Tinkturen spricht
man von „gefehtcm" Schild.
Abb. 11 auf Tafel I zeigt, wie die Farben in bloßen
Zeichnungen und im farblosen Druck verstnnbildlicht wer.
den. Darunter sind die üblichen Abkürzungen angegeben.
Der Natucfarbe gibt man gewöhnlich keine Dezeichnung.
Gegenstände in Naturfarbc pflegt man zur Unterscheidung
von silbernen durch sog. „Schattierung" auszudrücken,
also durch Strichlagen, welche die Rlärung der Form ohne
Rücksicht aus zufällige oder angenommene Beleuchtungs-
erscheinungen fürdern sollen. Da bei plastischen wappen-
gestaltungen, überhaupt bei allcn Darstellungen ohne Ver>
wendung von Farbe (Tafel V) die sog. Schraffierungen
oft störend wirken, läßt man sie am besten fort, im Bild>
unterricht erst recht.
s.
2lls gemeinc Figuren werden sämtliche Bilder
be;eichnet, die nicht Schildtcilungen und Heroldsbilder sind.
Man unterscheidet „natürliche" (Menschen, Tierc,
pflanzen und deren Deile, Bcrge, Felsen, Flüffe und Him-
mclskörper) „erdrchtete" (Ungeheuer, Fabeltiere, phan>
tasiegestalten) und „künstliche" Figuren (Gegenstäpdc
der Runst, des Handwerks und des Gebrauchs).
Iede gemcine Figur kann einer Schildteilung aufgelegt,
selbst in verschiedenen Farben geteils und mit jedem
Heroldsbild belegt werden. Auch können verschiedene ge-
meine Figuren zusammen aüf einem Schild erscheinen.
Die NotwenhiHkeit der leichteren Erkennbarkeit der
Mappen auf-weWüc Entfernung kam dec Einheit in der
Gestaltung fördernd entgegen und begünstigte die stark
sßmbolische Formcngebung. Das Loslösen vom Natur.
vorbild erfolgte - zwÄNgslchifig durch die zweckbedingten
Vereinfachungen tmd Steigerungen, was besonders deütlich
wird bei Lrallen, Schweif, Blumen, Fedcrn. -
Das Feld mußrc ebenfalls der besseren Sichtbarkeit
wegen so gut mie müglich «usgefüllt werden, wobei auch
die Fardung ;u bcrucksicbtigen war. Ein weißcc Lowc auf
^ "schwarzem Feld beanfprucht B. aus sptischen Gründen
auf weiß.
Es bildete sich ein „hcraldifcher Stil bcraus. dcr in
Verfall geriet, als die Schilde nicht mchr wirklich ge>
- Lv-7- - -
braucht wurdcn und man untcr dem Einfluß der allgc-
mcincn Vcrfallserschcinungen auf dcm Gebicte der bildcn-
dcn Runst mchr wert auf „natürliche" Darstellung der
gcmcincn Figuren Icgte, als Abbildungswerte mchr und
mchr ;u Maßstäbcn für künstlerische Gualität wurden.
Die „Verzerrungcn" der Figuren sind also nicht als
Naivität, primitivität oder künstlerisches Unvcrmögcn ;u
deutcn, sie beweisen vielmchr ein ebenso ursprüngliches wic
feines Empfinden für Formcnklarheit und Einheitlichkeit
in dcr Gestaltung.
Das heraldischc Gepräge ist keineswegs feststehend, es
paßt sich den verschicdensten Ländcrn und Lunstepochcn
an. Die Beeinflussung der gcmeinen Figuren durch den
Zeitstil veranschaulichen dic Dafeln Ills, VI, Vll und Vlll.*
1. Vlatürliche Figuren; -7
Menschen, Tiere und pflanzcn treten allein und zu meh-
reren in verschiedenen Stellungen und Formen auf. Ntcht
selten kommen auch einzelne Tcile diefrr Grbilde wie
2lrme, Hände, Beine, Flügel, Zweige, Llüten, Früchte por.
(Tafel I, - und 5, Tafel Mb, r und r, Tafel Vtt.)
L) Menschliche Figuren, Männer vnd Lrauen aürr
Stände, in verschiedenen Leschäftigungrn und LleidtM-
gen, ;. B. als Rittrr, Lönige, Mohren, vlarrrn, Svng.
frauen und wilde Männrr, sind meistens nach vorn ge>
wendet, aus dem Schild heraussehcnd.
d) Die Stellung der Tiere ist am häufigsten .,stei>
gend" oder „aufrecht", d. h. auf den Hinterbeinen strhrnd,,
die Vorderfüße erhoben, alle vicr Füße sichtbak fsI,
Ill s, III b, 7). Außerdem unterscheidet män „fchreitend"
oder „gehend" (ein Vorderfuß ist erhoben, (Tafrl llld, »
„laufend" (meist gleich ausgreifende Füße), springend".
„kletternd", „ftehend" (ohne erhobenen Fuß), „sitzend" (avf
den Hinterbeinen), „gekrüpft" (zusammengekauert) and
„liegend" (was seltener auftritt). -7
Vögel werden „auffliegend oder „flugbereit" (mit
halb oder gan; ausgebreiteten Flügeln), „sitzend", «sin«
kend" (vom Flug herablaffend), „stürzend" (Ropf abwärts),
bei Falken und Adlern, Lber dem Raube „schwingend"M
und „geschwänzt" (wenn der Schweif eine besondere Farbr
hat) dargestellt. -
„F ische" crscheinen „schwimmend" (in wagerechter
Stellung), „steigend" (Ropf -;ufwärts gerichtet), ^auf»
gebogen" (Ropf aufwärts), „belebt" (mit grschlossenrm
Maul), „abgestanden" (mit offenem Maul), „befloßt"
(wenn die Farbe von der des Rörpers absticht). Tafel
II! l», 4.
Die knappen, rindeutigen Ausdrücke der wappenbeschrei«
bung oder Blasonierung sind in der heraldischrn Sprache
schwer entbehrlich und entsprechen der Eindeutigkeit «nd
Rlarheit der heraldischen Formen. Phre Anwendung ver-
meidet Unklarheiten und Mißverständniffe.
' Dir Druckstürkc zu dicsrn lafeln stcllrc der Vcrlag dcr. im Tcil I
cmpfshlenen wappcn.Ftbel von Ad. M. Hildebrandr: L. L. Starkc. Jnh.
Hans Lretschmcr, «srlty, frcundlicherweise bcreitwilligst ;ur Verfügnng.
I2S