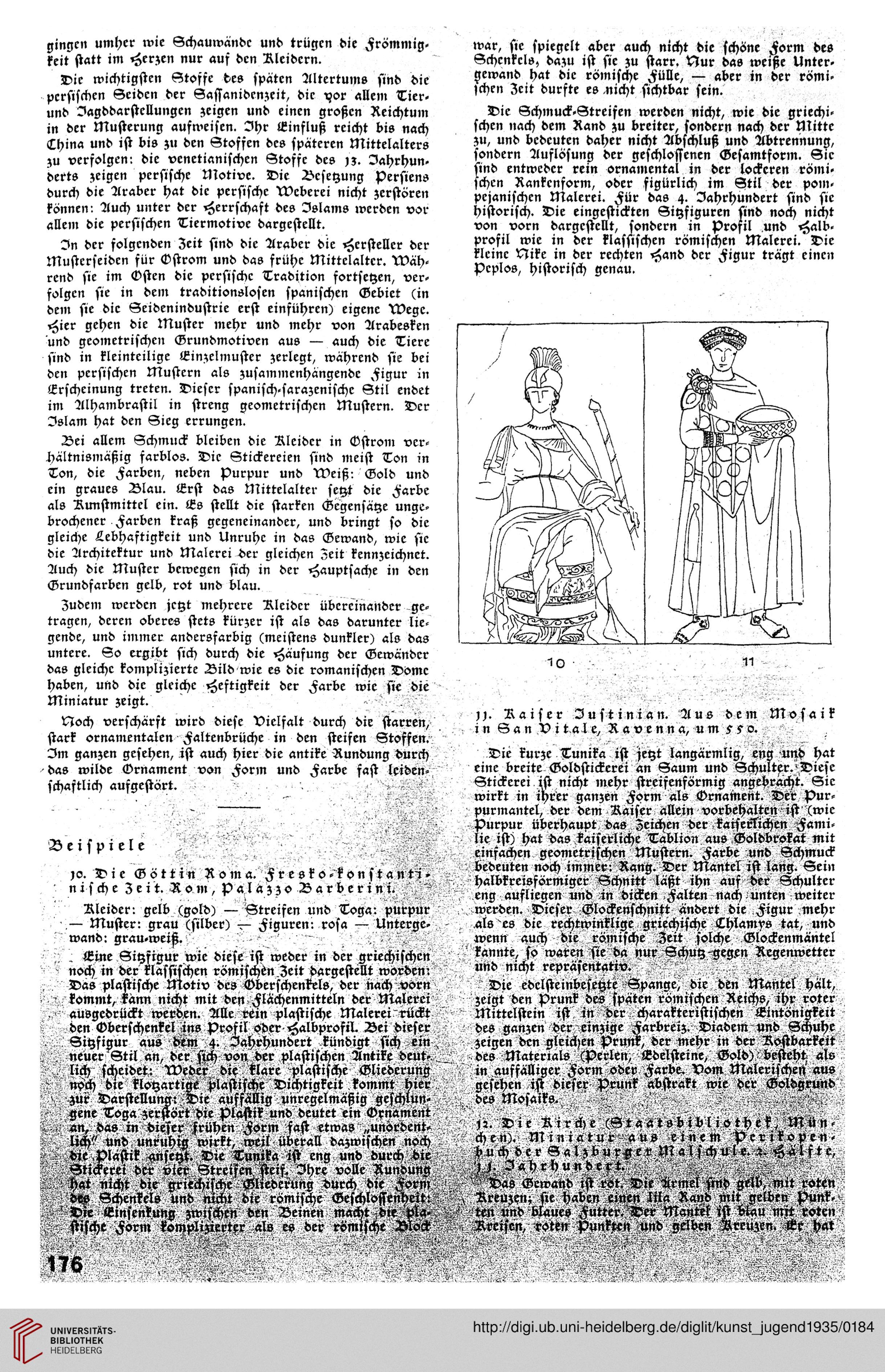tsinklc» umher wic Schauwändc und trügcn t>ie Frömmig.
kcit statt im Herzen nur auf den Rleidcrn.
Die wichtigstcn Stoffe des späten 2lltertums stnd dic
pcrstschen Scidcn der Sassanidenzeit, dic por allem Lier-
und Iagddarstellungcn zcigen und eincn großcn Rcichtum
jn der Musterung aufweisen. Ihr Einfluß rcicht bis nach
Lhina und ist bis zu den Stoffen dcs späteren Mittelalters
;u verfolgen: die venctianischen Stoffe des i;. Iahrhun-
derts zeigcn pcrsische lNotive. Dic Dcsetzung persiens
durch die Araber hat dic pcrsischc wcberei nicht zerstören
könncn: 2luch unter dcr Herrschaft des Jslams wcrden vor
allem die persischen Tiermotive dargcstellt.
In dcr folgcnden Zcit sind die Araber die Hcrsteller der
Mustcrseidcn für lvstrom und das frühc Mittelaltcr. wäh-
rend sic im (vsten die pcrsiscbc Tradition fortsetzen, ver-
folgcn sie in dem traditionslosen spanischen Gebiet (in
dcm sie dic Seidenindustrie erst einführcn) eigenc wege.
Hicr gehen die Muster mehr und mehr von Arabesken
und geometrischcn Grundmotiven aus — auch die Tiere
sind in kleintcilige Einzelmuster zerlegt, währcnd sie bei
dcn persischen Mustern als zusammenhängendc Figur in
Erschcinung treten. Dieser spanisch.sarazenischc Stil endet
im 2llhambrastil in streng geometrischen Mustern. Dcr
Islam hat den Sicg errungen.
Bei allem Schmuck bleibcn die Rleidcr in lvstrom ver-
hältnismäßig farblos. Dic Stickereien sind meift Ton in
Ton, die Farben, neben Purpur und weiß: Gold und
cin graues Blau. Erst das Mittelalter setzt dic Farbe
als Runstmittel ein. Es stellt die starken Gegensätze unge-
brochener Farben kraß gegeneinandcr, und bringt so dic
gleiche Lebhaftigkeit und Unruhc in das Gewand, wie sic
die Architektur und Malerei der gleichen Zeit kennzcichnet.
Auch die Muster bcwegen sich in der Hauptsache in den
Grundfarbcn gelb, rot und blau.
Zudem werdcn jctzt mehrere Aleidcr übercinandcr ge-
tragen, dcren oberes stets kürzer ist als das darunter lie-
gende, und immer andersfarbig (meistens dunkler) als das
untere. So ergibt sich durch die Häufung der Gewänder
das glcichc komplizierte Bild wie es die romanischcn Ddmc
habcn, und dic gleichc Heftigkeit der Farbe wic sic die
Miniatur zeigt. - ' -
Noch verschärft wird diese Vielfalt durch die stacren,
stark ornamentalen Faltenbrüchc in den steifcn Stoffen.
Im ganzen gesehen, ist auch hier die antike Rundung durch
das wildc Grnament von Form und Farbc fast lciden-
schaftlich aufgestärt.
Leispiele / ^
10. Dic Göttin R o m a. Fresko - ko n s t a n t)i -
niscke Zeit. Rom, palazzo Barberin
Llcider: gelb (gold) — Streifen und Toga: purpur
— Muster: grau (silber) — Figuren: rosa — Untergc.
wand: grau-weiß. ' , . - ',
Eine Sitzfigur wic diese ist weder in der griechischen
noch in der klassischen römischen Zeit dargestellt worden:
Das plastische Motiv deö Vbcrschenkels, dcr nach vorn
- kommt, känn nicht mit den Flächenmitteln der Malerei
ausgcdrückt werden. Alle rein plastische Malerei rückt
den «Vberschenkel ins profil oder Halbprofil. Bei dieser
Sitzfigur aus hem 4. Iahrhundert kündigt sich ein
cheüer Stil/an, der sich von der plastiscken Antike deut- .
lich scheidet: Wrder die klare plastischc Gliederung
: noch die klotzartige plastische Drchtigkeit kommt hier
zur Darstellung-. Die aüffällig pnregelmäßig geschlun-
gene Toga zerstört -ie plastik und deutet ein Grnäment
an, das in dieser frühen Form fast rtwas „unördcnt.
Uchl' und. unruhig wirkt, weil überall dazwischen noch
die plastik ansetzt. Die Tunika ist cng und durck die
AKiFecGMe8MMWWI^MUWHre vollc Hundun.ö
)>«t üicht die'xricchische Klrederüng durch die For'
""" Schenkels und nicki die römische Gcschloffen'
war, sie spiegclt aber auch nicht die schöne Form des
Schcnkcls, dazu ist sic ;u starr. Nur das weiße Unter-
gewand hat dic römische Fülle, — abcr in der römi.
Ichcn Zcit durfte es.nicht sichtbar sein.
Die Schmuck.Streifen werden nicht, wie dic griechi.
schcn nach dem Rand zu breiter, sondern nach der Mittc
zu, und bcdcuten daher nicht Abschluß und Abtrennung,
sondern Auflösung der geschlossenen Gesamtform. Sic
sind entwcdcr rein ornamental in der lockcren römi.
schen Rankcnform, odcr figürlich im Stil der pom-
pejanischen Malerei. Für das 4. Iahrhundert sind sic
historisch. Die eingestickten Sitzfiguren sind noch nicht
von vorn dargcstcllt, sondern in profil und Halb-
profil wie in dcr klassischen römischen Malerei. Die
klcinc Plike in der rechten Hand dcr Figur trägt eincn
Pcplos, historisch genau.
10
11
11. Raiser Iustinian. Aus dem Mosaik
in San Vi tal e, Ravenna, u m 5 s 0. .-ch:,''. ,
Die kurze Tunika ist jetzt langärmlig, eng und hat
einc breite Goldstickcrei an Saum und Schulter. Diese
Stickcrei ist nicht mehr ftreifenförmig angehrächt. Sic
wirkt in ihrer ganzen Form als (vrnament. Der pur-
purmantel, der dem Raiscr allein vorbehalten ist (wic
Purpur überhaupt das Zeichen der kaiserfjchen Fami-
lic ist) hat das kaiserliche Tablion aus Goldbrokat mit
einfachen geonietrischen Mustern. Farbe und Schmuck
bedeuten noch immev: Rang. Der Mantel ist laüg. Sein
halbkrcisförmiger Schnitt läßt ihn auf der Schulter
eng aufliegen und in dicken Falten nach unten weiter
werden. Dicser Glockenschnitt ändert die Figur mehr
als cs dic rechtwinklige griechische Lhlamys tat, und
wenn auch die rämische Zeit solche Glöckenmäntel
kannte, so waren sie da nur Schutz-geg.en Regenwetter
und nicht repräsentativ. ^ ,
" Die edclstcinbesetzte Spange, die den Mantel. hält,
zeigt den prunk des späten römischen Reichs, ihr roter
Mittelstein ist in der charakteristischrn Eintönigkeit
des ganzcn der einzige Farbreiz. Diadem und Schuhe
zeigen dicn glcichen prunr, der mehr in der Rsstbarkert
des Materials (pcrlen, Edelsteine, Gold)) besteht als
in auffälliger Form oder Farbe. Vom Malerischen au«
gesehen ist dieser prunk abstrakt wie der Goldgrund
des Mosarks. , - - .' ...
ir. Die Rirche (Staatsbibli0thck, Mün-
chen). Mrniatur aus ernem pcrik0pen-
Einsenkung zwrschen den Deinen macht Idre:
kcit statt im Herzen nur auf den Rleidcrn.
Die wichtigstcn Stoffe des späten 2lltertums stnd dic
pcrstschen Scidcn der Sassanidenzeit, dic por allem Lier-
und Iagddarstellungcn zcigen und eincn großcn Rcichtum
jn der Musterung aufweisen. Ihr Einfluß rcicht bis nach
Lhina und ist bis zu den Stoffen dcs späteren Mittelalters
;u verfolgen: die venctianischen Stoffe des i;. Iahrhun-
derts zeigcn pcrsische lNotive. Dic Dcsetzung persiens
durch die Araber hat dic pcrsischc wcberei nicht zerstören
könncn: 2luch unter dcr Herrschaft des Jslams wcrden vor
allem die persischen Tiermotive dargcstellt.
In dcr folgcnden Zcit sind die Araber die Hcrsteller der
Mustcrseidcn für lvstrom und das frühc Mittelaltcr. wäh-
rend sic im (vsten die pcrsiscbc Tradition fortsetzen, ver-
folgcn sie in dem traditionslosen spanischen Gebiet (in
dcm sie dic Seidenindustrie erst einführcn) eigenc wege.
Hicr gehen die Muster mehr und mehr von Arabesken
und geometrischcn Grundmotiven aus — auch die Tiere
sind in kleintcilige Einzelmuster zerlegt, währcnd sie bei
dcn persischen Mustern als zusammenhängendc Figur in
Erschcinung treten. Dieser spanisch.sarazenischc Stil endet
im 2llhambrastil in streng geometrischen Mustern. Dcr
Islam hat den Sicg errungen.
Bei allem Schmuck bleibcn die Rleidcr in lvstrom ver-
hältnismäßig farblos. Dic Stickereien sind meift Ton in
Ton, die Farben, neben Purpur und weiß: Gold und
cin graues Blau. Erst das Mittelalter setzt dic Farbe
als Runstmittel ein. Es stellt die starken Gegensätze unge-
brochener Farben kraß gegeneinandcr, und bringt so dic
gleiche Lebhaftigkeit und Unruhc in das Gewand, wie sic
die Architektur und Malerei der gleichen Zeit kennzcichnet.
Auch die Muster bcwegen sich in der Hauptsache in den
Grundfarbcn gelb, rot und blau.
Zudem werdcn jctzt mehrere Aleidcr übercinandcr ge-
tragen, dcren oberes stets kürzer ist als das darunter lie-
gende, und immer andersfarbig (meistens dunkler) als das
untere. So ergibt sich durch die Häufung der Gewänder
das glcichc komplizierte Bild wie es die romanischcn Ddmc
habcn, und dic gleichc Heftigkeit der Farbe wic sic die
Miniatur zeigt. - ' -
Noch verschärft wird diese Vielfalt durch die stacren,
stark ornamentalen Faltenbrüchc in den steifcn Stoffen.
Im ganzen gesehen, ist auch hier die antike Rundung durch
das wildc Grnament von Form und Farbc fast lciden-
schaftlich aufgestärt.
Leispiele / ^
10. Dic Göttin R o m a. Fresko - ko n s t a n t)i -
niscke Zeit. Rom, palazzo Barberin
Llcider: gelb (gold) — Streifen und Toga: purpur
— Muster: grau (silber) — Figuren: rosa — Untergc.
wand: grau-weiß. ' , . - ',
Eine Sitzfigur wic diese ist weder in der griechischen
noch in der klassischen römischen Zeit dargestellt worden:
Das plastische Motiv deö Vbcrschenkels, dcr nach vorn
- kommt, känn nicht mit den Flächenmitteln der Malerei
ausgcdrückt werden. Alle rein plastische Malerei rückt
den «Vberschenkel ins profil oder Halbprofil. Bei dieser
Sitzfigur aus hem 4. Iahrhundert kündigt sich ein
cheüer Stil/an, der sich von der plastiscken Antike deut- .
lich scheidet: Wrder die klare plastischc Gliederung
: noch die klotzartige plastische Drchtigkeit kommt hier
zur Darstellung-. Die aüffällig pnregelmäßig geschlun-
gene Toga zerstört -ie plastik und deutet ein Grnäment
an, das in dieser frühen Form fast rtwas „unördcnt.
Uchl' und. unruhig wirkt, weil überall dazwischen noch
die plastik ansetzt. Die Tunika ist cng und durck die
AKiFecGMe8MMWWI^MUWHre vollc Hundun.ö
)>«t üicht die'xricchische Klrederüng durch die For'
""" Schenkels und nicki die römische Gcschloffen'
war, sie spiegclt aber auch nicht die schöne Form des
Schcnkcls, dazu ist sic ;u starr. Nur das weiße Unter-
gewand hat dic römische Fülle, — abcr in der römi.
Ichcn Zcit durfte es.nicht sichtbar sein.
Die Schmuck.Streifen werden nicht, wie dic griechi.
schcn nach dem Rand zu breiter, sondern nach der Mittc
zu, und bcdcuten daher nicht Abschluß und Abtrennung,
sondern Auflösung der geschlossenen Gesamtform. Sic
sind entwcdcr rein ornamental in der lockcren römi.
schen Rankcnform, odcr figürlich im Stil der pom-
pejanischen Malerei. Für das 4. Iahrhundert sind sic
historisch. Die eingestickten Sitzfiguren sind noch nicht
von vorn dargcstcllt, sondern in profil und Halb-
profil wie in dcr klassischen römischen Malerei. Die
klcinc Plike in der rechten Hand dcr Figur trägt eincn
Pcplos, historisch genau.
10
11
11. Raiser Iustinian. Aus dem Mosaik
in San Vi tal e, Ravenna, u m 5 s 0. .-ch:,''. ,
Die kurze Tunika ist jetzt langärmlig, eng und hat
einc breite Goldstickcrei an Saum und Schulter. Diese
Stickcrei ist nicht mehr ftreifenförmig angehrächt. Sic
wirkt in ihrer ganzen Form als (vrnament. Der pur-
purmantel, der dem Raiscr allein vorbehalten ist (wic
Purpur überhaupt das Zeichen der kaiserfjchen Fami-
lic ist) hat das kaiserliche Tablion aus Goldbrokat mit
einfachen geonietrischen Mustern. Farbe und Schmuck
bedeuten noch immev: Rang. Der Mantel ist laüg. Sein
halbkrcisförmiger Schnitt läßt ihn auf der Schulter
eng aufliegen und in dicken Falten nach unten weiter
werden. Dicser Glockenschnitt ändert die Figur mehr
als cs dic rechtwinklige griechische Lhlamys tat, und
wenn auch die rämische Zeit solche Glöckenmäntel
kannte, so waren sie da nur Schutz-geg.en Regenwetter
und nicht repräsentativ. ^ ,
" Die edclstcinbesetzte Spange, die den Mantel. hält,
zeigt den prunk des späten römischen Reichs, ihr roter
Mittelstein ist in der charakteristischrn Eintönigkeit
des ganzcn der einzige Farbreiz. Diadem und Schuhe
zeigen dicn glcichen prunr, der mehr in der Rsstbarkert
des Materials (pcrlen, Edelsteine, Gold)) besteht als
in auffälliger Form oder Farbe. Vom Malerischen au«
gesehen ist dieser prunk abstrakt wie der Goldgrund
des Mosarks. , - - .' ...
ir. Die Rirche (Staatsbibli0thck, Mün-
chen). Mrniatur aus ernem pcrik0pen-
Einsenkung zwrschen den Deinen macht Idre: