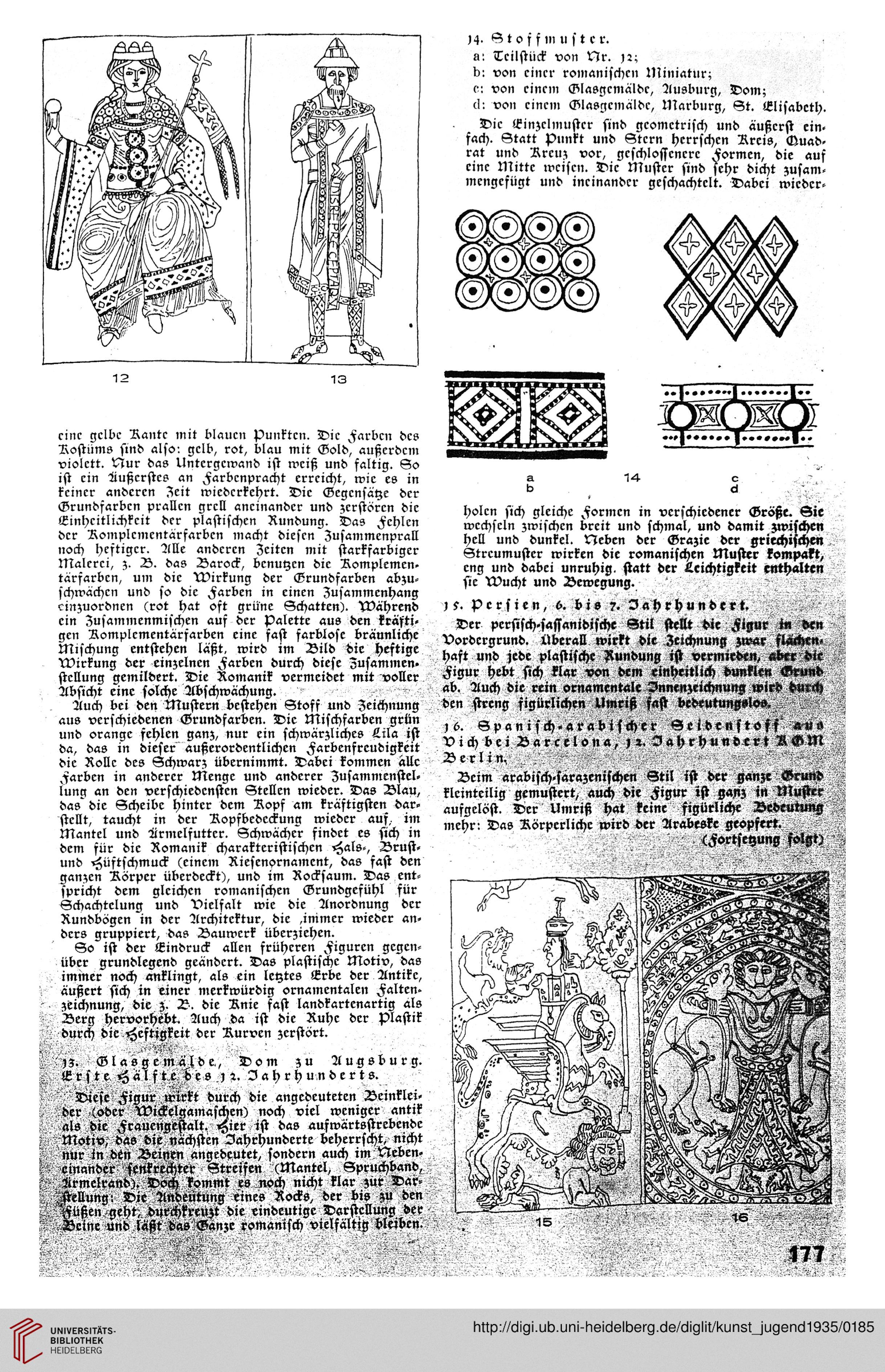14- S t o f f »i u s t c r.
s! Tcilstück von Nr. >r;
b: von cincr roinanischcn Miniatur;
c: von cincm Dlascicmäldc, Ausburci, Dom;
cl: von cincm Glasgcmälde, lNarburg, St. Elisabetl).
Dic Einzclmustcr sinb c,comctrisch und äußcrst cin-
fach. Statt punkt und Stcrn hcrrschcn Rrcis, Guad-
rat und Rrcuz vor, gcschloffencrc Formcn, die auf
cinc lNittc wciscn. Dic Muster sind schr dicht zusam-
mengefügt und incinandcr geschachtclt. Dabci wicdcr-
WMV
12
12
cinc gelbc Rantc mit blaucn punktcn. Dic Farbcn dcs
Dostüms sind also: gclb, rot, blau mit Gold, außcrdcm
violctt. Vlur das Untcrgcwand ist wciß und faltig. So
ist cin Äußcrstcs an Farbcnpracht errcicht, wie es in
kcincr andcrcn Zcit wiedcrkchrt. Dic Gegcnsätzc der
Grundfarbcn prallcn grcll ancinandcr und zerstörcn dic
Einhcitlichkeit dcr plastischen Rundung. Das Fehlen
dcr Romplcmcntärfarbcn macht diescn Zusammenprall
noch hestigcr. Alle andercn Zcitcn mit starksarbiger
Malcrci, z. D. das Barock, bcnutzcn die Romplcmcn.
tärsarben, um die wirkung dcr Grundfarben abzu-
schwächcn und so die Farben in cincn Zusammcnhang
cinzuordnen (rot hat oft grüne Schatten). ZVährend
ein Zusammenmischen auf der palettc aus den krästi«
gcn Romplcmentärsarben eine fast farblose bräunliche
Mischung entstehen läßt. wird im Dild die hestige
wirkung der einzelnen Farbcn durch diese Zusammen-
stcllung gemildert. Die Romanik vermeidet mit vollcr
Absicht cinc solche Abschwächung.
Auch bei den Mustern bcstehen Stoff und Zeichnung
aus verschiedenen Grundfarben. Dic Mischfarben grün
und orangc schlen ganz, nur ein schwärzliches Lila ist
da, das in dieser außerordentlichen Farbenfrcudigkeit
dic Rollc des Schwarz übernimmt. Dabei kommen ällc
Farbcn in anderer Menge und anderer Zusammenstel.
lung an den verschiedcnstcn Stellen wieder. Das Blau,
das' die Scheibc hintcr dem Ropf am kräftigsten dar°
stcllt, taucht in der Ropfbedeckung wieder auf, im
Mantcl und Ärmelfuttcr. Schwächer findct es sich in
dcm für dic Romanik charakteristischcn »Kals-, Drust.
und ^üftschmuck (eincm Riescnornamcnt, das fast den
ganzcn Rörper überdeckt), und im Rocksaum. Das ent-
spricht dem glcichen romanischcn Grundgefühl für
Schachtclung und Vielfalt wie die Anordnung der
Rundbögen in der Architcktur, die ,inimer wiedcr an-
dcrs gruppiert, das Bauwerk überziehen.
So ist der Eindruck allen frühcren Figuren gegen-
übcr grundlegend gcändcrt. Das plastischc Motiv, das
immer noch anklingt, als ein letztes Erbe der Antikc,
äußcrt sich in einer nicrkwürdig ornamentalen Falten-
zeichnung, die z. B. die Rnie fast landkartcnartig als
Berg hervorhebt. Auch da ift dic Ruhc der plastik
durch dic ^cftigkeit der Rurvcn zcrstört.
1Z. G l a s g e m ä.l d e, Dom ;u Augsburg.
E r s te HäI f t.e. h e s i r. Iahrhunderts.
Diese Figur wirkt durch die angcdcuteten Bcinklci.
der (oder wickelgamaschen) noch viel wenigcr antik
als die Fraueiigestalt. Hier ist das aufwärtsstrebendc
Mstivl däö bie. nächsten Iakrhunderte beherrscht, nicht
14
c
c!
holcn sich glciche Formcn in vcrschiedener Größe. Sie
wcchseln zwischcn brcit und schmal, und damit zwischen
hell und dunkel. Neben der Grazie der griechifchen
Strcumuster wirken dic romanifchen Muster kompakt,
eng und dabci unruhig. statt der Lcichtigkeit enthalten
sie wucht und Bewegung. " .
15. pcrsien, S. bis 7- Jahrhundert.
Der pcrsisch-saffanidische Stil stellt die Figur in dcn
Vordcrgrund. tlberall wirkt die Zeichnung zivar flächen,
haft und jede plastische ?lundung ist vermieden,
Figur hebt sich klqr von dcm einhritlich dunkien
ab. Auch dic rein srnamrntale Innenzrichnung wir
den streng figürlichen Umriß sast bcdcutungsiss.
1 S. Spanifch-arabischrr Seidenstsff aun
Vichbei La rc el ön a, , r. I ah rh«« d ert R KM
Derlin,
Beim arabisch-särazenischen Stil ist der ganze Grimd
kleintcilig gemustcrt, auch die Figur ist ganz in Ulustce
aufgelöst. Dcr Umrifi hat kcinc figürlichc Bcdeukung
mehr: Das Rörpcrlichc wird der Arabeske gespfert.
(Hortsetzung ssltzk)
.^.rllungi Die Andeotüng eines Rocks, der bis ;u
Mßen geht, dnrchkrruzt die rindeutigc Darstcllung der
Beine und läßt bas'Ganzc romanisch vielfältsg bleibenl
s! Tcilstück von Nr. >r;
b: von cincr roinanischcn Miniatur;
c: von cincm Dlascicmäldc, Ausburci, Dom;
cl: von cincm Glasgcmälde, lNarburg, St. Elisabetl).
Dic Einzclmustcr sinb c,comctrisch und äußcrst cin-
fach. Statt punkt und Stcrn hcrrschcn Rrcis, Guad-
rat und Rrcuz vor, gcschloffencrc Formcn, die auf
cinc lNittc wciscn. Dic Muster sind schr dicht zusam-
mengefügt und incinandcr geschachtclt. Dabci wicdcr-
WMV
12
12
cinc gelbc Rantc mit blaucn punktcn. Dic Farbcn dcs
Dostüms sind also: gclb, rot, blau mit Gold, außcrdcm
violctt. Vlur das Untcrgcwand ist wciß und faltig. So
ist cin Äußcrstcs an Farbcnpracht errcicht, wie es in
kcincr andcrcn Zcit wiedcrkchrt. Dic Gegcnsätzc der
Grundfarbcn prallcn grcll ancinandcr und zerstörcn dic
Einhcitlichkeit dcr plastischen Rundung. Das Fehlen
dcr Romplcmcntärfarbcn macht diescn Zusammenprall
noch hestigcr. Alle andercn Zcitcn mit starksarbiger
Malcrci, z. D. das Barock, bcnutzcn die Romplcmcn.
tärsarben, um die wirkung dcr Grundfarben abzu-
schwächcn und so die Farben in cincn Zusammcnhang
cinzuordnen (rot hat oft grüne Schatten). ZVährend
ein Zusammenmischen auf der palettc aus den krästi«
gcn Romplcmentärsarben eine fast farblose bräunliche
Mischung entstehen läßt. wird im Dild die hestige
wirkung der einzelnen Farbcn durch diese Zusammen-
stcllung gemildert. Die Romanik vermeidet mit vollcr
Absicht cinc solche Abschwächung.
Auch bei den Mustern bcstehen Stoff und Zeichnung
aus verschiedenen Grundfarben. Dic Mischfarben grün
und orangc schlen ganz, nur ein schwärzliches Lila ist
da, das in dieser außerordentlichen Farbenfrcudigkeit
dic Rollc des Schwarz übernimmt. Dabei kommen ällc
Farbcn in anderer Menge und anderer Zusammenstel.
lung an den verschiedcnstcn Stellen wieder. Das Blau,
das' die Scheibc hintcr dem Ropf am kräftigsten dar°
stcllt, taucht in der Ropfbedeckung wieder auf, im
Mantcl und Ärmelfuttcr. Schwächer findct es sich in
dcm für dic Romanik charakteristischcn »Kals-, Drust.
und ^üftschmuck (eincm Riescnornamcnt, das fast den
ganzcn Rörper überdeckt), und im Rocksaum. Das ent-
spricht dem glcichen romanischcn Grundgefühl für
Schachtclung und Vielfalt wie die Anordnung der
Rundbögen in der Architcktur, die ,inimer wiedcr an-
dcrs gruppiert, das Bauwerk überziehen.
So ist der Eindruck allen frühcren Figuren gegen-
übcr grundlegend gcändcrt. Das plastischc Motiv, das
immer noch anklingt, als ein letztes Erbe der Antikc,
äußcrt sich in einer nicrkwürdig ornamentalen Falten-
zeichnung, die z. B. die Rnie fast landkartcnartig als
Berg hervorhebt. Auch da ift dic Ruhc der plastik
durch dic ^cftigkeit der Rurvcn zcrstört.
1Z. G l a s g e m ä.l d e, Dom ;u Augsburg.
E r s te HäI f t.e. h e s i r. Iahrhunderts.
Diese Figur wirkt durch die angcdcuteten Bcinklci.
der (oder wickelgamaschen) noch viel wenigcr antik
als die Fraueiigestalt. Hier ist das aufwärtsstrebendc
Mstivl däö bie. nächsten Iakrhunderte beherrscht, nicht
14
c
c!
holcn sich glciche Formcn in vcrschiedener Größe. Sie
wcchseln zwischcn brcit und schmal, und damit zwischen
hell und dunkel. Neben der Grazie der griechifchen
Strcumuster wirken dic romanifchen Muster kompakt,
eng und dabci unruhig. statt der Lcichtigkeit enthalten
sie wucht und Bewegung. " .
15. pcrsien, S. bis 7- Jahrhundert.
Der pcrsisch-saffanidische Stil stellt die Figur in dcn
Vordcrgrund. tlberall wirkt die Zeichnung zivar flächen,
haft und jede plastische ?lundung ist vermieden,
Figur hebt sich klqr von dcm einhritlich dunkien
ab. Auch dic rein srnamrntale Innenzrichnung wir
den streng figürlichen Umriß sast bcdcutungsiss.
1 S. Spanifch-arabischrr Seidenstsff aun
Vichbei La rc el ön a, , r. I ah rh«« d ert R KM
Derlin,
Beim arabisch-särazenischen Stil ist der ganze Grimd
kleintcilig gemustcrt, auch die Figur ist ganz in Ulustce
aufgelöst. Dcr Umrifi hat kcinc figürlichc Bcdeukung
mehr: Das Rörpcrlichc wird der Arabeske gespfert.
(Hortsetzung ssltzk)
.^.rllungi Die Andeotüng eines Rocks, der bis ;u
Mßen geht, dnrchkrruzt die rindeutigc Darstcllung der
Beine und läßt bas'Ganzc romanisch vielfältsg bleibenl