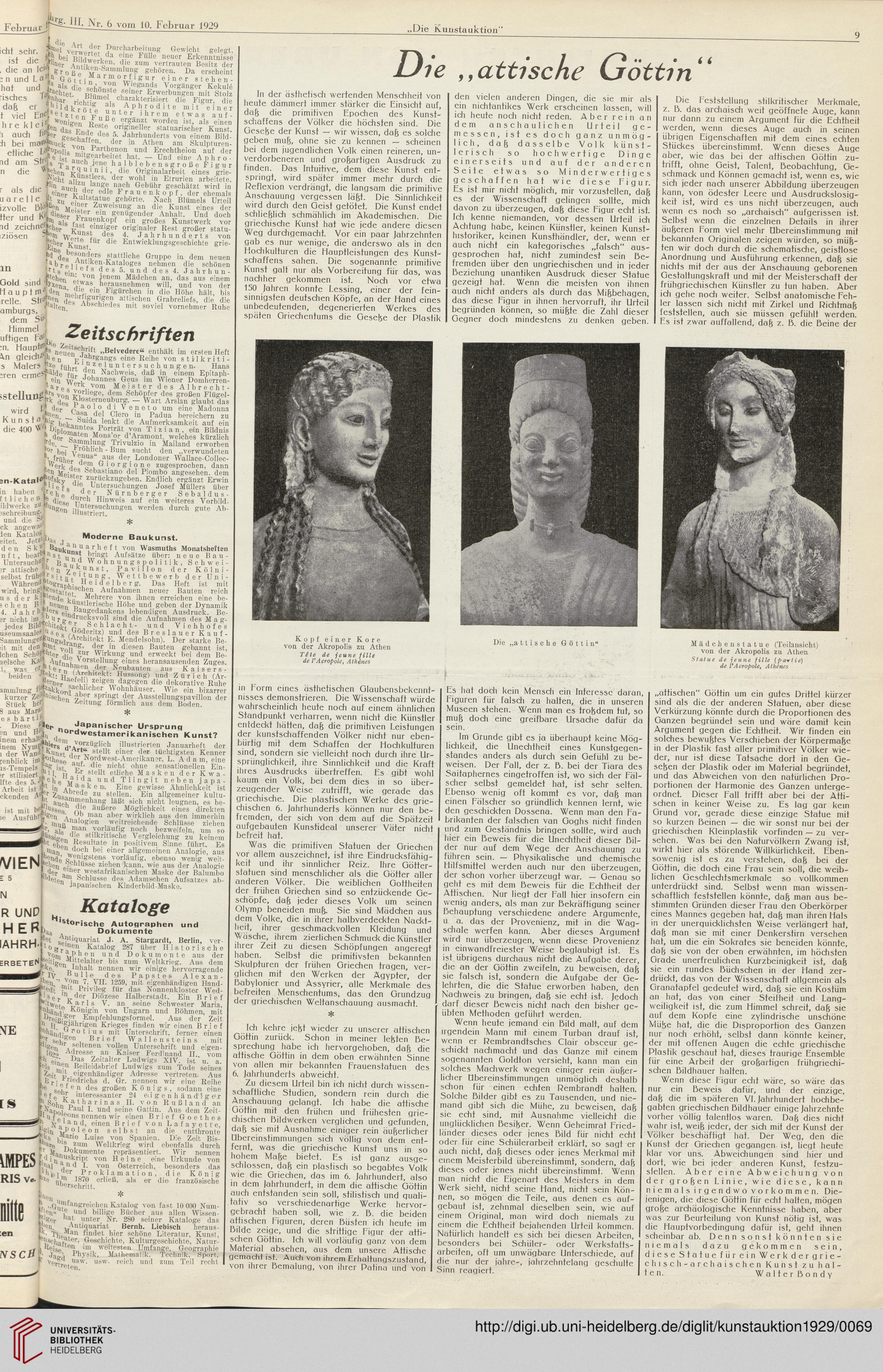„Die Kunstauktion"
9
NE
[S
:en
VIEN
E 5
N
R UND
H E Ru
IAHRH.[tOgV
niile t
K) '“U. uviinii xjivuiovu nciauo-
:en Th '"an findet hier schöne Literatur, Kunst,
r1ischnfat'er: Geschichte, Kulturgeschichte, Natur-
, L t&n im weitesten Umfange, Geographie
N S C 11' Physik, Mathematik. Technik. Sport,
p v<J?d usw. usw. reich und zum Teil recht
I treten.
Kataloge
historische Autographen und
Pas Dokumente
Bet „ P'fiquaTiat J. A. Stargardt, Berlin, ver-
itoBrlnen Katalog 287 über Historische
L v°V IrP ben und Dokumente aus der
ERBETEHreitigB. Mittelalter bis zum Weltkrieg. Aus dem
cn J^e. n„Inhalt nennen wir einige hervorragende
1 I y Bulle des Papstes Alexan-
:hei; ■’ v.°m 7. VII. 1259, mit eigenhändigen Hand
•nd' Privileg für das Nonnenkloster Wed-
-Ti s erInlzder Diözese Halberstadt. Ein Brief
r't»„. Karls V. an .seine' Schwester Maria,
fhliäna® Königin von Ungarn und Böhmen, mit
I Empfehlungsformel. Aus der Zeit
1 ]j“‘KJährigen Krieges finden wir einen Brief
^hän'a- 1,0 t i u s mit Unterschrift, ferner, einen
jt sJl!*’611 Brief Wallensteins mit
'hgen , seltenen vollen Unterschrift und eigen-
Adresse an Kaiser Ferdinand II., vom
dl Das Zeitalter Ludwigs XIV. ist u. a.
ej8 men Beileidsbrief Ludwigs zum Tode seines
Zeiten eigenhändiger Adresse vertreten. Aus
I; . i riedrichs d. Gr. nennen wir eine Reihe
11« 1 e f e n des großen Königs, sodann eine
'efphj interessanter 24 e, i g e n h ä ndl g e'.r
h Son Katharinas II. von Rußland an
i\an i I*aiil !• und sein6 Gattin. Aus dem Zeit-
<1 u r°leons nennen wir einen Brief Goethes
h ve 1 a n d, einen Brief von L a f a y e 111 e,
Fkin ?LP o 1 e o n selbst an die entthronte
iÜts t- Luise von Spanien. Die Zeit Bis-
'"T Zum Weltkrieg wird ebenfalls durch
M rr M« Dokumente repräsentiert. Wir nennen
»■'! i n uskript von Heine eine Urkunde von
lllll Dm Klipa n d I. von Österreich, besonders das
Phki®er Proklamation, die König
RIS Ve. , 1870 erließ, als er die französische
überschritt.
*
,,K*®fangreichen Katialog von fast 10 000 Num-
Tt.en« 1® und billige Bücher aus allen Wissen-
f'Ser hat unter Nr. 280 seiner Kataloge das
h-ti Antiquariat Bernh. Liebisch heraus-
Februar Nr, 6 vom 10, Februar 1929
,, der Durcharbeitung Gewicht gelegt,
icht sehr. ep^?rtet. da eine Fülle neuer Erkenntnisse
ist die .’f’linep Budwerken, die zum vertrauten Besitz der
, die an le'q g r n „n“ken-Sammlung gehören. Da erscheint
“n und LaV Götti armow-igur einer stehen-
f , „d s als riin1 Uil-v0.n w.ie&ands Vorgänger Kekule
hat un .rJtachtPt 6 o?.hoil;te seiner Erwerbungen mit Stolz
risches ‘Tnbar W- 15- mel, cl)arakterisiert die Figur, die
daß er ftildkals Aphrodite mit einer
1 vifl Fn4Se t z t «Tn V Snter ihrem etwas auf-
i V1C "'enio-pn" if U,ß e 6r?än'zt worden ist, als einen
h r e k I e l >etl , sen Reste origineller statuarischer Kunst.
1 auch f’fyer TT8 „ des 5- Jahrhunderts von einem Bild-
-h hei mallfbiupb s<-llaflen. der in Athen am Skulpturen-
ri- n I .V0)? Parthenon und Erechtheion auf der
etliche JA Wlis mitgearbeitet hat. — Und eine A p h r o ■
nd am StG8 q-J auch jene halblebensgroße Figur
n die *®chenv-u ‘.n 88 > die Originalarbeit eines grie-
liieht Künstlers., der wohl in Etrurien arbeitete.
, iKin a„„i!zu, lange nach Gebühr geschätzt wird in
r als die I e- “Uch der edle Frauenkopf, der ehemals
uarelle .jlt Kultstatue gehörte. Nach Blümels Urteil
lVlöTßen iwe!ner Zuweisung an die Kunst eines der
izvoiie PU d.« Meister ein genügender Anhalt. Und doch
fter und n U,, er Frauenkopf ein großes Kunstwerk vor
nd zeichnC'fCh61. 8 i?st einziger originaler Rest großer statu-
ziösen tv ’Jrlst des 4- Jahrhunderts von
Dir die Entwicklungsgeschichte grie-
Pine k unst,-
M de« A°n • rs stattliche Gruppe in dem neuen
t a h r „ i vUtiken-Kataloges nehmen die schönen
Ul ir t sr p; 1 e f s des 5- und des 4. Jahrhun-
rtchen * von ieuem Mädchen an, das aus einem
Gold sind 'bxena Vwas herausnehmen will, und von der
H a u o f m Men Ä , e,. ein. Figürchen in die Höhe hält, bis
«afrflhen ?*e‘lrfigurigen attischen Grabreliefs, die die
reue, J» Jtajt ues Abschiedes mit soviel vornehmer Ruhe
amburgs, 1 *■
dem Si*‘
Himmel J
uftigen Fat^. Zeitschriften
in. Haupt^- Zeitschrift „Belvedere“ enthält im ersten Heft
An gleich^jhen Jahrgangs eine Reihe von stiilkriti-
s Malers fiii„.7'* 1jIlz elunter suchungen. Hans
„..jt'äldp t-k den Nachweis, daß in einem Epitaph-
:ren ernt ! . tur Johannes Gens im Wiener DomheTren-
t a r p « Tk vom Meister des Albrecht-
ctolbmö11^ Von v?rIie8e’ dem Schöpfer des großen Flügel-
»SteilUD&hk 11 Klosterneuburg. — Wart Arslan glaubt das
• a t|S der ztaol° di Veneto um eine Madonna
Wircl i iirten ^nSa. del Clero. in Padua bereichern zu
Kunst a,,pig Suida lenkt die Aufmerksamkeit auf ein
die 400 DinU annfes Porträt von Tizian, ein Bildnis
6 dep01^^11 * Mons’or d’Aramont, welches kürzlich
Me. ^mpdung Trivulzio in Mailand erworben
Hör r röhlich - Bum sucht den „verwundeten
», frijJ venus“ aus der Londoner Wallace-Collec-
1 %rk 'a G i o r g i o n e zugesprochen, dann
Iteq w_.ues Sebastiano del Piombo angesehen, dem
it -.♦alM'fst,,1 Mr zurückzugeben. Endlich ergänzt Erwin
in-Mitm Bij*y die Untersuchungen Josef Müllers über
in haben Vt j *8 der Nürnberger Sebaldus-
ft liehe» b diesp durch Hinweis auf em weiteres Vorbild,
ildwerke zl1 «Unn-V® Untersuchungen werden durch gute Ab-
schreibung] n mustriert..
und die
ck angewiFi
len Kataloj-V Moderne Baukunst,
pitrßtl 3.S t
den Sk’1' Haiib^11 u a r h e f t von Wasmuths Monatsheften
oft beaftf11 stKUnsI bringt Aufsätze über: neue Bau-
Untersucli4r B " n,d W o h n u n g s p o 1 i t i k , S c h w e i -
ir attische Jh ® n z p ; + n 8 1 ’ £a M!1 0 n d ® r3 K °T 11! ‘
selbst früh«'' ’ s i t a te 11 u n g. W e 11 b e w e r b d e r U n i-
Währen»Plogradi.- Heidelberg. Das Heft, ist nut
wird hrinf-dK'estaf, ’s°hen Aufnahmen neuer Bauteil reich
us der kiffende v-' Mehrere von ihnen erreichen eine be-
sehen I5'- a®euen HPsUerische Höhe und geben der Dynamik
4 I a h r hlJsrs ei Baugedankens lebendigen Ausdruck. Be-
er nicht iihJkMgeVq Vb1l 8in? die Aufnahmen des M a g-
iedes Bildlchitol?+ ,1 Schlacht- und Viehhofes
iispnmsaale8lKs p s ,9öderitz) und des Breslauer Kauf-
S-immlungef^kiursa 'Architekt E. Mendelsohn). Der starke lie-
gt mit den F’ßt vo1®’ der in diesen Bauten gebannt ist,
ichen Sch«ffhter dl» vUr Wirkung, und erweckt bei dem Be-
ripKehP Auf« i vorstellun^ eines heransausenden Zuges,
t was (7,he!nah®6« der Neubauten aus Kaise?s-
’ beiden %kt- T? (Arehitekt: Hussong) und Zürich (Ar-
flern' HaefeW zeigen dagegen die dekorative Ruhe
ammlune fityäkkrwJ, icher. Wohnhäuser. Wie ein bizarrer
kurzer Zß’Jnischo„ springt der Ausstellungspavillon der
Stück hl1 Bn ^eitun'g förmlich aus dem Boden.
8 aus Mar»]. *
e s b ä r 11 *1
Diese c’er „ JaPar>ischer Ursprung
en und 11% nori|westamerikanischen Kunst?
lünm Vorzüglich illustrierten Januarheft der
w-, iil; kiii^.d Art“ stellt einer der tüchtigsten Kenner
1 bothp? der Nordwesit.-Amerikaner, L. Adam, eine
'enblick ii Se auf. die nicht ohne sensationellen Ein-
1S~1 ™Pe*, ra 111SK Er stellt etliche Masken der Kwa-
iftp dp« 5 JMh’p Mlda und Tlingit neben japa-
a B*t in6 aT a® k e m Eine gewisse Ähnlichkeit ist
nVpnapJ-'Afi r Zn« rede zu stellen. Ein allgemeiner kultu-
ckenden |lt üsammenhang läßt sich nicht leugnen, es be-
i«t mit lit-rJussna /!,'e äußere Möglichkeit eines direkten
. ”b man aber wirklich aus den immerhin
le Austu Analogien weitreichende Schlüsse ziehen
-■^'r, al man v°rläufig noch bezweifeln, um so
!lissm!s die stilkritische Vergleichung zu keinem
bt fmen Resultate in positivem Sinne führt.. Es
i^an n d°'.'b bei einer allgemeinen Analogie, aus
hetidp 2V6nigsten,s vorläufig, ebenso wenig weit-
’chim' “Ohlüsse ziehen kann, wie aus der Analogie
. dpr einer weetafrikanischen Maske der Balumbo
Gdpm a®. Schlüsse des Adamschen Aufsatzes ab-
ff Japanischen Kinderbild-Maske.
Die ,,attische Göttin *
In der ästhetisch wertenden Menschheit von
heute dämmert immer stärker die Einsicht auf,
dalj die primitiven Epochen des Kunst-
schaffens der Völker die höchsten sind. Die
Gesefee der Kunst — wir wissen, dafj es solche
geben muß, ohne sie zu kennen — scheinen
bei dem jugendlichen Volk einen reineren, un-
verdorbeneren und großartigen Ausdruck zu
finden. Das Intuitive, dem diese Kunst ent-
springt, wird später immer mehr durch die
Reflexion verdrängt, die langsam die primitive
Anschauung vergessen läßt. Die Sinnlichkeit
wird durch den Geist getötet. Die Kunst endet
schließlich schmählich im Akademischen. Die
griechische Kunst hat wie jede andere diesen
Weg durchgemacht. Vor ein paar Jahrzehnten
gab es nur wenige, die anderswo als in den
Hochkulfuren die Hauptleistungen des Kunst-
schaffens sahen. Die sogenannte primitive
Kunst galt nur als Vorbereitung für das, was
nachher gekommen ist. Noch vor etwa
150 Jahren konnte Lessing, einer der fein-
sinnigsten deutschen Köpfe, an der Hand eines
unbedeutenden, degenerierten Werkes des
späten Griechentums die Geseße der Plastik
den vielen anderen Dingen, die sie mir als
ein nichtantikes Werk erscheinen lassen, will
ich heute noch nicht reden. Aber rein an
dem anschaulichen Urteil ge-
messen, ist es doch ganz unmög-
lich, daß dasselbe Volk künst-
lerisch so hochwertige Dinge
einerseits und auf der anderen
Seite etwas so Minderwertiges
geschaffen hat wie diese Figur.
Es ist mir nicht möglich, mir vorzustellen, daß
es der Wissenschaft gelingen sollte, mich
davon zu überzeugen, daß diese Figur echt ist.
Ich kenne niemanden, vor dessen Urteil ich
Achtung habe, keinen Künstler, keinen Kunst-
historiker, keinen Kunsthändler, der, wenn er
audi nicht ein kategorisches „falsch“ aus-
gesprochen hat, nicht zumindest sein Be-
fremden über den ungriechischen und in jeder
Beziehung unantiken Ausdruck dieser Statue
gezeigt hat. Wenn die meisten von ihnen
auch nicht anders als durch das Mißbehagen,
das diese Figur in ihnen hervorruft, ihr Urteil
begründen können, so müßte die Zahl dieser
Gegner doch mindestens zu denken geben.
Die Feststellung stilkritischer Merkmale,
z. B. das archaisch weit geöffnete Auge, kann
nur dann zu einem Argument für die Echtheit
werden, wenn dieses Auge auch in seinen
übrigen Eigenschaften mit dem eines echten
Stückes übereinstimmt. Wenn dieses Auge
aber, wie das bei der attischen Göttin zu-
trifft, ohne Geist, Talent, Beobachtung, Ge-
schmack und Können gemacht ist, wenn es, wie
sich jeder nach unserer Abbildung überzeugen
kann, von ödester Leere und Ausdruckslosig-
keit ist, wird es uns nicht überzeugen, auch
wenn es noch so „archaisch" aufgerissen ist.
Selbst wenn die einzelnen Details in ihrer
äußeren Form viel mehr Übereinstimmung mit
bekannten Originalen zeigen würden, so müß-
ten wir doch durch die schematische, geistlose
Anordnung und Ausführung erkennen, daß sie
nichts mit der aus der Anschauung geborenen
Gestaltungskraft und mit der Meisterschaft der
frühgriechischen Künstler zu tun haben. Aber
ich gehe noch weiter. Selbst anatomische Feh-
ler lassen sich nicht mit Zirkel und Richtmaß
feststellen, auch sie müssen gefühlt werden.
Es ist zwar auffallend, daß z. B. die Beine der
Kopf einer Kore
von der Akropolis zu Athen
Töte de jeune fille
de VAcropole, Athenes
Die „attische Göttin“
Mädchen statue (Teil’anßicht)
von der Akropolis zu Athen
Statue de jeune fille (pattie)
de VAcropole, Athenes
in Form eines ästhetischen Glaubensbekennt-
nisses demonstrieren. Die Wissenschaft würde
wahrscheinlich heute noch auf einem ähnlichen
Standpunkt verharren, wenn nicht die Künstler
entdeckt hätten, daß die primitiven Leistungen
der kunstschaffenden Völker nicht nur eben-
bürtig mit dem Schaffen der Hochkulturen
sind, sondern sie vielleicht noch durch ihre Ur-
sprünglichkeit, ihre Sinnlichkeit und die Kraft
ihres Ausdrucks übertreffen. Es gibt wohl
kaum ein Volk, bei dem dies in so über-
zeugender Weise zutrifft, wie gerade das
griechische. Die plastischen Werke des grie-
chischen 6. Jahrhunderts können nur den be-
fremden, der sich von dem auf die Spätzeit
aufgebauten Kunstideal unserer Väter nicht
befreit hat.
Was die primitiven Statuen der Griechen
vor allem auszeichnet, ist ihre Eindrucksfähig-
keit und ihr sinnlicher Reiz. Ihre Götter-
statuen sind menschlicher als die Götter aller
anderen Völker. Die weiblichen Gottheiten
der frühen Griechen sind so entzückende Ge-
schöpfe, daß jeder dieses Volk um seinen
Olymp beneiden muß. Sie sind Mädchen aus
dem Volke, die in ihrer halbverdeckten Nackt-
heit, ihrer geschmackvollen Kleidung und
Wäsche, ihrem zierlichen Schmuck die Künstler
ihrer Zeit zu diesen Schöpfungen angeregt
haben. Selbst die primitivsten bekannten
Skulpturen der frühen Griechen tragen, ver-
glichen mit den Werken der Ägypter, der
Babylonier und Assyrier, alle Merkmale des
befreiten Menschentums, das den Grundzug
der griechischen Weltanschauung ausmacht.
*
Ich kehre jeßf wieder zu unserer attischen
Göttin zurück. Schon in meiner leßten Be-
sprechung habe ich hervorgehoben, daß die
attische Göttin in dem oben erwähnten Sinne
von allen mir bekannten Frauenstatuen des
6. Jahrhunderts abweicht.
Zu diesem Urteil bin ich nicht durch wissen-
schaftliche Studien, sondern rein durch die
Anschauung gelangt. Ich habe die attische
Göttin mit den frühen und frühesten grie-
chischen Bildwerken verglichen und gefunden,
daß sie mit Ausnahme einiger rein äußerlicher
Übereinstimmungen sich völlig von dem ent-
fernt, was die griechische Kunst uns in so
hohem Maße bietet. Es ist ganz ausge-
schlossen, daß ein plastisch so begabtes Volk
wie die Griechen, das im 6. Jahrhundert, also
in dem Jahrhundert, in dem die attische Göttin
auch entstanden sein soll, stilistisch und guali-
tativ so verschiedenartige Werke hervor-
gebracht haben soll, wie z. B. die beiden
attischen Figuren, deren Büsten ich heute im
Bilde zeige, und die strittige Figur der atti-
schen Göttin. Ich will vorläufig ganz von dem
Material absehen, aus dem unsere Attische
gemacht ist. Auch von ihrem Erhaltungszustand,
von ihrer Bemalung, von ihrer Patina und von
Es hat doch kein Mensch ein Interesse daran,
Figuren für falsch zu halten, die in unseren
Museen stehen. Wenn man es troßdem tut, so
muß doch eine greifbare Ursache dafür da
sein.
Im Grunde gibt es ja überhaupt keine Mög-
lichkeit, die Unechtheit eines Kunstgegen-
standes anders als durch sein Gefühl zu be-
weisen. Der Fall, der z. B. bei der Tiara des
Saitaphernes eingefroffen ist, wo sich der Fäl-
scher selbst gemeldet hat, ist sehr selten.
Ebenso wenig oft kommt es vor, daß man
einen Fälscher so gründlich kennen lernt, wie
den geschickten Dossena. Wenn man den Fa-
brikanten der falschen van Goghs nicht finden
und zum Geständnis bringen sollte, wird auch
hier ein Beweis für die Unechtheit dieser Bil-
der nur auf dem Wege der Anschauung zu
führen sein. — Physikalische und chemische
Hilfsmittel werden auch nur den überzeugen,
der schon vorher überzeugt war. — Genau so
geht es mit dem Beweis für die Echtheit der
Attischen. Nur liegt der Fall hier insofern ein
wenig anders, als man zur Bekräftigung seiner
Behauptung verschiedene andere Argumente,
u a. das der Provenienz, mit in die Wag-
schale werfen kann. Aber dieses Argument
wird nur überzeugen, wenn diese Provenienz
in einwandfreiester Weise beglaubigt ist. Es
ist übrigens durchaus nicht die Aufgabe derer,
die an der Göttin zweifeln, zu beweisen, daß
sie falsch ist, sondern die Aufgabe der Ge-
lehrten, die die Statue erworben haben, den
Nachweis zu bringen, daß sie echt ist. Jedoch
darf dieser Beweis nicht nach den bisher ge-
übten Methoden geführt werden.
Wenn heute jemand ein Bild malt, auf dem
irgendein Mann mit einem Turban drauf ist,
wenn er Rembrandtsches Clair obsceur ge-
schickt nachmacht und das Ganze mit einem
sogenannten Goldton versieht, kann man ein
solches Machwerk wegen einiger rein äußer-
licher Übereinstimmungen unmöglich deshalb
schon für einen echten Rembrandt halten.
Solche Bilder gibt es zu Tausenden, und nie-
mand gibt sich die Mühe, zu beweisen, daß
sie echt sind, mit Ausnahme vielleicht die
unglücklichen Besißer. Wenn Geheimrat Fried-
länder dieses oder jenes Bild für nicht echt
oder für eine Schülerarbeit erklärt, so sagt er
auch nicht, daß dieses oder jenes Merkmal mit
einem Meisterbild übereinstimmt, sondern, daß
dieses oder jenes nicht übereinstimmt. Wenn
man nicht die Eigenart des Meisters in dem
Werk sieht, nicht seine Hand, nicht sein Kön-
nen, so mögen die Teile, aus denen es auf-
gebaut ist, zehnmal dieselben sein, wie auf
einem Original, man wird doch niemals zu
einem die Echtheit bejahenden Urteil kommen.
Natürlich handelt es sich bei diesen Arbeiten,
besonders bei Schüler- oder Werkstaits-
arbeiten, oft um unwägbare Unterschiede, auf
die nur der jahre-, jahrzehntelang geschulte
Sinn reagiert.
„attischen“ Göttin um ein gutes Drittel kürzer
sind als die der anderen Statuen, aber diese
Verkürzung könnte durch die Proportionen des
Ganzen begründet sein und wäre damit kein
Argument gegen die Echtheit. Wir finden ein
solches bewußtes Verschieben der Körpermaße
in der Plastik fast aller primitiver Völker wie-
der, nur ist diese Tatsache dort in den Ge-
seßen der Plastik oder im Material begründet,
und das Abweichen von den natürlichen Pro-
portionen der Harmonie des Ganzen unterge-
ordnet. Dieser Fall trifft aber bei der Atti-
schen in keiner Weise zu. Es lag gar kein
Grund vor, gerade diese einzige Statue mit
so kurzen Beinen — die wir sonst nur bei der
griechischen Kleinplastik vorfinden — zu ver-
sehen. Was bei den Naturvölkern Zwang ist,
wirkt hier als störende Willkürlichkeit. Eben-
sowenig ist es zu verstehen, daß bei der
Göttin, die doch eine Frau sein soll, die weib-
lichen Geschlechtsmerkmale so vollkommen
unterdrückt sind. Selbst wenn man wissen-
schaftlich feststellen könnte, daß man aus be-
stimmten Gründen dieser Frau den Oberkörper
eines Mannes gegeben hat, daß man ihren Hals
in der unerguicklichsten Weise verlängert hat,
daß man sie mit einer Denkerstirn versehen
hat, um die ein Sokrates sie beneiden könnte,
daß sie von der oben erwähnten, im höchsten
Grade unerfreulichen Kurzbeinigkeit ist, daß
sie ein rundes Büchschen in der Hand zer-
drückt, das von der Wissenschaft allgemein als
Granatapfel gedeutet wird, daß sie ein Kostüm
an hat, das von einer Steifheit und Lang-
weiligkeit ist, die zum Himmel schreit, daß sie
auf dem Kopfe eine zylindrische unschöne
Müße hat, die die Disproportion des Ganzen
nur noch erhöht, selbst dann könnte keiner,
der mit offenen Augen die echte griechische
Plastik geschaut hat, dieses traurige Ensemble
für eine Arbeit der großartigen frühgriechi-
schen Bildhauer halten.
Wenn diese Figur echt wäre, so wäre das
nur ein Beweis dafür, und der einzige,
daß die im späteren VI. Jahrhundert hochbe-
gabten griechischen Bildhauer einige Jahrzehnte
vorher völlig talentlos waren. Daß dies nicht
wahr ist, weiß jeder, der sich mit der Kunst der
Völker beschäftigt hat. Der Weg, den die
Kunst der Griechen gegangen ist, liegt heute
klar vor uns. Abweichungen sind hier und
dort, wie bei jeder anderen Kunst, festzu-
stellen. Aber eine Abweichung von
der großen Linie, wie diese, kann
niemals irgendwo vorkommen. Die-
jenigen, die diese Göttin für echt halten, mögen
große archäologische Kenntnisse haben, aber
was zur Beurteilung von Kunst nötig ist, was
die Hauptvorbedingung dafür ist, geht ihnen
scheinbar ab. Denn sonst könnten sie
niemals dazu gekommen sein,
diese Statue für ein Werk der grie-
chisch-archaischen Kunst zu hal-
ten. WalterBondy
9
NE
[S
:en
VIEN
E 5
N
R UND
H E Ru
IAHRH.[tOgV
niile t
K) '“U. uviinii xjivuiovu nciauo-
:en Th '"an findet hier schöne Literatur, Kunst,
r1ischnfat'er: Geschichte, Kulturgeschichte, Natur-
, L t&n im weitesten Umfange, Geographie
N S C 11' Physik, Mathematik. Technik. Sport,
p v<J?d usw. usw. reich und zum Teil recht
I treten.
Kataloge
historische Autographen und
Pas Dokumente
Bet „ P'fiquaTiat J. A. Stargardt, Berlin, ver-
itoBrlnen Katalog 287 über Historische
L v°V IrP ben und Dokumente aus der
ERBETEHreitigB. Mittelalter bis zum Weltkrieg. Aus dem
cn J^e. n„Inhalt nennen wir einige hervorragende
1 I y Bulle des Papstes Alexan-
:hei; ■’ v.°m 7. VII. 1259, mit eigenhändigen Hand
•nd' Privileg für das Nonnenkloster Wed-
-Ti s erInlzder Diözese Halberstadt. Ein Brief
r't»„. Karls V. an .seine' Schwester Maria,
fhliäna® Königin von Ungarn und Böhmen, mit
I Empfehlungsformel. Aus der Zeit
1 ]j“‘KJährigen Krieges finden wir einen Brief
^hän'a- 1,0 t i u s mit Unterschrift, ferner, einen
jt sJl!*’611 Brief Wallensteins mit
'hgen , seltenen vollen Unterschrift und eigen-
Adresse an Kaiser Ferdinand II., vom
dl Das Zeitalter Ludwigs XIV. ist u. a.
ej8 men Beileidsbrief Ludwigs zum Tode seines
Zeiten eigenhändiger Adresse vertreten. Aus
I; . i riedrichs d. Gr. nennen wir eine Reihe
11« 1 e f e n des großen Königs, sodann eine
'efphj interessanter 24 e, i g e n h ä ndl g e'.r
h Son Katharinas II. von Rußland an
i\an i I*aiil !• und sein6 Gattin. Aus dem Zeit-
<1 u r°leons nennen wir einen Brief Goethes
h ve 1 a n d, einen Brief von L a f a y e 111 e,
Fkin ?LP o 1 e o n selbst an die entthronte
iÜts t- Luise von Spanien. Die Zeit Bis-
'"T Zum Weltkrieg wird ebenfalls durch
M rr M« Dokumente repräsentiert. Wir nennen
»■'! i n uskript von Heine eine Urkunde von
lllll Dm Klipa n d I. von Österreich, besonders das
Phki®er Proklamation, die König
RIS Ve. , 1870 erließ, als er die französische
überschritt.
*
,,K*®fangreichen Katialog von fast 10 000 Num-
Tt.en« 1® und billige Bücher aus allen Wissen-
f'Ser hat unter Nr. 280 seiner Kataloge das
h-ti Antiquariat Bernh. Liebisch heraus-
Februar Nr, 6 vom 10, Februar 1929
,, der Durcharbeitung Gewicht gelegt,
icht sehr. ep^?rtet. da eine Fülle neuer Erkenntnisse
ist die .’f’linep Budwerken, die zum vertrauten Besitz der
, die an le'q g r n „n“ken-Sammlung gehören. Da erscheint
“n und LaV Götti armow-igur einer stehen-
f , „d s als riin1 Uil-v0.n w.ie&ands Vorgänger Kekule
hat un .rJtachtPt 6 o?.hoil;te seiner Erwerbungen mit Stolz
risches ‘Tnbar W- 15- mel, cl)arakterisiert die Figur, die
daß er ftildkals Aphrodite mit einer
1 vifl Fn4Se t z t «Tn V Snter ihrem etwas auf-
i V1C "'enio-pn" if U,ß e 6r?än'zt worden ist, als einen
h r e k I e l >etl , sen Reste origineller statuarischer Kunst.
1 auch f’fyer TT8 „ des 5- Jahrhunderts von einem Bild-
-h hei mallfbiupb s<-llaflen. der in Athen am Skulpturen-
ri- n I .V0)? Parthenon und Erechtheion auf der
etliche JA Wlis mitgearbeitet hat. — Und eine A p h r o ■
nd am StG8 q-J auch jene halblebensgroße Figur
n die *®chenv-u ‘.n 88 > die Originalarbeit eines grie-
liieht Künstlers., der wohl in Etrurien arbeitete.
, iKin a„„i!zu, lange nach Gebühr geschätzt wird in
r als die I e- “Uch der edle Frauenkopf, der ehemals
uarelle .jlt Kultstatue gehörte. Nach Blümels Urteil
lVlöTßen iwe!ner Zuweisung an die Kunst eines der
izvoiie PU d.« Meister ein genügender Anhalt. Und doch
fter und n U,, er Frauenkopf ein großes Kunstwerk vor
nd zeichnC'fCh61. 8 i?st einziger originaler Rest großer statu-
ziösen tv ’Jrlst des 4- Jahrhunderts von
Dir die Entwicklungsgeschichte grie-
Pine k unst,-
M de« A°n • rs stattliche Gruppe in dem neuen
t a h r „ i vUtiken-Kataloges nehmen die schönen
Ul ir t sr p; 1 e f s des 5- und des 4. Jahrhun-
rtchen * von ieuem Mädchen an, das aus einem
Gold sind 'bxena Vwas herausnehmen will, und von der
H a u o f m Men Ä , e,. ein. Figürchen in die Höhe hält, bis
«afrflhen ?*e‘lrfigurigen attischen Grabreliefs, die die
reue, J» Jtajt ues Abschiedes mit soviel vornehmer Ruhe
amburgs, 1 *■
dem Si*‘
Himmel J
uftigen Fat^. Zeitschriften
in. Haupt^- Zeitschrift „Belvedere“ enthält im ersten Heft
An gleich^jhen Jahrgangs eine Reihe von stiilkriti-
s Malers fiii„.7'* 1jIlz elunter suchungen. Hans
„..jt'äldp t-k den Nachweis, daß in einem Epitaph-
:ren ernt ! . tur Johannes Gens im Wiener DomheTren-
t a r p « Tk vom Meister des Albrecht-
ctolbmö11^ Von v?rIie8e’ dem Schöpfer des großen Flügel-
»SteilUD&hk 11 Klosterneuburg. — Wart Arslan glaubt das
• a t|S der ztaol° di Veneto um eine Madonna
Wircl i iirten ^nSa. del Clero. in Padua bereichern zu
Kunst a,,pig Suida lenkt die Aufmerksamkeit auf ein
die 400 DinU annfes Porträt von Tizian, ein Bildnis
6 dep01^^11 * Mons’or d’Aramont, welches kürzlich
Me. ^mpdung Trivulzio in Mailand erworben
Hör r röhlich - Bum sucht den „verwundeten
», frijJ venus“ aus der Londoner Wallace-Collec-
1 %rk 'a G i o r g i o n e zugesprochen, dann
Iteq w_.ues Sebastiano del Piombo angesehen, dem
it -.♦alM'fst,,1 Mr zurückzugeben. Endlich ergänzt Erwin
in-Mitm Bij*y die Untersuchungen Josef Müllers über
in haben Vt j *8 der Nürnberger Sebaldus-
ft liehe» b diesp durch Hinweis auf em weiteres Vorbild,
ildwerke zl1 «Unn-V® Untersuchungen werden durch gute Ab-
schreibung] n mustriert..
und die
ck angewiFi
len Kataloj-V Moderne Baukunst,
pitrßtl 3.S t
den Sk’1' Haiib^11 u a r h e f t von Wasmuths Monatsheften
oft beaftf11 stKUnsI bringt Aufsätze über: neue Bau-
Untersucli4r B " n,d W o h n u n g s p o 1 i t i k , S c h w e i -
ir attische Jh ® n z p ; + n 8 1 ’ £a M!1 0 n d ® r3 K °T 11! ‘
selbst früh«'' ’ s i t a te 11 u n g. W e 11 b e w e r b d e r U n i-
Währen»Plogradi.- Heidelberg. Das Heft, ist nut
wird hrinf-dK'estaf, ’s°hen Aufnahmen neuer Bauteil reich
us der kiffende v-' Mehrere von ihnen erreichen eine be-
sehen I5'- a®euen HPsUerische Höhe und geben der Dynamik
4 I a h r hlJsrs ei Baugedankens lebendigen Ausdruck. Be-
er nicht iihJkMgeVq Vb1l 8in? die Aufnahmen des M a g-
iedes Bildlchitol?+ ,1 Schlacht- und Viehhofes
iispnmsaale8lKs p s ,9öderitz) und des Breslauer Kauf-
S-immlungef^kiursa 'Architekt E. Mendelsohn). Der starke lie-
gt mit den F’ßt vo1®’ der in diesen Bauten gebannt ist,
ichen Sch«ffhter dl» vUr Wirkung, und erweckt bei dem Be-
ripKehP Auf« i vorstellun^ eines heransausenden Zuges,
t was (7,he!nah®6« der Neubauten aus Kaise?s-
’ beiden %kt- T? (Arehitekt: Hussong) und Zürich (Ar-
flern' HaefeW zeigen dagegen die dekorative Ruhe
ammlune fityäkkrwJ, icher. Wohnhäuser. Wie ein bizarrer
kurzer Zß’Jnischo„ springt der Ausstellungspavillon der
Stück hl1 Bn ^eitun'g förmlich aus dem Boden.
8 aus Mar»]. *
e s b ä r 11 *1
Diese c’er „ JaPar>ischer Ursprung
en und 11% nori|westamerikanischen Kunst?
lünm Vorzüglich illustrierten Januarheft der
w-, iil; kiii^.d Art“ stellt einer der tüchtigsten Kenner
1 bothp? der Nordwesit.-Amerikaner, L. Adam, eine
'enblick ii Se auf. die nicht ohne sensationellen Ein-
1S~1 ™Pe*, ra 111SK Er stellt etliche Masken der Kwa-
iftp dp« 5 JMh’p Mlda und Tlingit neben japa-
a B*t in6 aT a® k e m Eine gewisse Ähnlichkeit ist
nVpnapJ-'Afi r Zn« rede zu stellen. Ein allgemeiner kultu-
ckenden |lt üsammenhang läßt sich nicht leugnen, es be-
i«t mit lit-rJussna /!,'e äußere Möglichkeit eines direkten
. ”b man aber wirklich aus den immerhin
le Austu Analogien weitreichende Schlüsse ziehen
-■^'r, al man v°rläufig noch bezweifeln, um so
!lissm!s die stilkritische Vergleichung zu keinem
bt fmen Resultate in positivem Sinne führt.. Es
i^an n d°'.'b bei einer allgemeinen Analogie, aus
hetidp 2V6nigsten,s vorläufig, ebenso wenig weit-
’chim' “Ohlüsse ziehen kann, wie aus der Analogie
. dpr einer weetafrikanischen Maske der Balumbo
Gdpm a®. Schlüsse des Adamschen Aufsatzes ab-
ff Japanischen Kinderbild-Maske.
Die ,,attische Göttin *
In der ästhetisch wertenden Menschheit von
heute dämmert immer stärker die Einsicht auf,
dalj die primitiven Epochen des Kunst-
schaffens der Völker die höchsten sind. Die
Gesefee der Kunst — wir wissen, dafj es solche
geben muß, ohne sie zu kennen — scheinen
bei dem jugendlichen Volk einen reineren, un-
verdorbeneren und großartigen Ausdruck zu
finden. Das Intuitive, dem diese Kunst ent-
springt, wird später immer mehr durch die
Reflexion verdrängt, die langsam die primitive
Anschauung vergessen läßt. Die Sinnlichkeit
wird durch den Geist getötet. Die Kunst endet
schließlich schmählich im Akademischen. Die
griechische Kunst hat wie jede andere diesen
Weg durchgemacht. Vor ein paar Jahrzehnten
gab es nur wenige, die anderswo als in den
Hochkulfuren die Hauptleistungen des Kunst-
schaffens sahen. Die sogenannte primitive
Kunst galt nur als Vorbereitung für das, was
nachher gekommen ist. Noch vor etwa
150 Jahren konnte Lessing, einer der fein-
sinnigsten deutschen Köpfe, an der Hand eines
unbedeutenden, degenerierten Werkes des
späten Griechentums die Geseße der Plastik
den vielen anderen Dingen, die sie mir als
ein nichtantikes Werk erscheinen lassen, will
ich heute noch nicht reden. Aber rein an
dem anschaulichen Urteil ge-
messen, ist es doch ganz unmög-
lich, daß dasselbe Volk künst-
lerisch so hochwertige Dinge
einerseits und auf der anderen
Seite etwas so Minderwertiges
geschaffen hat wie diese Figur.
Es ist mir nicht möglich, mir vorzustellen, daß
es der Wissenschaft gelingen sollte, mich
davon zu überzeugen, daß diese Figur echt ist.
Ich kenne niemanden, vor dessen Urteil ich
Achtung habe, keinen Künstler, keinen Kunst-
historiker, keinen Kunsthändler, der, wenn er
audi nicht ein kategorisches „falsch“ aus-
gesprochen hat, nicht zumindest sein Be-
fremden über den ungriechischen und in jeder
Beziehung unantiken Ausdruck dieser Statue
gezeigt hat. Wenn die meisten von ihnen
auch nicht anders als durch das Mißbehagen,
das diese Figur in ihnen hervorruft, ihr Urteil
begründen können, so müßte die Zahl dieser
Gegner doch mindestens zu denken geben.
Die Feststellung stilkritischer Merkmale,
z. B. das archaisch weit geöffnete Auge, kann
nur dann zu einem Argument für die Echtheit
werden, wenn dieses Auge auch in seinen
übrigen Eigenschaften mit dem eines echten
Stückes übereinstimmt. Wenn dieses Auge
aber, wie das bei der attischen Göttin zu-
trifft, ohne Geist, Talent, Beobachtung, Ge-
schmack und Können gemacht ist, wenn es, wie
sich jeder nach unserer Abbildung überzeugen
kann, von ödester Leere und Ausdruckslosig-
keit ist, wird es uns nicht überzeugen, auch
wenn es noch so „archaisch" aufgerissen ist.
Selbst wenn die einzelnen Details in ihrer
äußeren Form viel mehr Übereinstimmung mit
bekannten Originalen zeigen würden, so müß-
ten wir doch durch die schematische, geistlose
Anordnung und Ausführung erkennen, daß sie
nichts mit der aus der Anschauung geborenen
Gestaltungskraft und mit der Meisterschaft der
frühgriechischen Künstler zu tun haben. Aber
ich gehe noch weiter. Selbst anatomische Feh-
ler lassen sich nicht mit Zirkel und Richtmaß
feststellen, auch sie müssen gefühlt werden.
Es ist zwar auffallend, daß z. B. die Beine der
Kopf einer Kore
von der Akropolis zu Athen
Töte de jeune fille
de VAcropole, Athenes
Die „attische Göttin“
Mädchen statue (Teil’anßicht)
von der Akropolis zu Athen
Statue de jeune fille (pattie)
de VAcropole, Athenes
in Form eines ästhetischen Glaubensbekennt-
nisses demonstrieren. Die Wissenschaft würde
wahrscheinlich heute noch auf einem ähnlichen
Standpunkt verharren, wenn nicht die Künstler
entdeckt hätten, daß die primitiven Leistungen
der kunstschaffenden Völker nicht nur eben-
bürtig mit dem Schaffen der Hochkulturen
sind, sondern sie vielleicht noch durch ihre Ur-
sprünglichkeit, ihre Sinnlichkeit und die Kraft
ihres Ausdrucks übertreffen. Es gibt wohl
kaum ein Volk, bei dem dies in so über-
zeugender Weise zutrifft, wie gerade das
griechische. Die plastischen Werke des grie-
chischen 6. Jahrhunderts können nur den be-
fremden, der sich von dem auf die Spätzeit
aufgebauten Kunstideal unserer Väter nicht
befreit hat.
Was die primitiven Statuen der Griechen
vor allem auszeichnet, ist ihre Eindrucksfähig-
keit und ihr sinnlicher Reiz. Ihre Götter-
statuen sind menschlicher als die Götter aller
anderen Völker. Die weiblichen Gottheiten
der frühen Griechen sind so entzückende Ge-
schöpfe, daß jeder dieses Volk um seinen
Olymp beneiden muß. Sie sind Mädchen aus
dem Volke, die in ihrer halbverdeckten Nackt-
heit, ihrer geschmackvollen Kleidung und
Wäsche, ihrem zierlichen Schmuck die Künstler
ihrer Zeit zu diesen Schöpfungen angeregt
haben. Selbst die primitivsten bekannten
Skulpturen der frühen Griechen tragen, ver-
glichen mit den Werken der Ägypter, der
Babylonier und Assyrier, alle Merkmale des
befreiten Menschentums, das den Grundzug
der griechischen Weltanschauung ausmacht.
*
Ich kehre jeßf wieder zu unserer attischen
Göttin zurück. Schon in meiner leßten Be-
sprechung habe ich hervorgehoben, daß die
attische Göttin in dem oben erwähnten Sinne
von allen mir bekannten Frauenstatuen des
6. Jahrhunderts abweicht.
Zu diesem Urteil bin ich nicht durch wissen-
schaftliche Studien, sondern rein durch die
Anschauung gelangt. Ich habe die attische
Göttin mit den frühen und frühesten grie-
chischen Bildwerken verglichen und gefunden,
daß sie mit Ausnahme einiger rein äußerlicher
Übereinstimmungen sich völlig von dem ent-
fernt, was die griechische Kunst uns in so
hohem Maße bietet. Es ist ganz ausge-
schlossen, daß ein plastisch so begabtes Volk
wie die Griechen, das im 6. Jahrhundert, also
in dem Jahrhundert, in dem die attische Göttin
auch entstanden sein soll, stilistisch und guali-
tativ so verschiedenartige Werke hervor-
gebracht haben soll, wie z. B. die beiden
attischen Figuren, deren Büsten ich heute im
Bilde zeige, und die strittige Figur der atti-
schen Göttin. Ich will vorläufig ganz von dem
Material absehen, aus dem unsere Attische
gemacht ist. Auch von ihrem Erhaltungszustand,
von ihrer Bemalung, von ihrer Patina und von
Es hat doch kein Mensch ein Interesse daran,
Figuren für falsch zu halten, die in unseren
Museen stehen. Wenn man es troßdem tut, so
muß doch eine greifbare Ursache dafür da
sein.
Im Grunde gibt es ja überhaupt keine Mög-
lichkeit, die Unechtheit eines Kunstgegen-
standes anders als durch sein Gefühl zu be-
weisen. Der Fall, der z. B. bei der Tiara des
Saitaphernes eingefroffen ist, wo sich der Fäl-
scher selbst gemeldet hat, ist sehr selten.
Ebenso wenig oft kommt es vor, daß man
einen Fälscher so gründlich kennen lernt, wie
den geschickten Dossena. Wenn man den Fa-
brikanten der falschen van Goghs nicht finden
und zum Geständnis bringen sollte, wird auch
hier ein Beweis für die Unechtheit dieser Bil-
der nur auf dem Wege der Anschauung zu
führen sein. — Physikalische und chemische
Hilfsmittel werden auch nur den überzeugen,
der schon vorher überzeugt war. — Genau so
geht es mit dem Beweis für die Echtheit der
Attischen. Nur liegt der Fall hier insofern ein
wenig anders, als man zur Bekräftigung seiner
Behauptung verschiedene andere Argumente,
u a. das der Provenienz, mit in die Wag-
schale werfen kann. Aber dieses Argument
wird nur überzeugen, wenn diese Provenienz
in einwandfreiester Weise beglaubigt ist. Es
ist übrigens durchaus nicht die Aufgabe derer,
die an der Göttin zweifeln, zu beweisen, daß
sie falsch ist, sondern die Aufgabe der Ge-
lehrten, die die Statue erworben haben, den
Nachweis zu bringen, daß sie echt ist. Jedoch
darf dieser Beweis nicht nach den bisher ge-
übten Methoden geführt werden.
Wenn heute jemand ein Bild malt, auf dem
irgendein Mann mit einem Turban drauf ist,
wenn er Rembrandtsches Clair obsceur ge-
schickt nachmacht und das Ganze mit einem
sogenannten Goldton versieht, kann man ein
solches Machwerk wegen einiger rein äußer-
licher Übereinstimmungen unmöglich deshalb
schon für einen echten Rembrandt halten.
Solche Bilder gibt es zu Tausenden, und nie-
mand gibt sich die Mühe, zu beweisen, daß
sie echt sind, mit Ausnahme vielleicht die
unglücklichen Besißer. Wenn Geheimrat Fried-
länder dieses oder jenes Bild für nicht echt
oder für eine Schülerarbeit erklärt, so sagt er
auch nicht, daß dieses oder jenes Merkmal mit
einem Meisterbild übereinstimmt, sondern, daß
dieses oder jenes nicht übereinstimmt. Wenn
man nicht die Eigenart des Meisters in dem
Werk sieht, nicht seine Hand, nicht sein Kön-
nen, so mögen die Teile, aus denen es auf-
gebaut ist, zehnmal dieselben sein, wie auf
einem Original, man wird doch niemals zu
einem die Echtheit bejahenden Urteil kommen.
Natürlich handelt es sich bei diesen Arbeiten,
besonders bei Schüler- oder Werkstaits-
arbeiten, oft um unwägbare Unterschiede, auf
die nur der jahre-, jahrzehntelang geschulte
Sinn reagiert.
„attischen“ Göttin um ein gutes Drittel kürzer
sind als die der anderen Statuen, aber diese
Verkürzung könnte durch die Proportionen des
Ganzen begründet sein und wäre damit kein
Argument gegen die Echtheit. Wir finden ein
solches bewußtes Verschieben der Körpermaße
in der Plastik fast aller primitiver Völker wie-
der, nur ist diese Tatsache dort in den Ge-
seßen der Plastik oder im Material begründet,
und das Abweichen von den natürlichen Pro-
portionen der Harmonie des Ganzen unterge-
ordnet. Dieser Fall trifft aber bei der Atti-
schen in keiner Weise zu. Es lag gar kein
Grund vor, gerade diese einzige Statue mit
so kurzen Beinen — die wir sonst nur bei der
griechischen Kleinplastik vorfinden — zu ver-
sehen. Was bei den Naturvölkern Zwang ist,
wirkt hier als störende Willkürlichkeit. Eben-
sowenig ist es zu verstehen, daß bei der
Göttin, die doch eine Frau sein soll, die weib-
lichen Geschlechtsmerkmale so vollkommen
unterdrückt sind. Selbst wenn man wissen-
schaftlich feststellen könnte, daß man aus be-
stimmten Gründen dieser Frau den Oberkörper
eines Mannes gegeben hat, daß man ihren Hals
in der unerguicklichsten Weise verlängert hat,
daß man sie mit einer Denkerstirn versehen
hat, um die ein Sokrates sie beneiden könnte,
daß sie von der oben erwähnten, im höchsten
Grade unerfreulichen Kurzbeinigkeit ist, daß
sie ein rundes Büchschen in der Hand zer-
drückt, das von der Wissenschaft allgemein als
Granatapfel gedeutet wird, daß sie ein Kostüm
an hat, das von einer Steifheit und Lang-
weiligkeit ist, die zum Himmel schreit, daß sie
auf dem Kopfe eine zylindrische unschöne
Müße hat, die die Disproportion des Ganzen
nur noch erhöht, selbst dann könnte keiner,
der mit offenen Augen die echte griechische
Plastik geschaut hat, dieses traurige Ensemble
für eine Arbeit der großartigen frühgriechi-
schen Bildhauer halten.
Wenn diese Figur echt wäre, so wäre das
nur ein Beweis dafür, und der einzige,
daß die im späteren VI. Jahrhundert hochbe-
gabten griechischen Bildhauer einige Jahrzehnte
vorher völlig talentlos waren. Daß dies nicht
wahr ist, weiß jeder, der sich mit der Kunst der
Völker beschäftigt hat. Der Weg, den die
Kunst der Griechen gegangen ist, liegt heute
klar vor uns. Abweichungen sind hier und
dort, wie bei jeder anderen Kunst, festzu-
stellen. Aber eine Abweichung von
der großen Linie, wie diese, kann
niemals irgendwo vorkommen. Die-
jenigen, die diese Göttin für echt halten, mögen
große archäologische Kenntnisse haben, aber
was zur Beurteilung von Kunst nötig ist, was
die Hauptvorbedingung dafür ist, geht ihnen
scheinbar ab. Denn sonst könnten sie
niemals dazu gekommen sein,
diese Statue für ein Werk der grie-
chisch-archaischen Kunst zu hal-
ten. WalterBondy