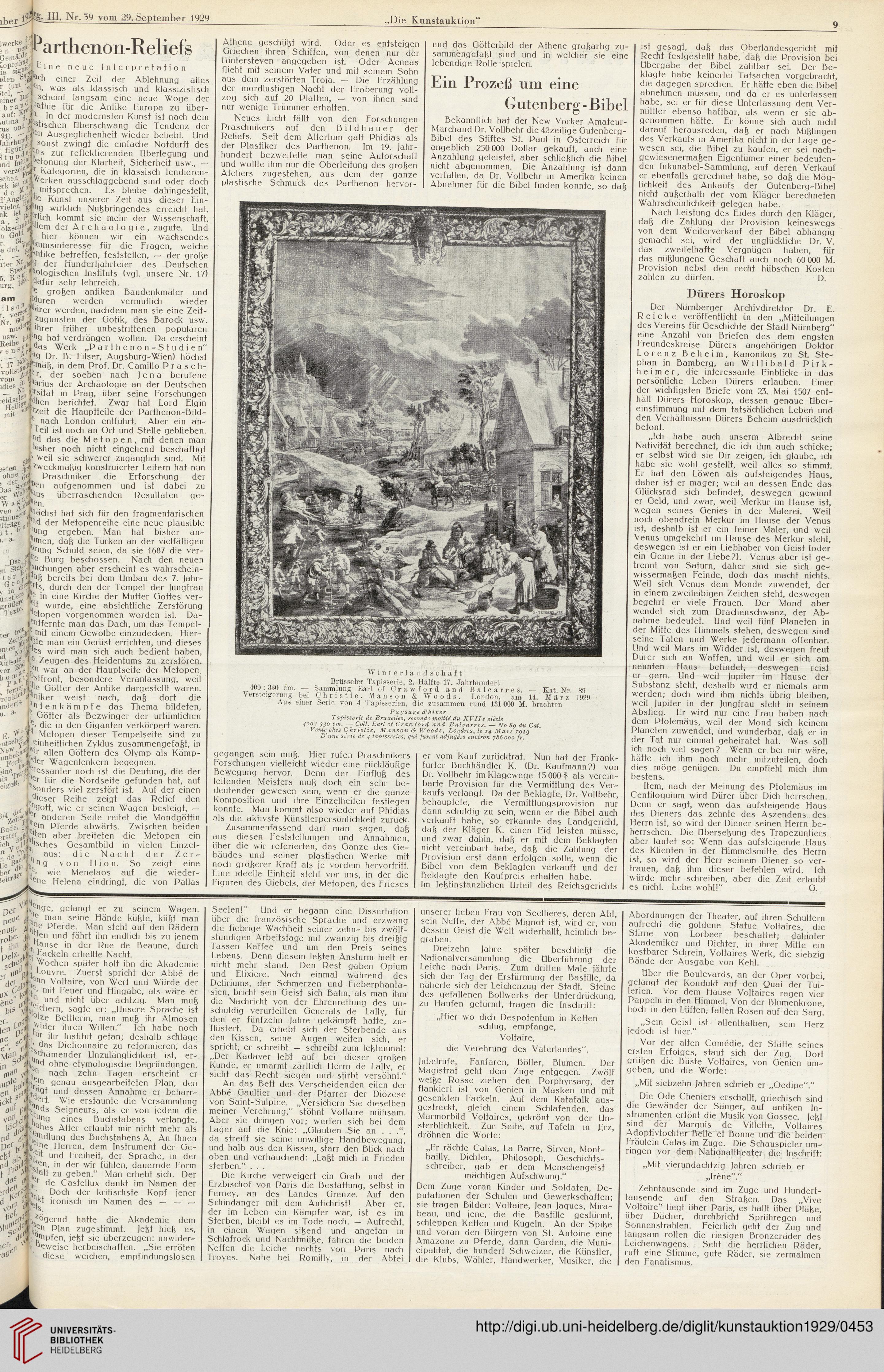„Die Kunstauktion"
9
ter
Zweckmäßig konstruierter Leitern hat
Praschniker die Erforschung
?en aufgenommen und ist dabei
überraschenden Resultaten
'e großen antiken Baudenkmäler und
sturen werden vermutlich wieder
der Zer-
zeigt eine
die wieder-
. Teil ist noch an Ort und Stelle geblieben.
’M das die Metopen, mit denen man
bisher noch nicht eingehend beschäftigt
Mit
nun
der
zu
ge-
17 f, d •
,eZögernd hatte die Akademie dem
[L.?n Plan zugestimmt. Jeßt hieß es,
V^kipfen, jeßt sie überzeugen: unwider-
beweise herbeischaffen. „Sie erröten
diese weichen, empfindungslosen
ihrer früher unbestrittenen populären
«sw. intF
^^(Adas Werk „Parthenon-Studien“
‘ e_- Dr. B. Filser, Augsburg-Wien) höchst
17 Sijif'-Hiäß, in dem Prof. Dr. Camillo Prasch-
vollsr^tkr> jer soeben nach Jena berufene
vonl M Farius der Archäologie an der Deutschen
- vJ?sität in Prag, über seine Forschungen
eiiS-i^iL^en berichtet. Zwar hat Lord Elgin
jnit ^fZeit die Hauptteile der Parthenon-Bild-
F nach London entführt. Aber ein an-
jste*1
ohne
> der
Jas
ven seeIUMchsi hat sich für den fragmentarischen
■iträg® t'd der Metopenreihe eine neue plausible
jt, 'rUng ergeben. Man hat bisher an-
i. a- Dmen, daß die Türken an der vielfältigen
prung Schuld seien, da sie 1687 die ver-
pas tfe Burg beschossen. Nach den neuen
jtn’’ StAlsUchungen aber erscheint es wahrschein-
& bereits bei dem Umbau des 7. Jahr-
G.' Odieii eds, durch den der Tempel der Jungfrau
Qnstl«tS Jp in eine Kirche der Mutter Gottes ver-
größ®^ wurde, eine absichtliche Zerstörung
Te« Mopen vorgenommen worden ist. Da-
Mfernte man das Dach, um das Tempel-
mr rn*t einem Gewölbe einzudecken. Hier-
Zß'jpMte man ein Gerüst errichten, und dieses
inteiSjJot^l! es wird man sich auch bedient haben,
äfs?’,! v Zeugen des Heidentums zu zerstören,
ver war an der Hauptseife der Metopen.
h o’JpiJDstfront, besondere Veranlassung, weil
fer»ftÄ'e Götter der Antike dargestellt waren.
’renh'1’.'^^hiker weist nach, daß dort die
mdertf 'Menkämpfe das Thema bildeten,
u. a' jr Götter als Bezwinger der urtümlichen
JA die in den Giganten verkörpert waren.
E- Ji Metopen dieser Tempelseite sind zu
einheitlichen Zyklus zusammengefaßt, in
Iifebehil,1j^r allen Göttern des Olymp als Kämp-
,u j’od'T'l '^er Wagenlenkern begegnen.
üneq,fjiwressanter noch ist die Deutung, die der
l’-s<r JL Ji r für die Nordseite gefunden hat, auf
eiSe ’ Fsonders viel zerstört ist. Auf der einen
dieser Reihe zeigt das Relief den
f ¥r,9°tt, wie er seinen Wagen besteigt, —
'* anderen Seite reitet die Mondgöttin
Bud®’ Swern Pferde abwärts. Zwischen beiden
jrs^f-Äi^n aber breiteten die Metopen ein
ich rhlj’’'sches Gesamtbild in vielen Einzel-
»ZotT aus: die Nacht
ließ?’« Vn 9 von Hion. So
bet V> wie Menelaos auf
!eiti',lr’ Ekrie Helena eindringt, die von Pallas
i —
ner’liv 9e> gelangt er zu seinem Wagen.
l‘e man seine Hände küßte, küßt man
'ud’ Pferde. Man steht auf den Rädern
'Iobe’ A pen und fahrt 'ha endlich bis zu jenem
I ih'1 akHause ’n der Rue de Beaune, durch
peP’ ßt*'.-' Packeln erhellte Nacht.
sd1Cli1 »Li Wochen später holt ihn die Akademie
t-ouvre. Zuerst spricht der Abbe de
def iwi^r'n Mohaire, von Wert und Würde der
x ,ni* Feuer und Hingabe, als wäre er
-ne‘fllk'h. und nicht über achtzig. Man muß
1,(5 uJLe*chern, sagte er: „Unsere Sprache ist
Bettlerin, man muß ihr Almosen
feil ^'4 f*ider ihren Willen.“ Ich habe noch
ne r ihr Institut getan; deshalb schlage
e“, fik" das Dictionnaire zu reformieren, das
Ma*1 |Pl Schämender Unzulänglichkeit ist, er-
in d ohne etymologische Begründungen.
nia11 nach zehn Tagen erscheint er
lUP^al'Tlr^1 9enau ausgearbeiteten Plan, den
et1 und dessen Annahme er beharr-
icld ? kuert. Wie erstaunte die Versammlung
a11 PW?ds Seigneurs, als er von jedem die
voK^li1!1 r üng eines Buchstabens verlangte.
läjäCf!k°hes Alter erlaubt mir nicht mehr als
pd Handlung des Buchstabens A. An Ihnen
Herren, dem Instrument der Ge-
eßl |5 und Freiheit, der Sprache, in der
ndAoCen> in der wir fühlen, dauernde Form
1 1r zu geben.“ Man erhebt sich. Der
da* de Castellux dankt im Namen der
■rd^f/^V Doch der kritischste Kopf jener
d jijV.ht ironisch im Namen des — — —
vör[ n m:
I
.!• Weil sie schwerer zugänglich sind,
tri >,-1 — i-„x—— i
-Wf
Wel’fDus
g’Wlf'r,
A“
iberjx^' Hl’ Nr. 39 vom 29. September 1929
^^Parthenon-Reliefs
eine neue Interpretation
«len ^jjjrh einer Zeit der Ablehnung alles
r |U^- ' | n’ was als klassisch und klassizistisch
einer Pj® scheint langsam eine neue Woge der
. b r a o jdMhie für die Antike Europa zu über-
aus Ej P- In der modernsten Kunst ist nach dem
,utin®nil ^HÜsctien Überschwang die Tendenz der
^4). -"jw'-11 Ausgeglichenheit wieder beliebt. Und
rahrh°S( sonst zwingt die einfache Notdurft des
' t'gn'il eijllls zur reflektierenden Überlegung und
tnrl'ln't>iretonung der Klarheit, Sicherheit usw., —
verze^"jj:f Kategorien, die in klassisch tendieren-
Werken ausschlaggebend sind oder doch
rnitsprcchen. Es bleibe dahingestellt,
i’AnÄr'e Kunst unserer Zeit aus dieser Ein-
viele»ijfPhg wirklich Nußbringendes erreicht hat.
^lem der Archäologie, zugute. Und
oi“ | hier können wir ein wachsendes
„• p pUmsinieresse für die Fragen, welche
j pätike betreffen, fesfstellen, — der große
l’ter Njjj« .9 der Hundertjahrfeier des Deutschen
SP® geologischen Instituts (vgl. unsere Nr. 17)
urg l)49ti l?®fär lehrreich-
am
i 18 <’^i>,l l'irer werden, nachdem man sie eine Zeit-
nZ iS Zugunsten der Gotik, des Barock usw.
1 moÜeM ihrer früher unbestrittenen populären
usw. jutPig hat verdrängen wollen. Da erscheint
jcj /-vi li P /la - -- ■ . rf-v ■ i ■ z/
r e .n6
in dem Prof. Dr. Camillo Prasch-
vollsr^tler, der soeben nach Jena berufene
Idies i” V^rius der Archäologie an der Deutschen
.Seifet in Prag, über seine Forschungen
Zwar hat Lord Elgin
i’Au<
* 1 '* ** i *v—r i 1 x ui) iiiivj v.i i vi v-o i— 11 iV/i ii livi i.
ck is w^rlich kommt sie mehr der Wissenschaft,
n G?l/
r- :
e den ä
\ _ <11
Athene geschüßt wird. Oder es entsteigen
Griechen ihren Schiffen, von denen nur der
Hintersteven angegeben ist. Oder Aeneas
flieht mit seinem Vater und mit seinem Sohn
aus dem zerstörten Troja. — Die Erzählung
der mordlustigen Nacht der Eroberung voll-
zog sich auf 20 Platten, — von ihnen sind
nur wenige Trümmer erhalten.
Neues Licht fällt von den Forschungen
Praschnikers auf den Bildhauer der
Reliefs. Seit dem Altertum galt Phidias als
der Plastiker des Parthenon. Im 19. Jahr-
hundert bezweifelte man seine Autorschaft
und wollte ihm nur die Oberleitung des großen
Ateliers zugestehen, aus dem der ganze
plastische Schmuck des Parthenon hervor-
und das Götterbild der Athene großartig zu-
sammengefaßt sind und in welcher sie eine
lebendige Rolle spielen.
Ein Prozeß um eine
Gutenberg - Bibel
Bekanntlich hat der New Yorker Amateur-
Marchand Dr. Vollbehr die 42zeilige Gutenberg-
Bibel des Stiftes St. Paul in Österreich für
angeblich 250 000 Dollar gekauft, auch eine
Anzahlung geleistet, aber schließlich die Bibel
nicht abgenommen. Die Anzahlung ist dann
verfallen, da Dr. Vollbehr in Amerika keinen
Abnehmer für die Bibel finden konnte, so daß
Winter land scliaft
Brüsseler Tapisserie, 2. Hälfte 17. Jahrhundert
400 : 330 cm. — Sammlung Earl of Crawf ord and Balcarres. — Kat. Nr. 89
Versteigerung bei Chris tie, Manson & Woods, London, am 14. März 1929
Aus einer Serie von 4 Tapisserien, die zusammen rund 131 000 M. brachten
Paysage d'hiver
Tapisserie de Bruxelles, second; moitit du XVIIe siecle
400 : 330 cm. — Coll. Earl of Crawford and Balcarres. — No 89 du Cat.
Vente chez C hristie, Manson & Woods, Londres, le 14 Mars 1929
D'une Serie de 4 tapisseries, qui furent adjugees environ 786000 fr.
gegangen sein muß. Hier rufen Praschnikers
Forschungen vielleicht wieder eine rückläufige
Bewegung hervor. Denn der Einfluß des
leitenden Meisters muß doch ein sehr be-
deutender gewesen sein, wenn er die ganze
Komposition und ihre Einzelheiten fesflegen
konnte. Man kommt also wieder auf Phidias
als die aktivste Künstlerpersönlichkeit zurück
Zusammenfassend darf man sagen, daß
aus diesen I?eststellungen und Annahmen,
über die wir referierten, das Ganze des Ge-
bäudes und seiner plastischen Werke mit
noch größerer Kraft als je vordem hervortritt.
Eine ideelle Einheit steht vor uns, in der die
Figuren des Giebels, der Metopen, des Frieses
er vom Kauf zurücktrat. Nun hat der Frank-
furter Buchhändler K. (Dr. Kaufmann?) von
Dr. Vollbehr im Klagewege 15 000$ als verein-
barte Provision für die Vermittlung des Ver-
kaufs verlangt. Da der Beklagte, Dr. Vollbehr,
behauptete, die Vermittlungsprovision nur
dann schuldig zu sein, wenn er die Bibel auch
verkauft habe, so erkannte das Landgericht,
daß der Kläger K. einen Eid leisten müsse,
und zwar dahin, daß er mit dem Beklagten
nicht vereinbart habe, daß die Zahlung der
Provision erst dann erfolgen solle, wenn die
Bibel von dem Beklagten verkauft und der
Beklagte den Kaufpreis erhalten habe.
Im leßtinstanzlichen Urteil des Reichsgerichts
ist gesagt, daß das Oberlandesgerichf mit
Recht festgestellt habe, daß die Provision bei
Übergabe der Bibel zahlbar sei. Der Be-
klagte habe keinerlei Tatsachen vorgebracht,
die dagegen sprechen. Er hätte eben die Bibel
abnehmen müssen, und da er es unterlassen
habe, sei er für diese Unterlassung dem Ver-
mittler ebenso haftbar, als wenn er sie ab-
genommen hätte. Er könne sich auch nicht
darauf herausreden, daß er nach Mißlingen
des Verkaufs in Amerika nicht in der Lage ge-
wesen sei, die Bibel zu kaufen, er sei nach-
gewiesenermaßen Eigentümer einer bedeuten-
den Inkunabel-Sammlung, auf deren Verkauf
er ebenfalls gerechnet habe, so daß die Mög-
lichkeit des Ankaufs der Gutenberg-Bibel
nicht außerhalb der vom Kläger berechneten
Wahrscheinlichkeit gelegen habe.
Nach Leistung des Eides durch den Kläger,
daß die Zahlung der Provision keineswegs
von dem Weiterverkauf der Bibel abhängig
gemacht sei, wird der unglückliche Dr. V.
das zweifelhafte Vergnügen haben, für
das mißlungene Geschäft auch noch 60 000 M.
Provision nebst den recht hübschen Kosten
zahlen zu dürfen. D.
Dürers Horoskop
Der Nürnberger Archivdirektor Dr. E.
Reicke veröffentlicht in den „Mitteilungen
des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg“
eine Anzahl von Briefen des dem engsten
Freundeskreise Dürers angehörigen Doktor
Lorenz Beheim, Kanonikus zu St. Ste-
phan in Bamberg, an Willibald Pirk-
heimer, die interessante Einblicke in das
persönliche Leben Dürers erlauben. Einer
der wichtigsten Briefe vom 23. Mai 1507 ent-
hält Dürers Horoskop, dessen genaue Über-
einstimmung mit dem tatsächlichen Leben und
den Verhältnissen Dürers Beheim ausdrücklich
betont.
„Ich habe auch unserm Albrecht seine
Nativität berechnet, die ich ihm auch schicke;
er selbst wird sie Dir zeigen, ich glaube, ich
habe sie wohl gestellt, weil alles so stimmt.
Er hat den Löwen als aufsteigendes Haus,
daher ist er mager; weil an dessen Ende das
Glücksrad sich befindet, deswegen gewinnt
er Geld, und zwar, weil Merkur im Hause ist,
wegen seines Genies in der Malerei. Weil
noch obendrein Merkur im Hause der Venus
ist, deshalb ist er ein feiner Maler, und weil
Venus umgekehrt im Hause des Merkur steht,
deswegen ist er ein Liebhaber von Geist (oder
ein Genie in der Liebe?). Venus aber ist ge-
trennt von Saturn, daher sind sie sich ge-
wissermaßen Feinde, doch das macht nichts.
Weil sich Venus dem Monde zuwendet, der
in einem zweileibigen Zeichen steht, deswegen
begehrt er viele Frauen. Der Mond aber
wendet sich zum Drachenschwanz, der Ab-
nahme bedeutet. Und weil fünf Planeten in
der Mitte des Himmels stehen, deswegen sind
seine Taten und Werke jedermann offenbar.
Und weil Mars im Widder ist, deswegen freut
Dürer sich an Waffen, und weil er sich am
neunten Haus befindet, deswegen reist
er gern. Und weil Jupiter im Hause der
Substanz steht, deshalb wird er niemals arm
werden; doch wird ihm nichts übrig bleiben,
weil Jupiter in der Jungfrau steht in seinem
Abstieg. Er wird nur eine Frau haben nach
dem Ptolemäus, weil der Mond sich keinem
Planeten zuwendet, und wunderbar, daß er in
der Tat nur einmal geheiratet hat. Was soll
ich noch viel sagen? Wenn er bei mir wäre,
hätte ich ihm noch mehr mitzuteilen, doch
dies möge genügen. Du empfiehl mich ihm
bestens.
Item, nach der Meinung des Ptolemäus im
Centiloguium wird Dürer über Dich herrschen.
Denn er sagt, wenn das aufsteigende Haus
des Dieners das zehnte des Aszendens des
Herrn ist, so wird der Diener seinen Herrn be-
herrschen. Die Uberseßung des Trapezuntiers
aber lautet so: Wenn das aufsteigende Haus
des Klienten in der Himmelsmitte des Herrn
ist, so wird der Herr seinem Diener so ver-
trauen, daß ihm dieser befehlen wird. Ich
würde mehr schreiben, aber die Zeit erlaubt
es nicht. Lebe wohl!“ G.
Seelen!“ Und er begann eine Dissertation
über die französische Sprache und erzwang
die fiebrige Wachheit seiner zehn- bis zwölf-
stündigen Arbeitstage mit zwanzig bis dreißig
Tassen Kaffee und um den Preis seines
Lebens. Denn diesem ießten Ansturm hielt er
nicht mehr stand. Den Rest gaben Opium
und Elixiere. Noch einmal während des
Deliriums, der Schmerzen und Fieberphanta-
sien, bricht sein Geist sich Bahn, als man ihm
die Nachricht von der Ehrenrettung des un-
schuldig verurteilten Generals de Lally, für
den er fünfzehn Jahre gekämpft hatte, zu-
flüstert. Da erhebt sich der Sterbende aus
den Kissen, seine Augen weiten sich, er
spricht, er schreibt — schreibt zum leßtenmal:
„Der Kadaver lebt auf bei dieser großen
Kunde, er umarmt zärtlich Herrn de La|ly, er
sieht das Recht siegen und stirbt versöhnt."
An das Bett des Verscheidenden eilen der
Abbe Gaultier und der Pfarrer der Diözese
von Saint-Sulpice. „Versichern Sie dieselben
meiner Verehrung,“ stöhnt Voltaire mühsam.
Aber sie dringen vor; werfen sich bei dem
Lager auf die Knie: „Glauben Sie an . . .“,
da streift sie seine unwillige Handbewegung,
und halb aus den Kissen, starr den Blick nach
oben und verhauchend: „Laßt mich in Frieden
sterben.“ . . .
Die Kirche verweigert ein Grab und der
Erzbischof von Paris die Bestattung, selbst in
Ferney, an des Landes Grenze. Auf den
Schindanger mit dem Antichrist! Aber er,
der im Leben ein Kämpfer war, ist es im
Sterben, bleibt es im Tode noch. — Aufrecht,
in einem Wagen sißend und angetan in
Schlafrock und Nachtmüße, fahren die beiden
Neffen die Leiche nachts von Paris nach
Troyes. Nahe bei Romilly, in der Abtei
unserer lieben Frau von Scellieres, deren Abt,
sein Neffe, der Abbe Mignot ist, wird er, von
dessen Geist die Welt widerhallt, heimlich be-
graben.
Dreizehn Jahre später beschließt die
Nationalversammlung die Überführung der
Leiche nach Paris. Zum dritten Male jährte
sich der Tag der Erstürmung der Bastille, da
näherte sich der Leichenzug der Stadt. Steine
des gefallenen Bollwerks der Unterdrückung,
zu Haufen getürmt, tragen die Inschrift:
„Hier wo dich Despotentum in Ketten
schlug, empfange,
Voltaire,
die Verehrung des Vaterlandes".
Jubelrufe, Fanfaren, Böller, Blumen. Der
Magistrat geht dem Zuge entgegen. Zwölf
weiße Rosse ziehen den Porphyrsarg, der
flankiert ist von Genien in Masken und mit
gesenkten Fackeln. Auf dem Katafalk aus-
gestreckt, gleich einem Schlafenden, das
Marmorbild Voltaires, gekrönt von der Un-
sterblichkeit. Zur Seite, auf Tafeln in Erz,
dröhnen die Worte:
„Er rächte Calas, La Barre, Sirven, Mont-
bailly. Dichter, Philosoph, Geschichts-
schreiber, gab er dem Menschengeist
mächtigen Aufschwung.“
Dem Zuge voran Kinder und Soldaten, De-
putationen der Schulen und Gewerkschaften;
sie tragen Bilder: Voltaire, Jean Jagues, Mira-
beau, und jene, die die Bastille gestürmt,
schleppen Ketten und Kugeln. An der Spiße
und voran den Bürgern von St. Antoine eine
Amazone zu Pferde, dann Garden, die Muni-
cipalität, die hundert Schweizer, die Künstler,
die Klubs, Wähler, Handwerker, Musiker, die
Abordnungen der Theater, auf ihren Schultern
aufrecht die goldene Statue Voltaires, die
Stirne von Lorbeer beschattet; dahinter
Akademiker und Dichter, in ihrer Mitie ein
kostbarer Schrein, Voltaires Werk, die siebzig
Bände der Ausgabe von Kehl.
über die Boulevards, an der Oper vorbei,
gelangt der Kondukt auf den Quai der Tui-
Ierien. Vor dem Hause Voltaires ragen vier
Pappeln in den Himmel. Von der Blumenkrone,
hoch in den Lüften, fallen Rosen auf den Sarg.
„Sein Geist ist allenthalben, sein Herz
jedoch ist hier.“
Vor der alten Comedie, der Stätte seines
ersten Erfolges, staut sich der Zug. Dort
grüßen die Büste Voltaires, von Genien um-
geben, und die Worte:
„Mit siebzehn Jahren schrieb er „Oedipe“.“
Die Ode Cheniers erschallt, griechisch sind
die Gewänder der Sänger, auf antiken In-
strumenten ertönt die Musik von Gossec. Jeßt
sind der Marguis de Villette, Voltaires
Adoptivtochter Belle et Bonne und die beiden
Fräulein Calas im Zuge. Die Schauspieler um-
ringen vor dem Nationaltheater die Inschrift:
„Mit vierundachtzig Jahren schrieb er
„Irene“."
Zehntausende sind im Zuge und Hundert-
tausende auf den Straßen. Das „Vive
Voltaire“ liegt über Paris, es hallt über Pläße,
über Dächer, durchbricht Sprühregen und
Sonnenstrahlen. Feierlich geht der Zug und
langsam rollen die riesigen Bronzeräder des
Leichenwagens. Seht die herrlichen Räder,
ruft eine Stimme, gute Räder, sie zermalmen
den Fanatismus.
9
ter
Zweckmäßig konstruierter Leitern hat
Praschniker die Erforschung
?en aufgenommen und ist dabei
überraschenden Resultaten
'e großen antiken Baudenkmäler und
sturen werden vermutlich wieder
der Zer-
zeigt eine
die wieder-
. Teil ist noch an Ort und Stelle geblieben.
’M das die Metopen, mit denen man
bisher noch nicht eingehend beschäftigt
Mit
nun
der
zu
ge-
17 f, d •
,eZögernd hatte die Akademie dem
[L.?n Plan zugestimmt. Jeßt hieß es,
V^kipfen, jeßt sie überzeugen: unwider-
beweise herbeischaffen. „Sie erröten
diese weichen, empfindungslosen
ihrer früher unbestrittenen populären
«sw. intF
^^(Adas Werk „Parthenon-Studien“
‘ e_- Dr. B. Filser, Augsburg-Wien) höchst
17 Sijif'-Hiäß, in dem Prof. Dr. Camillo Prasch-
vollsr^tkr> jer soeben nach Jena berufene
vonl M Farius der Archäologie an der Deutschen
- vJ?sität in Prag, über seine Forschungen
eiiS-i^iL^en berichtet. Zwar hat Lord Elgin
jnit ^fZeit die Hauptteile der Parthenon-Bild-
F nach London entführt. Aber ein an-
jste*1
ohne
> der
Jas
ven seeIUMchsi hat sich für den fragmentarischen
■iträg® t'd der Metopenreihe eine neue plausible
jt, 'rUng ergeben. Man hat bisher an-
i. a- Dmen, daß die Türken an der vielfältigen
prung Schuld seien, da sie 1687 die ver-
pas tfe Burg beschossen. Nach den neuen
jtn’’ StAlsUchungen aber erscheint es wahrschein-
& bereits bei dem Umbau des 7. Jahr-
G.' Odieii eds, durch den der Tempel der Jungfrau
Qnstl«tS Jp in eine Kirche der Mutter Gottes ver-
größ®^ wurde, eine absichtliche Zerstörung
Te« Mopen vorgenommen worden ist. Da-
Mfernte man das Dach, um das Tempel-
mr rn*t einem Gewölbe einzudecken. Hier-
Zß'jpMte man ein Gerüst errichten, und dieses
inteiSjJot^l! es wird man sich auch bedient haben,
äfs?’,! v Zeugen des Heidentums zu zerstören,
ver war an der Hauptseife der Metopen.
h o’JpiJDstfront, besondere Veranlassung, weil
fer»ftÄ'e Götter der Antike dargestellt waren.
’renh'1’.'^^hiker weist nach, daß dort die
mdertf 'Menkämpfe das Thema bildeten,
u. a' jr Götter als Bezwinger der urtümlichen
JA die in den Giganten verkörpert waren.
E- Ji Metopen dieser Tempelseite sind zu
einheitlichen Zyklus zusammengefaßt, in
Iifebehil,1j^r allen Göttern des Olymp als Kämp-
,u j’od'T'l '^er Wagenlenkern begegnen.
üneq,fjiwressanter noch ist die Deutung, die der
l’-s<r JL Ji r für die Nordseite gefunden hat, auf
eiSe ’ Fsonders viel zerstört ist. Auf der einen
dieser Reihe zeigt das Relief den
f ¥r,9°tt, wie er seinen Wagen besteigt, —
'* anderen Seite reitet die Mondgöttin
Bud®’ Swern Pferde abwärts. Zwischen beiden
jrs^f-Äi^n aber breiteten die Metopen ein
ich rhlj’’'sches Gesamtbild in vielen Einzel-
»ZotT aus: die Nacht
ließ?’« Vn 9 von Hion. So
bet V> wie Menelaos auf
!eiti',lr’ Ekrie Helena eindringt, die von Pallas
i —
ner’liv 9e> gelangt er zu seinem Wagen.
l‘e man seine Hände küßte, küßt man
'ud’ Pferde. Man steht auf den Rädern
'Iobe’ A pen und fahrt 'ha endlich bis zu jenem
I ih'1 akHause ’n der Rue de Beaune, durch
peP’ ßt*'.-' Packeln erhellte Nacht.
sd1Cli1 »Li Wochen später holt ihn die Akademie
t-ouvre. Zuerst spricht der Abbe de
def iwi^r'n Mohaire, von Wert und Würde der
x ,ni* Feuer und Hingabe, als wäre er
-ne‘fllk'h. und nicht über achtzig. Man muß
1,(5 uJLe*chern, sagte er: „Unsere Sprache ist
Bettlerin, man muß ihr Almosen
feil ^'4 f*ider ihren Willen.“ Ich habe noch
ne r ihr Institut getan; deshalb schlage
e“, fik" das Dictionnaire zu reformieren, das
Ma*1 |Pl Schämender Unzulänglichkeit ist, er-
in d ohne etymologische Begründungen.
nia11 nach zehn Tagen erscheint er
lUP^al'Tlr^1 9enau ausgearbeiteten Plan, den
et1 und dessen Annahme er beharr-
icld ? kuert. Wie erstaunte die Versammlung
a11 PW?ds Seigneurs, als er von jedem die
voK^li1!1 r üng eines Buchstabens verlangte.
läjäCf!k°hes Alter erlaubt mir nicht mehr als
pd Handlung des Buchstabens A. An Ihnen
Herren, dem Instrument der Ge-
eßl |5 und Freiheit, der Sprache, in der
ndAoCen> in der wir fühlen, dauernde Form
1 1r zu geben.“ Man erhebt sich. Der
da* de Castellux dankt im Namen der
■rd^f/^V Doch der kritischste Kopf jener
d jijV.ht ironisch im Namen des — — —
vör[ n m:
I
.!• Weil sie schwerer zugänglich sind,
tri >,-1 — i-„x—— i
-Wf
Wel’fDus
g’Wlf'r,
A“
iberjx^' Hl’ Nr. 39 vom 29. September 1929
^^Parthenon-Reliefs
eine neue Interpretation
«len ^jjjrh einer Zeit der Ablehnung alles
r |U^- ' | n’ was als klassisch und klassizistisch
einer Pj® scheint langsam eine neue Woge der
. b r a o jdMhie für die Antike Europa zu über-
aus Ej P- In der modernsten Kunst ist nach dem
,utin®nil ^HÜsctien Überschwang die Tendenz der
^4). -"jw'-11 Ausgeglichenheit wieder beliebt. Und
rahrh°S( sonst zwingt die einfache Notdurft des
' t'gn'il eijllls zur reflektierenden Überlegung und
tnrl'ln't>iretonung der Klarheit, Sicherheit usw., —
verze^"jj:f Kategorien, die in klassisch tendieren-
Werken ausschlaggebend sind oder doch
rnitsprcchen. Es bleibe dahingestellt,
i’AnÄr'e Kunst unserer Zeit aus dieser Ein-
viele»ijfPhg wirklich Nußbringendes erreicht hat.
^lem der Archäologie, zugute. Und
oi“ | hier können wir ein wachsendes
„• p pUmsinieresse für die Fragen, welche
j pätike betreffen, fesfstellen, — der große
l’ter Njjj« .9 der Hundertjahrfeier des Deutschen
SP® geologischen Instituts (vgl. unsere Nr. 17)
urg l)49ti l?®fär lehrreich-
am
i 18 <’^i>,l l'irer werden, nachdem man sie eine Zeit-
nZ iS Zugunsten der Gotik, des Barock usw.
1 moÜeM ihrer früher unbestrittenen populären
usw. jutPig hat verdrängen wollen. Da erscheint
jcj /-vi li P /la - -- ■ . rf-v ■ i ■ z/
r e .n6
in dem Prof. Dr. Camillo Prasch-
vollsr^tler, der soeben nach Jena berufene
Idies i” V^rius der Archäologie an der Deutschen
.Seifet in Prag, über seine Forschungen
Zwar hat Lord Elgin
i’Au<
* 1 '* ** i *v—r i 1 x ui) iiiivj v.i i vi v-o i— 11 iV/i ii livi i.
ck is w^rlich kommt sie mehr der Wissenschaft,
n G?l/
r- :
e den ä
\ _ <11
Athene geschüßt wird. Oder es entsteigen
Griechen ihren Schiffen, von denen nur der
Hintersteven angegeben ist. Oder Aeneas
flieht mit seinem Vater und mit seinem Sohn
aus dem zerstörten Troja. — Die Erzählung
der mordlustigen Nacht der Eroberung voll-
zog sich auf 20 Platten, — von ihnen sind
nur wenige Trümmer erhalten.
Neues Licht fällt von den Forschungen
Praschnikers auf den Bildhauer der
Reliefs. Seit dem Altertum galt Phidias als
der Plastiker des Parthenon. Im 19. Jahr-
hundert bezweifelte man seine Autorschaft
und wollte ihm nur die Oberleitung des großen
Ateliers zugestehen, aus dem der ganze
plastische Schmuck des Parthenon hervor-
und das Götterbild der Athene großartig zu-
sammengefaßt sind und in welcher sie eine
lebendige Rolle spielen.
Ein Prozeß um eine
Gutenberg - Bibel
Bekanntlich hat der New Yorker Amateur-
Marchand Dr. Vollbehr die 42zeilige Gutenberg-
Bibel des Stiftes St. Paul in Österreich für
angeblich 250 000 Dollar gekauft, auch eine
Anzahlung geleistet, aber schließlich die Bibel
nicht abgenommen. Die Anzahlung ist dann
verfallen, da Dr. Vollbehr in Amerika keinen
Abnehmer für die Bibel finden konnte, so daß
Winter land scliaft
Brüsseler Tapisserie, 2. Hälfte 17. Jahrhundert
400 : 330 cm. — Sammlung Earl of Crawf ord and Balcarres. — Kat. Nr. 89
Versteigerung bei Chris tie, Manson & Woods, London, am 14. März 1929
Aus einer Serie von 4 Tapisserien, die zusammen rund 131 000 M. brachten
Paysage d'hiver
Tapisserie de Bruxelles, second; moitit du XVIIe siecle
400 : 330 cm. — Coll. Earl of Crawford and Balcarres. — No 89 du Cat.
Vente chez C hristie, Manson & Woods, Londres, le 14 Mars 1929
D'une Serie de 4 tapisseries, qui furent adjugees environ 786000 fr.
gegangen sein muß. Hier rufen Praschnikers
Forschungen vielleicht wieder eine rückläufige
Bewegung hervor. Denn der Einfluß des
leitenden Meisters muß doch ein sehr be-
deutender gewesen sein, wenn er die ganze
Komposition und ihre Einzelheiten fesflegen
konnte. Man kommt also wieder auf Phidias
als die aktivste Künstlerpersönlichkeit zurück
Zusammenfassend darf man sagen, daß
aus diesen I?eststellungen und Annahmen,
über die wir referierten, das Ganze des Ge-
bäudes und seiner plastischen Werke mit
noch größerer Kraft als je vordem hervortritt.
Eine ideelle Einheit steht vor uns, in der die
Figuren des Giebels, der Metopen, des Frieses
er vom Kauf zurücktrat. Nun hat der Frank-
furter Buchhändler K. (Dr. Kaufmann?) von
Dr. Vollbehr im Klagewege 15 000$ als verein-
barte Provision für die Vermittlung des Ver-
kaufs verlangt. Da der Beklagte, Dr. Vollbehr,
behauptete, die Vermittlungsprovision nur
dann schuldig zu sein, wenn er die Bibel auch
verkauft habe, so erkannte das Landgericht,
daß der Kläger K. einen Eid leisten müsse,
und zwar dahin, daß er mit dem Beklagten
nicht vereinbart habe, daß die Zahlung der
Provision erst dann erfolgen solle, wenn die
Bibel von dem Beklagten verkauft und der
Beklagte den Kaufpreis erhalten habe.
Im leßtinstanzlichen Urteil des Reichsgerichts
ist gesagt, daß das Oberlandesgerichf mit
Recht festgestellt habe, daß die Provision bei
Übergabe der Bibel zahlbar sei. Der Be-
klagte habe keinerlei Tatsachen vorgebracht,
die dagegen sprechen. Er hätte eben die Bibel
abnehmen müssen, und da er es unterlassen
habe, sei er für diese Unterlassung dem Ver-
mittler ebenso haftbar, als wenn er sie ab-
genommen hätte. Er könne sich auch nicht
darauf herausreden, daß er nach Mißlingen
des Verkaufs in Amerika nicht in der Lage ge-
wesen sei, die Bibel zu kaufen, er sei nach-
gewiesenermaßen Eigentümer einer bedeuten-
den Inkunabel-Sammlung, auf deren Verkauf
er ebenfalls gerechnet habe, so daß die Mög-
lichkeit des Ankaufs der Gutenberg-Bibel
nicht außerhalb der vom Kläger berechneten
Wahrscheinlichkeit gelegen habe.
Nach Leistung des Eides durch den Kläger,
daß die Zahlung der Provision keineswegs
von dem Weiterverkauf der Bibel abhängig
gemacht sei, wird der unglückliche Dr. V.
das zweifelhafte Vergnügen haben, für
das mißlungene Geschäft auch noch 60 000 M.
Provision nebst den recht hübschen Kosten
zahlen zu dürfen. D.
Dürers Horoskop
Der Nürnberger Archivdirektor Dr. E.
Reicke veröffentlicht in den „Mitteilungen
des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg“
eine Anzahl von Briefen des dem engsten
Freundeskreise Dürers angehörigen Doktor
Lorenz Beheim, Kanonikus zu St. Ste-
phan in Bamberg, an Willibald Pirk-
heimer, die interessante Einblicke in das
persönliche Leben Dürers erlauben. Einer
der wichtigsten Briefe vom 23. Mai 1507 ent-
hält Dürers Horoskop, dessen genaue Über-
einstimmung mit dem tatsächlichen Leben und
den Verhältnissen Dürers Beheim ausdrücklich
betont.
„Ich habe auch unserm Albrecht seine
Nativität berechnet, die ich ihm auch schicke;
er selbst wird sie Dir zeigen, ich glaube, ich
habe sie wohl gestellt, weil alles so stimmt.
Er hat den Löwen als aufsteigendes Haus,
daher ist er mager; weil an dessen Ende das
Glücksrad sich befindet, deswegen gewinnt
er Geld, und zwar, weil Merkur im Hause ist,
wegen seines Genies in der Malerei. Weil
noch obendrein Merkur im Hause der Venus
ist, deshalb ist er ein feiner Maler, und weil
Venus umgekehrt im Hause des Merkur steht,
deswegen ist er ein Liebhaber von Geist (oder
ein Genie in der Liebe?). Venus aber ist ge-
trennt von Saturn, daher sind sie sich ge-
wissermaßen Feinde, doch das macht nichts.
Weil sich Venus dem Monde zuwendet, der
in einem zweileibigen Zeichen steht, deswegen
begehrt er viele Frauen. Der Mond aber
wendet sich zum Drachenschwanz, der Ab-
nahme bedeutet. Und weil fünf Planeten in
der Mitte des Himmels stehen, deswegen sind
seine Taten und Werke jedermann offenbar.
Und weil Mars im Widder ist, deswegen freut
Dürer sich an Waffen, und weil er sich am
neunten Haus befindet, deswegen reist
er gern. Und weil Jupiter im Hause der
Substanz steht, deshalb wird er niemals arm
werden; doch wird ihm nichts übrig bleiben,
weil Jupiter in der Jungfrau steht in seinem
Abstieg. Er wird nur eine Frau haben nach
dem Ptolemäus, weil der Mond sich keinem
Planeten zuwendet, und wunderbar, daß er in
der Tat nur einmal geheiratet hat. Was soll
ich noch viel sagen? Wenn er bei mir wäre,
hätte ich ihm noch mehr mitzuteilen, doch
dies möge genügen. Du empfiehl mich ihm
bestens.
Item, nach der Meinung des Ptolemäus im
Centiloguium wird Dürer über Dich herrschen.
Denn er sagt, wenn das aufsteigende Haus
des Dieners das zehnte des Aszendens des
Herrn ist, so wird der Diener seinen Herrn be-
herrschen. Die Uberseßung des Trapezuntiers
aber lautet so: Wenn das aufsteigende Haus
des Klienten in der Himmelsmitte des Herrn
ist, so wird der Herr seinem Diener so ver-
trauen, daß ihm dieser befehlen wird. Ich
würde mehr schreiben, aber die Zeit erlaubt
es nicht. Lebe wohl!“ G.
Seelen!“ Und er begann eine Dissertation
über die französische Sprache und erzwang
die fiebrige Wachheit seiner zehn- bis zwölf-
stündigen Arbeitstage mit zwanzig bis dreißig
Tassen Kaffee und um den Preis seines
Lebens. Denn diesem ießten Ansturm hielt er
nicht mehr stand. Den Rest gaben Opium
und Elixiere. Noch einmal während des
Deliriums, der Schmerzen und Fieberphanta-
sien, bricht sein Geist sich Bahn, als man ihm
die Nachricht von der Ehrenrettung des un-
schuldig verurteilten Generals de Lally, für
den er fünfzehn Jahre gekämpft hatte, zu-
flüstert. Da erhebt sich der Sterbende aus
den Kissen, seine Augen weiten sich, er
spricht, er schreibt — schreibt zum leßtenmal:
„Der Kadaver lebt auf bei dieser großen
Kunde, er umarmt zärtlich Herrn de La|ly, er
sieht das Recht siegen und stirbt versöhnt."
An das Bett des Verscheidenden eilen der
Abbe Gaultier und der Pfarrer der Diözese
von Saint-Sulpice. „Versichern Sie dieselben
meiner Verehrung,“ stöhnt Voltaire mühsam.
Aber sie dringen vor; werfen sich bei dem
Lager auf die Knie: „Glauben Sie an . . .“,
da streift sie seine unwillige Handbewegung,
und halb aus den Kissen, starr den Blick nach
oben und verhauchend: „Laßt mich in Frieden
sterben.“ . . .
Die Kirche verweigert ein Grab und der
Erzbischof von Paris die Bestattung, selbst in
Ferney, an des Landes Grenze. Auf den
Schindanger mit dem Antichrist! Aber er,
der im Leben ein Kämpfer war, ist es im
Sterben, bleibt es im Tode noch. — Aufrecht,
in einem Wagen sißend und angetan in
Schlafrock und Nachtmüße, fahren die beiden
Neffen die Leiche nachts von Paris nach
Troyes. Nahe bei Romilly, in der Abtei
unserer lieben Frau von Scellieres, deren Abt,
sein Neffe, der Abbe Mignot ist, wird er, von
dessen Geist die Welt widerhallt, heimlich be-
graben.
Dreizehn Jahre später beschließt die
Nationalversammlung die Überführung der
Leiche nach Paris. Zum dritten Male jährte
sich der Tag der Erstürmung der Bastille, da
näherte sich der Leichenzug der Stadt. Steine
des gefallenen Bollwerks der Unterdrückung,
zu Haufen getürmt, tragen die Inschrift:
„Hier wo dich Despotentum in Ketten
schlug, empfange,
Voltaire,
die Verehrung des Vaterlandes".
Jubelrufe, Fanfaren, Böller, Blumen. Der
Magistrat geht dem Zuge entgegen. Zwölf
weiße Rosse ziehen den Porphyrsarg, der
flankiert ist von Genien in Masken und mit
gesenkten Fackeln. Auf dem Katafalk aus-
gestreckt, gleich einem Schlafenden, das
Marmorbild Voltaires, gekrönt von der Un-
sterblichkeit. Zur Seite, auf Tafeln in Erz,
dröhnen die Worte:
„Er rächte Calas, La Barre, Sirven, Mont-
bailly. Dichter, Philosoph, Geschichts-
schreiber, gab er dem Menschengeist
mächtigen Aufschwung.“
Dem Zuge voran Kinder und Soldaten, De-
putationen der Schulen und Gewerkschaften;
sie tragen Bilder: Voltaire, Jean Jagues, Mira-
beau, und jene, die die Bastille gestürmt,
schleppen Ketten und Kugeln. An der Spiße
und voran den Bürgern von St. Antoine eine
Amazone zu Pferde, dann Garden, die Muni-
cipalität, die hundert Schweizer, die Künstler,
die Klubs, Wähler, Handwerker, Musiker, die
Abordnungen der Theater, auf ihren Schultern
aufrecht die goldene Statue Voltaires, die
Stirne von Lorbeer beschattet; dahinter
Akademiker und Dichter, in ihrer Mitie ein
kostbarer Schrein, Voltaires Werk, die siebzig
Bände der Ausgabe von Kehl.
über die Boulevards, an der Oper vorbei,
gelangt der Kondukt auf den Quai der Tui-
Ierien. Vor dem Hause Voltaires ragen vier
Pappeln in den Himmel. Von der Blumenkrone,
hoch in den Lüften, fallen Rosen auf den Sarg.
„Sein Geist ist allenthalben, sein Herz
jedoch ist hier.“
Vor der alten Comedie, der Stätte seines
ersten Erfolges, staut sich der Zug. Dort
grüßen die Büste Voltaires, von Genien um-
geben, und die Worte:
„Mit siebzehn Jahren schrieb er „Oedipe“.“
Die Ode Cheniers erschallt, griechisch sind
die Gewänder der Sänger, auf antiken In-
strumenten ertönt die Musik von Gossec. Jeßt
sind der Marguis de Villette, Voltaires
Adoptivtochter Belle et Bonne und die beiden
Fräulein Calas im Zuge. Die Schauspieler um-
ringen vor dem Nationaltheater die Inschrift:
„Mit vierundachtzig Jahren schrieb er
„Irene“."
Zehntausende sind im Zuge und Hundert-
tausende auf den Straßen. Das „Vive
Voltaire“ liegt über Paris, es hallt über Pläße,
über Dächer, durchbricht Sprühregen und
Sonnenstrahlen. Feierlich geht der Zug und
langsam rollen die riesigen Bronzeräder des
Leichenwagens. Seht die herrlichen Räder,
ruft eine Stimme, gute Räder, sie zermalmen
den Fanatismus.