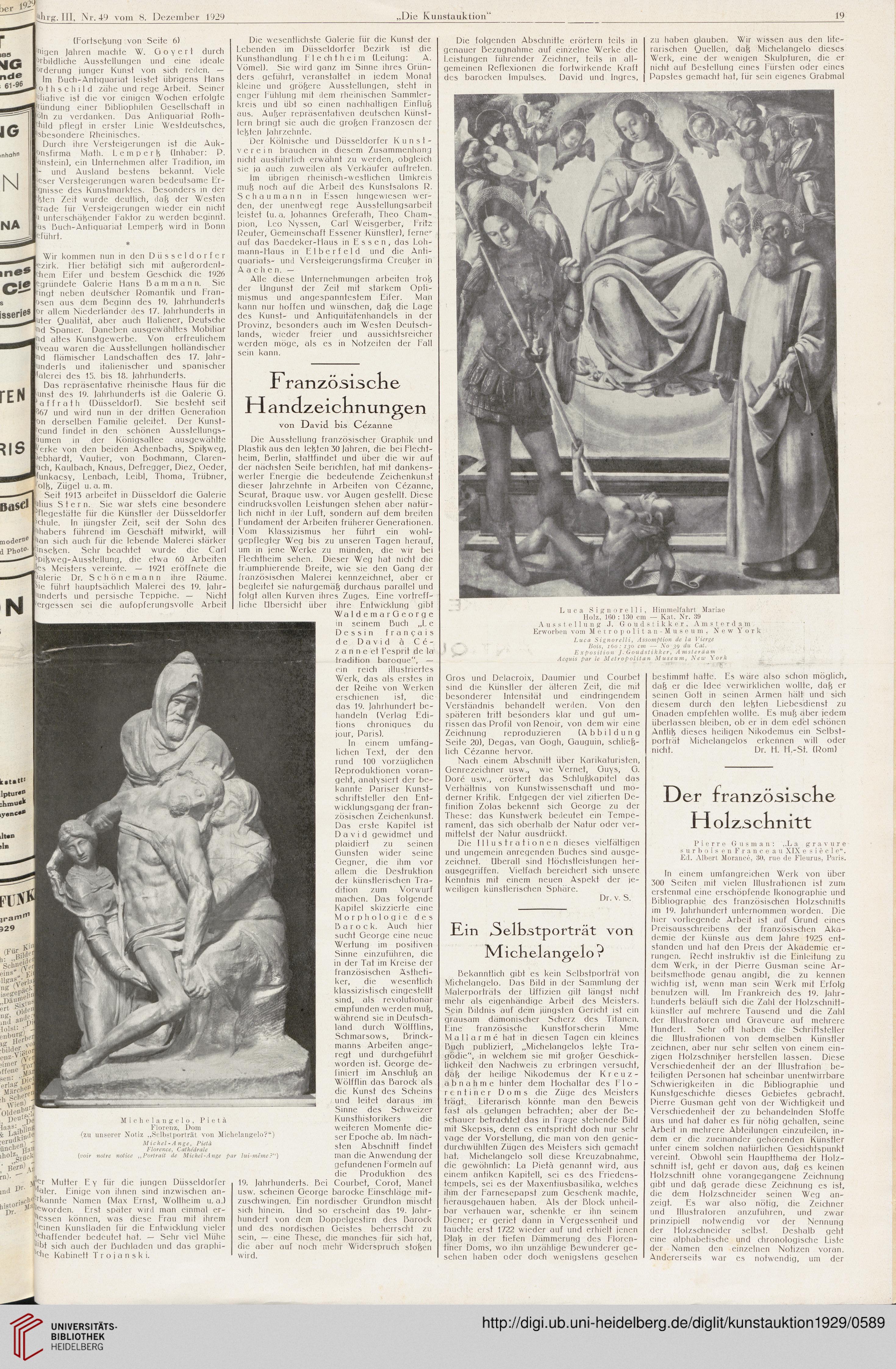.Die Kunstauktion“
19
1929
Die wesentlichste Galerie für die Kunst der
Lebenden im Düsseldorfer Bezirk ist die
Kunsthandlung Fl echt heim (Leitung: A.
Vömel). Sie wird ganz im Sinne ihres Grün-
ders geführt, veranstaltet in jedem Monat
kleine und größere Ausstellungen, steht in
enger Fühlung mit dem rheinischen Sammler-
kreis und übt so einen nachhaltigen Einflug
aus. Außer repräsentativen deutschen Künst-
lern bringt sie auch die großen Franzosen der
leisten Jahrzehnte.
Der Kölnische und Düsseldorfer Kunst-
verein brauchen in diesem Zusammenhang
nicht ausführlich erwähnt zu werden, obgleich
sie ja auch zuweilen als Verkäufer auftreten.
im übrigen rheinisch-westlichen Umkreis
muß noch auf die Arbeit des Kunstsalons R.
Schaumann in Essen hingewiesen wer-
den, der unentwegt rege Ausstellungsarbcit
leistet (u. a. Johannes Greferath, Theo Cham-
pion, Leo Nyssen, Carl Weisgerber, Fritz
Reuter, Gemeinschaft Essener Künstler), ferner
auf das Baedeker-Haus in Essen, das Loh-
mann-Haus in Elberfeld und die Anti-
quariats- und Versteigerungsfirma Creußer in
Aachen. —
Alle diese Unternehmungen arbeiten troß
der Ungunst der Zeit mit starkem Opti-
mismus und angespanntestem Eifer. Man
kann nur hoffen und wünschen, daß die Lage
des Kunst- und Antiquitätenhandels in der
Provinz, besonders auch im Westen Deutsch-
lands, wieder freier und aussichtsreicher
werden möge, als es in Notzeiten der Fall
sein kann.
F ranzösische
H andzeichnungen
von David bis Cezanne
Die Ausstellung französischer Graphik und
Plastik aus den leßten 30 Jahren, die bei Flecht-
heim, Berlin, stattfindet und über die wir auf
der nächsten Seite berichten, hat mit dankens-
werter Energie die bedeutende Zeichenkunsf
dieser Jahrzehnte in Arbeiten von Cezanne,
Seurat, Braque usw. vor Augen gestellt. Diese
eindrucksvollen Leistungen stehen aber natür-
lich nicht in der Luft, sondern auf dem breiten
Fundament der Arbeiten früherer Generationen.
Vom Klassizismus her führt ein wohl-
gepflegter Weg bis zu unseren Tagen herauf,
um in jene Werke zu münden, die wir bei
Flechtheim sehen. Dieser Weg hat nicht die
triumphierende Breite, wie sie den Gang der
französischen Malerei kennzeichnet, aber er
begleitet sie naturgemäß durchaus parallel und
folgt allen Kurven ihres Zuges. Eine vortreff-
liche Libersicht über ihre Entwicklung gibt
WaldemarGeorge
in seinem Buch „L e
Dessin franqais
de David ä Ce-
zanne et Tesprit de la
tradition barogue“, —
ein reich illustriertes
Werk, das als erstes in
der Reihe von Werken
erschienen ist, die-
das 19. Jahrhundert be-
handeln (Verlag Edi-
iions chroniques du
jour, Paris).
In einem umfäng-
lichen Text, der den
rund 100 vorzüglichen
Reproduktionen voran-
geht, analysiert der be-
kannte Pariser Kunst-
schriftsteller den Ent-
wicklungsgang der fran-
zösischen Zeichenkunst.
Das erste Kapitel ist
David gewidmet und
plaidiert zu seinen
Gunsten wider seine
Gegner, die ihm vor
allem die Destruktion
der künstlerischen Tra-
dition zum Vorwurf
machen. Das folgende
Kapitel skizzierte eine
Morphologie des
Barock. Auch hier
sucht George eine neue
Wertung im positiven
Sinne einzuführen, die
in der Tat im Kreise der
französischen Ästheti-
ker, die wesentlich
klassizistisch eingestellt
sind, als revolutionär
empfunden werden muß,
während sie in Deutsch-
land durch Wölfflins,
Schmarsows, Brinck-
manns Arbeiten ange-
regt und durchgeführt
worden ist. George de-
finiert im Anschluß an
Wölfflin das Barock als
die Kunst des Scheins
und leitet daraus im
Sinne des Schweizer
Kunsthistorikers die
weiteren Momente die-
ser Epoche ab. Im näch-
sten Abschnitt findet
man die Anwendung der
gefundenen Formeln auf
die Produktion des
19. Jahrhunderts. Bei Courbet, Corot, Manet
usw. scheinen George barocke Einschläge mit-
zuschwingen. Ein nordischer Grundton mischt
sich hinein. Und so erscheint das 19. Jahr-
hundert von dem Doppelgestirn des Barock
und des nordischen Geistes beherrscht zu
sein, — eine These, die manches für sich hat,
die aber auf noch mehr Widerspruch stoßen
wird.
Der Kunst¬
ausgewählte
Bas«1
modern®
d Phot0’
(Fortseßung von Seife 6)
'nigen Jahren machte W. G o y e r I durch
örbildliche Ausstellungen und eine ideale
örderung junger Kunst von sich reden. —
Im Buch-Antiquariat leistet übrigens Hans
othschild zähe und rege Arbeit. Seiner
'Hiative ist die vor einigen Wochen erfolgte
lfündung einer Bibliophilen Gesellschaft in
öln zu verdanken. Das Antiquariat Roth-
-hild pflegt in erster Linie Westdeutsches,
^besondere Rheinisches.
Durch ihre Versteigerungen ist die Auk-
onsfirma Math. Lemperß (Inhaber: P.
anstein), ein Unternehmen alter Tradition, im
>- und Ausland bestens bekannt. Viele
jeser Versteigerungen waren bedeutsame Er-
ignisse des Kunstmarkfes. Besonders in der
■bten Zeit wurde deutlich, daß der Westen
erade für Versteigerungen wieder ein nicht
H unterschäßender Faktor zu werden beginnt,
äs Buch-Antiquariat Lemperß wird in Bonn
eführt.
r
J8Ö
MG
nde
i 61-96
C!$
s
isserie8
*
Wir kommen nun in den Düsseldorfer
'ezirk. Hier betätigt sich mit außerordent-
diem Eifer und bestem Geschick die 1926
^gründete Galerie Hans B a m m a n n. Sie
Hngt neben deutscher Romantik und Fran-
Osen aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts
Or allem Niederländer des 17. Jahrhunderts in
ater Qualität, aber auch Italiener, Deutsche
lnd Spanier. Daneben ausgewähltes Mobiliar
dd altes Kunstgewerbe. Von erfreulichem
liveau waren die Ausstellungen holländischer
nd flämischer Landschaften des 17. Jahr-
Underts und italienischer und spanischer
Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts.
Das repräsentative rheinische Haus für die
>unst des 19. Jahrhunderts ist die Galerie G.
’affrath (Düsseldorf). Sie besteht seit
867 und wird nun in der dritten Generation
on derselben Familie geleitet.
reund findet in den schönen Ausstellungs-
humen in der Königsallee
J^erke von den beiden Achenbachs, Spißweg,
Jebhardf, Vaufier, von Bochmann, Claren-
äch, Kaulbach, Knaus, Defregger, Diez, Oeder,
funkaesy, Lenbach, Leibi, Thoma, Trübner,
l'olß, Zügel u. a. m.
Seit 1913 arbeitet in Düsseldorf die Galerie
ülius Stern. Sie war stets eine besondere
-flegestätte für die Künstler der Düsseldorfer
Nhule. In jüngster Zeit, seit der Sohn des
l|ihabers führend im Geschäft mitwirkt, will
bin sich auch für die lebende Malerei stärker
ünseßen. Sehr beachtet wurde die Carl
’Pißweg-Ausstellung, die etwa 60 Arbeiten
Jes Meisters vereinte. — 1921 eröffnete die
'jalerie Dr. Schönemann ihre Räume.
Üe führt hauptsächlich Malerei des 19. Jahr-
Nnderts und persische Teppiche. — Nicht
'ergessen sei die aufopferungsvolle Arbeit
k.t«»"
lptur«0
shmuok
lyenc»*
iltan
sin
rn?- •]
rfer Mutter Ey für die jungen Düsseldorfer
ind Pr' Maler. Einige von ihnen sind inzwischen an-
riscl’^kannte Namen (Max Ernst, Wollheim u. a.)
'’pr. ^T^worden. Erst später wird man einmal er-
messen können, was diese Frau mit ihrem
meinen Kunsiladen für die Entwicklung vieler
Schaffender bedeutet hat. — Sehr viel Mühe
’'bt sich auch der Buchladen und das graphi-
sche Kabinett Trojanski.
M ichelangelo. Pieta
Floren-*, Dom
(zu unserer Notiz „Selbstporträt von Michelangelo?“)
Michel-Ange, Pieta
Florence, Cathedrale
(voir notre notice ,,Portrait de Michel-Ange par lui-meme ?‘l)
Die folgenden Abschnitte erörtern teils in
genauer Bezugnahme auf einzelne Werke die
Leistungen führender Zeichner, teils in all-
gemeinen Reflexionen die fortwirkende Kraft
des barocken Impulses. David und Ingres,
zu haben glauben. Wir wissen aus den lite-
rarischen Quellen, daß Michelangelo dieses
Werk, eine der wenigen Skulpturen, die er
nicht auf Bestellung eines Fürsten oder eines
Papstes gemacht hat, für sein eigenes Grabmal
Luca S i g n o r e 11 i , Himmelfahrt Mariae
Holz, 160 : 130 cm — Kat. Nr. 39
Ausstellung J. Goudstikker, Amsterdam
Erworben vom Metropolitan-Museum, NewYork
Luca Signorelli, Assomption de la Vierge
Bois, i6o : 130 cm — No 39 die Cat.
Exposition J.Goudstikker, Amsterdam
Acquis par le Metropolitan Museum, New York
Gros und Delacroix, Daumier und Courbet
sind die Künstler der älteren Zeit, die mit
besonderer Intensität und eindringendem
Verständnis behandelt werden. Von den
späteren tritt besonders klar und gut um-
rissen das Profil von Renoir, von dem wir eine
Zeichnung reproduzieren (Abbildung
Seite 20), Degas, van Gogh, Gauguin, schließ-
lich Cezanne hervor.
Nach einem Abschnitt über Karikaturisten,
Genrezeichner usw., wie Vernet, Guys, G.
Dore usw., erörtert das Schlußkapitel das
Verhältnis von Kunstwissenschaft und mo-
derner Kritik. Entgegen der viel zitierten De-
finition Zolas bekennt sich George zu der
These: das Kunstwerk bedeutet ein Tempe-
rament, das sich oberhalb der Natur oder ver-
mittelst der Natur ausdrückt.
Die Illustrationen dieses vielfältigen
und ungemein anregenden Buches sind ausge-
zeichnet. Überall sind Höchstleistungen her-
ausgegriffen. Vielfach bereichert sich unsere
Kenntnis mit einem neuen Aspekt der je-
weiligen künstlerischen Sphäre.
Dr. v. S.
Ein 3elbstporträt von
Michelangelo ?
Bekanntlich gibt es kein Selbstporträt von
Michelangelo. Das Bild in der Sammlung der
Malerporträts der Uffizien gilt längst nicht
mehr als eigenhändige Arbeit des Meisters.
Sein Bildnis auf dem jüngsten Gericht ist ein
grausam dämonischer Scherz des Titanen.
Eine französische Kunstforscherin Mme
Ma 11 arme hat in diesen Tagen ein kleines
Buch publiziert, „Michelangelos leßte Tra-
gödie“, in welchem sie mit großer Geschick-
lichkeit den Nachweis zu erbringen versucht,
daß der heilige Nikodemus der Kreuz-
abnahme hinter dem Hochaltar des Flo-
rentiner Doms die Züge des Meisters
trägt:.. Literarisch könnte man den Beweis
fast als gelungen betrachten; aber der Be-
schauer betrachtet das in Frage stehende Bild
mit Skepsis, denn es entspricht doch nur sehr
vage der Vorstellung, die man von den genie-
durchwühlten Zügen des Meisters sich gemacht
hat. Michelangelo soll diese Kreuzabnahme,
die gewöhnlich: La Pieta genannt wird, aus
einem antiken Kapitell, sei es des Friedens-
tempels, sei es der Maxentiusbasilika, welches
ihm der Farnesepapst zum Geschenk machte,
heraüsgehauen haben. Als der Block unheil-
bar verhauen war, schenkte er ihn seinem
Diener; er geriet dann in Vergessenheit und
tauchte erst 1722 wieder auf und erhielt jenen
Plaß in der tiefen Dämmerung des Floren-
tiner Doms, Wo ihn unzählige Bewunderer ge-
sehen haben oder doch wenigstens gesehen
bestimmt hafte. Es wäre also schon möglich,
daß er die Idee verwirklichen wollte, daß er
seinen Gott in seinen Armen hält1 und sich
diesem durch den leßten Liebesdienst zu
Gnaden empfehlen wollte. Es muß aber jedem
überlassen bleiben, ob er in dem ed'el schönen
Antliß dieses heiligen Nikodemus ein Selbst-
porträt Michelangelos erkennen will oder
nicht. Dr. II. H.-St. (Rom)
D er französische
Holzschnitt
Pierre Gus man: „La gravure
■su rbois en France au XIX e s i e c 1 e“.
Ed. Albert Morance, 30, rue? de Fleurus, Paris.
In einem umfangreichen Werk von über
300 Seiten mit vielen Illustrationen ist zum
erstenmal eine erschöpfende Ikonographie und
Bibliographie des französischen Holzschnitts
im 19. Jahrhundert unternommen worden. Die
hier vorliegende Arbeit ist auf Grund eines
Preisausschreibens der französischen Aka-
demie der Künste aus dem Jahre 1925 ent-
standen und hat den Preis der Akademie er-
rungen. Recht instruktiv ist die Einleitung zu
dem Werk, in der Pierre Gusman seine Ar-
beitsmethode genau angibf, die zu kennen
wichtig ist, wenn man sein Werk mit Erfolg
benutzen will. Im Frankreich des 19. Jahr-
hunderts beläuft sich die Zahl der Holzschnitt-
künstler auf mehrere Tausend und die Zahl
der Illustratoren und Graveure auf mehrere
Hundert. Sehr oft haben die Schriftsteller
die Illustrationen von demselben Künstler
zeichnen, aber nur sehr selten von einem ein-
zigen Holzschnißer herstellen lassen. Diese
Verschiedenheit der an der Illustration be-
teiligten Personen hat scheinbar unentwirrbare
Schwierigkeiten in die Bibliographie und
Kunstgeschichte dieses Gebietes gebracht.
Pierre Gusman geht von der Wichtigkeit und
Verschiedenheit der zu behandelnden Stoffe
aus und hat daher es für nötig gehalten, seine
Arbeit in mehrere Abteilungen einzuteilen, in-
dem er die zueinander gehörenden Künstler
unter einem solchen natürlichen Gesichtspunkt
vereint. Obwohl sein Hauptthema der Holz-
schnitt ist, geht er davon aus, daß es keinen
Holzschnitt ohne vorangegangene Zeichnung
gibt und daß gerade diese Zeichnung es ist,
die dem Holzschneider seinen Weg an-
zeigt. Es war also nötig, die Zeichner
und Illustratoren anzuführen, und zwar
prinzipiell notwendig vor der Nennung
der Holzschneider selbst. Deshalb geht
eine alphabetische und chronologische Liste
der Namen den einzelnen Notizen voran.
Andererseits war es notwendig, um der
19
1929
Die wesentlichste Galerie für die Kunst der
Lebenden im Düsseldorfer Bezirk ist die
Kunsthandlung Fl echt heim (Leitung: A.
Vömel). Sie wird ganz im Sinne ihres Grün-
ders geführt, veranstaltet in jedem Monat
kleine und größere Ausstellungen, steht in
enger Fühlung mit dem rheinischen Sammler-
kreis und übt so einen nachhaltigen Einflug
aus. Außer repräsentativen deutschen Künst-
lern bringt sie auch die großen Franzosen der
leisten Jahrzehnte.
Der Kölnische und Düsseldorfer Kunst-
verein brauchen in diesem Zusammenhang
nicht ausführlich erwähnt zu werden, obgleich
sie ja auch zuweilen als Verkäufer auftreten.
im übrigen rheinisch-westlichen Umkreis
muß noch auf die Arbeit des Kunstsalons R.
Schaumann in Essen hingewiesen wer-
den, der unentwegt rege Ausstellungsarbcit
leistet (u. a. Johannes Greferath, Theo Cham-
pion, Leo Nyssen, Carl Weisgerber, Fritz
Reuter, Gemeinschaft Essener Künstler), ferner
auf das Baedeker-Haus in Essen, das Loh-
mann-Haus in Elberfeld und die Anti-
quariats- und Versteigerungsfirma Creußer in
Aachen. —
Alle diese Unternehmungen arbeiten troß
der Ungunst der Zeit mit starkem Opti-
mismus und angespanntestem Eifer. Man
kann nur hoffen und wünschen, daß die Lage
des Kunst- und Antiquitätenhandels in der
Provinz, besonders auch im Westen Deutsch-
lands, wieder freier und aussichtsreicher
werden möge, als es in Notzeiten der Fall
sein kann.
F ranzösische
H andzeichnungen
von David bis Cezanne
Die Ausstellung französischer Graphik und
Plastik aus den leßten 30 Jahren, die bei Flecht-
heim, Berlin, stattfindet und über die wir auf
der nächsten Seite berichten, hat mit dankens-
werter Energie die bedeutende Zeichenkunsf
dieser Jahrzehnte in Arbeiten von Cezanne,
Seurat, Braque usw. vor Augen gestellt. Diese
eindrucksvollen Leistungen stehen aber natür-
lich nicht in der Luft, sondern auf dem breiten
Fundament der Arbeiten früherer Generationen.
Vom Klassizismus her führt ein wohl-
gepflegter Weg bis zu unseren Tagen herauf,
um in jene Werke zu münden, die wir bei
Flechtheim sehen. Dieser Weg hat nicht die
triumphierende Breite, wie sie den Gang der
französischen Malerei kennzeichnet, aber er
begleitet sie naturgemäß durchaus parallel und
folgt allen Kurven ihres Zuges. Eine vortreff-
liche Libersicht über ihre Entwicklung gibt
WaldemarGeorge
in seinem Buch „L e
Dessin franqais
de David ä Ce-
zanne et Tesprit de la
tradition barogue“, —
ein reich illustriertes
Werk, das als erstes in
der Reihe von Werken
erschienen ist, die-
das 19. Jahrhundert be-
handeln (Verlag Edi-
iions chroniques du
jour, Paris).
In einem umfäng-
lichen Text, der den
rund 100 vorzüglichen
Reproduktionen voran-
geht, analysiert der be-
kannte Pariser Kunst-
schriftsteller den Ent-
wicklungsgang der fran-
zösischen Zeichenkunst.
Das erste Kapitel ist
David gewidmet und
plaidiert zu seinen
Gunsten wider seine
Gegner, die ihm vor
allem die Destruktion
der künstlerischen Tra-
dition zum Vorwurf
machen. Das folgende
Kapitel skizzierte eine
Morphologie des
Barock. Auch hier
sucht George eine neue
Wertung im positiven
Sinne einzuführen, die
in der Tat im Kreise der
französischen Ästheti-
ker, die wesentlich
klassizistisch eingestellt
sind, als revolutionär
empfunden werden muß,
während sie in Deutsch-
land durch Wölfflins,
Schmarsows, Brinck-
manns Arbeiten ange-
regt und durchgeführt
worden ist. George de-
finiert im Anschluß an
Wölfflin das Barock als
die Kunst des Scheins
und leitet daraus im
Sinne des Schweizer
Kunsthistorikers die
weiteren Momente die-
ser Epoche ab. Im näch-
sten Abschnitt findet
man die Anwendung der
gefundenen Formeln auf
die Produktion des
19. Jahrhunderts. Bei Courbet, Corot, Manet
usw. scheinen George barocke Einschläge mit-
zuschwingen. Ein nordischer Grundton mischt
sich hinein. Und so erscheint das 19. Jahr-
hundert von dem Doppelgestirn des Barock
und des nordischen Geistes beherrscht zu
sein, — eine These, die manches für sich hat,
die aber auf noch mehr Widerspruch stoßen
wird.
Der Kunst¬
ausgewählte
Bas«1
modern®
d Phot0’
(Fortseßung von Seife 6)
'nigen Jahren machte W. G o y e r I durch
örbildliche Ausstellungen und eine ideale
örderung junger Kunst von sich reden. —
Im Buch-Antiquariat leistet übrigens Hans
othschild zähe und rege Arbeit. Seiner
'Hiative ist die vor einigen Wochen erfolgte
lfündung einer Bibliophilen Gesellschaft in
öln zu verdanken. Das Antiquariat Roth-
-hild pflegt in erster Linie Westdeutsches,
^besondere Rheinisches.
Durch ihre Versteigerungen ist die Auk-
onsfirma Math. Lemperß (Inhaber: P.
anstein), ein Unternehmen alter Tradition, im
>- und Ausland bestens bekannt. Viele
jeser Versteigerungen waren bedeutsame Er-
ignisse des Kunstmarkfes. Besonders in der
■bten Zeit wurde deutlich, daß der Westen
erade für Versteigerungen wieder ein nicht
H unterschäßender Faktor zu werden beginnt,
äs Buch-Antiquariat Lemperß wird in Bonn
eführt.
r
J8Ö
MG
nde
i 61-96
C!$
s
isserie8
*
Wir kommen nun in den Düsseldorfer
'ezirk. Hier betätigt sich mit außerordent-
diem Eifer und bestem Geschick die 1926
^gründete Galerie Hans B a m m a n n. Sie
Hngt neben deutscher Romantik und Fran-
Osen aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts
Or allem Niederländer des 17. Jahrhunderts in
ater Qualität, aber auch Italiener, Deutsche
lnd Spanier. Daneben ausgewähltes Mobiliar
dd altes Kunstgewerbe. Von erfreulichem
liveau waren die Ausstellungen holländischer
nd flämischer Landschaften des 17. Jahr-
Underts und italienischer und spanischer
Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts.
Das repräsentative rheinische Haus für die
>unst des 19. Jahrhunderts ist die Galerie G.
’affrath (Düsseldorf). Sie besteht seit
867 und wird nun in der dritten Generation
on derselben Familie geleitet.
reund findet in den schönen Ausstellungs-
humen in der Königsallee
J^erke von den beiden Achenbachs, Spißweg,
Jebhardf, Vaufier, von Bochmann, Claren-
äch, Kaulbach, Knaus, Defregger, Diez, Oeder,
funkaesy, Lenbach, Leibi, Thoma, Trübner,
l'olß, Zügel u. a. m.
Seit 1913 arbeitet in Düsseldorf die Galerie
ülius Stern. Sie war stets eine besondere
-flegestätte für die Künstler der Düsseldorfer
Nhule. In jüngster Zeit, seit der Sohn des
l|ihabers führend im Geschäft mitwirkt, will
bin sich auch für die lebende Malerei stärker
ünseßen. Sehr beachtet wurde die Carl
’Pißweg-Ausstellung, die etwa 60 Arbeiten
Jes Meisters vereinte. — 1921 eröffnete die
'jalerie Dr. Schönemann ihre Räume.
Üe führt hauptsächlich Malerei des 19. Jahr-
Nnderts und persische Teppiche. — Nicht
'ergessen sei die aufopferungsvolle Arbeit
k.t«»"
lptur«0
shmuok
lyenc»*
iltan
sin
rn?- •]
rfer Mutter Ey für die jungen Düsseldorfer
ind Pr' Maler. Einige von ihnen sind inzwischen an-
riscl’^kannte Namen (Max Ernst, Wollheim u. a.)
'’pr. ^T^worden. Erst später wird man einmal er-
messen können, was diese Frau mit ihrem
meinen Kunsiladen für die Entwicklung vieler
Schaffender bedeutet hat. — Sehr viel Mühe
’'bt sich auch der Buchladen und das graphi-
sche Kabinett Trojanski.
M ichelangelo. Pieta
Floren-*, Dom
(zu unserer Notiz „Selbstporträt von Michelangelo?“)
Michel-Ange, Pieta
Florence, Cathedrale
(voir notre notice ,,Portrait de Michel-Ange par lui-meme ?‘l)
Die folgenden Abschnitte erörtern teils in
genauer Bezugnahme auf einzelne Werke die
Leistungen führender Zeichner, teils in all-
gemeinen Reflexionen die fortwirkende Kraft
des barocken Impulses. David und Ingres,
zu haben glauben. Wir wissen aus den lite-
rarischen Quellen, daß Michelangelo dieses
Werk, eine der wenigen Skulpturen, die er
nicht auf Bestellung eines Fürsten oder eines
Papstes gemacht hat, für sein eigenes Grabmal
Luca S i g n o r e 11 i , Himmelfahrt Mariae
Holz, 160 : 130 cm — Kat. Nr. 39
Ausstellung J. Goudstikker, Amsterdam
Erworben vom Metropolitan-Museum, NewYork
Luca Signorelli, Assomption de la Vierge
Bois, i6o : 130 cm — No 39 die Cat.
Exposition J.Goudstikker, Amsterdam
Acquis par le Metropolitan Museum, New York
Gros und Delacroix, Daumier und Courbet
sind die Künstler der älteren Zeit, die mit
besonderer Intensität und eindringendem
Verständnis behandelt werden. Von den
späteren tritt besonders klar und gut um-
rissen das Profil von Renoir, von dem wir eine
Zeichnung reproduzieren (Abbildung
Seite 20), Degas, van Gogh, Gauguin, schließ-
lich Cezanne hervor.
Nach einem Abschnitt über Karikaturisten,
Genrezeichner usw., wie Vernet, Guys, G.
Dore usw., erörtert das Schlußkapitel das
Verhältnis von Kunstwissenschaft und mo-
derner Kritik. Entgegen der viel zitierten De-
finition Zolas bekennt sich George zu der
These: das Kunstwerk bedeutet ein Tempe-
rament, das sich oberhalb der Natur oder ver-
mittelst der Natur ausdrückt.
Die Illustrationen dieses vielfältigen
und ungemein anregenden Buches sind ausge-
zeichnet. Überall sind Höchstleistungen her-
ausgegriffen. Vielfach bereichert sich unsere
Kenntnis mit einem neuen Aspekt der je-
weiligen künstlerischen Sphäre.
Dr. v. S.
Ein 3elbstporträt von
Michelangelo ?
Bekanntlich gibt es kein Selbstporträt von
Michelangelo. Das Bild in der Sammlung der
Malerporträts der Uffizien gilt längst nicht
mehr als eigenhändige Arbeit des Meisters.
Sein Bildnis auf dem jüngsten Gericht ist ein
grausam dämonischer Scherz des Titanen.
Eine französische Kunstforscherin Mme
Ma 11 arme hat in diesen Tagen ein kleines
Buch publiziert, „Michelangelos leßte Tra-
gödie“, in welchem sie mit großer Geschick-
lichkeit den Nachweis zu erbringen versucht,
daß der heilige Nikodemus der Kreuz-
abnahme hinter dem Hochaltar des Flo-
rentiner Doms die Züge des Meisters
trägt:.. Literarisch könnte man den Beweis
fast als gelungen betrachten; aber der Be-
schauer betrachtet das in Frage stehende Bild
mit Skepsis, denn es entspricht doch nur sehr
vage der Vorstellung, die man von den genie-
durchwühlten Zügen des Meisters sich gemacht
hat. Michelangelo soll diese Kreuzabnahme,
die gewöhnlich: La Pieta genannt wird, aus
einem antiken Kapitell, sei es des Friedens-
tempels, sei es der Maxentiusbasilika, welches
ihm der Farnesepapst zum Geschenk machte,
heraüsgehauen haben. Als der Block unheil-
bar verhauen war, schenkte er ihn seinem
Diener; er geriet dann in Vergessenheit und
tauchte erst 1722 wieder auf und erhielt jenen
Plaß in der tiefen Dämmerung des Floren-
tiner Doms, Wo ihn unzählige Bewunderer ge-
sehen haben oder doch wenigstens gesehen
bestimmt hafte. Es wäre also schon möglich,
daß er die Idee verwirklichen wollte, daß er
seinen Gott in seinen Armen hält1 und sich
diesem durch den leßten Liebesdienst zu
Gnaden empfehlen wollte. Es muß aber jedem
überlassen bleiben, ob er in dem ed'el schönen
Antliß dieses heiligen Nikodemus ein Selbst-
porträt Michelangelos erkennen will oder
nicht. Dr. II. H.-St. (Rom)
D er französische
Holzschnitt
Pierre Gus man: „La gravure
■su rbois en France au XIX e s i e c 1 e“.
Ed. Albert Morance, 30, rue? de Fleurus, Paris.
In einem umfangreichen Werk von über
300 Seiten mit vielen Illustrationen ist zum
erstenmal eine erschöpfende Ikonographie und
Bibliographie des französischen Holzschnitts
im 19. Jahrhundert unternommen worden. Die
hier vorliegende Arbeit ist auf Grund eines
Preisausschreibens der französischen Aka-
demie der Künste aus dem Jahre 1925 ent-
standen und hat den Preis der Akademie er-
rungen. Recht instruktiv ist die Einleitung zu
dem Werk, in der Pierre Gusman seine Ar-
beitsmethode genau angibf, die zu kennen
wichtig ist, wenn man sein Werk mit Erfolg
benutzen will. Im Frankreich des 19. Jahr-
hunderts beläuft sich die Zahl der Holzschnitt-
künstler auf mehrere Tausend und die Zahl
der Illustratoren und Graveure auf mehrere
Hundert. Sehr oft haben die Schriftsteller
die Illustrationen von demselben Künstler
zeichnen, aber nur sehr selten von einem ein-
zigen Holzschnißer herstellen lassen. Diese
Verschiedenheit der an der Illustration be-
teiligten Personen hat scheinbar unentwirrbare
Schwierigkeiten in die Bibliographie und
Kunstgeschichte dieses Gebietes gebracht.
Pierre Gusman geht von der Wichtigkeit und
Verschiedenheit der zu behandelnden Stoffe
aus und hat daher es für nötig gehalten, seine
Arbeit in mehrere Abteilungen einzuteilen, in-
dem er die zueinander gehörenden Künstler
unter einem solchen natürlichen Gesichtspunkt
vereint. Obwohl sein Hauptthema der Holz-
schnitt ist, geht er davon aus, daß es keinen
Holzschnitt ohne vorangegangene Zeichnung
gibt und daß gerade diese Zeichnung es ist,
die dem Holzschneider seinen Weg an-
zeigt. Es war also nötig, die Zeichner
und Illustratoren anzuführen, und zwar
prinzipiell notwendig vor der Nennung
der Holzschneider selbst. Deshalb geht
eine alphabetische und chronologische Liste
der Namen den einzelnen Notizen voran.
Andererseits war es notwendig, um der