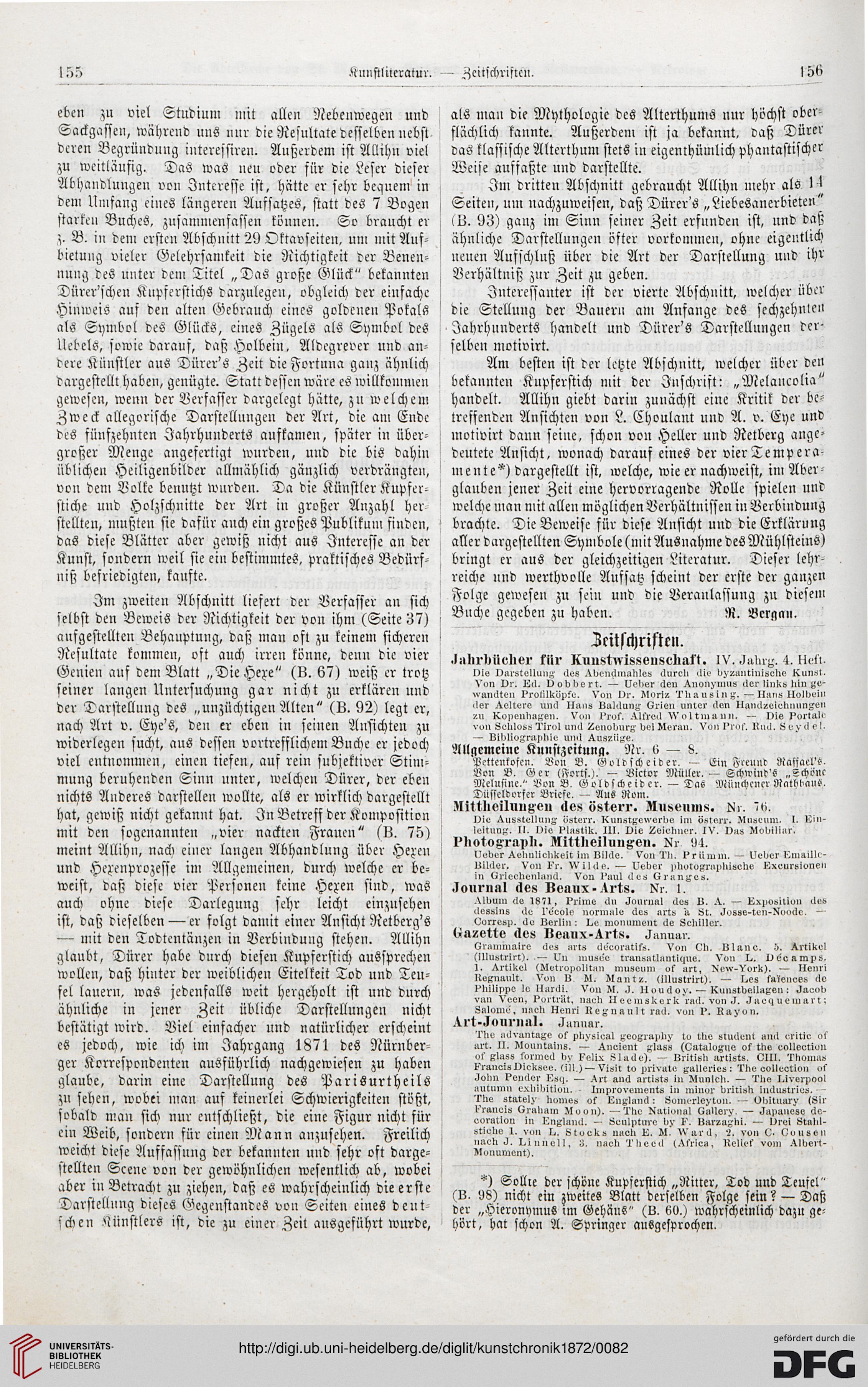>i»»s1lileratur. — Zeitschrisle».
155
eben zu viel Studium mit allen Nebenwegen und
Sackgassen, währcnd uns nur die Resultate desselbeu ucbst
dcren Begrüudung iuteressireu. Außerdem ist Allihu viel
zu wcitiaufig. Das was neu oder für die Leser dieser
Abhandlungen von Jnteresse ist, hätte er sehr beguem in
dem Umfang ciues längeren Aufsatzes, statt des 7 Bogen
starken Buches, zusammenfassen köuuen. So braucht er
z. B. i» dem ersteu Abschnitt 29 Oktavseiteu, um mit Auf-
bieluug vieler Gelehrsanikeit die Richtigkeit der Beneu-
uung des unter dcm Titel „Das groste Glllck" bekanntcn
Dürer'schen Kupferstichs darzulegeu, obgleich der einfachc
Hiuweis auf deu alteu Gebrauch eines goldcneu Pokals
als Symbol des Glücks, eines Zügels als Symbol des
llebels, sowie darauf, daß Holbein, Aldcgrever und an-
dere Künstler auS Dürer's Zeit die Fortuua ganz ähnlich
dargcstcllt haben, genügte. Statk dessen wäre es willkomiueii
gewesen, wenu der Berfasser dargelegt hälte, zu welchem
Zweck allegorische Darstelluugeu der Art, die am Endc
dcs füufzehnten Jahrhunderts aufkamen, später in über-
großer Mengc angefertigt wurden, uud die bis dahiu
üblichen Heiligenbilder allmählich gänzlich verdrängten,
von deni Bolke benntzt wurdeu. Da die Künstler Kupfer-
stiche und Holzschnitte der Art in großer Anzahl her
stellten, mußteu sie dafür anch cin großes Publikum sinden,
das diese Blätter aber gewiß nicht aus Jnteresse au der
Kunst, soudern weil sie ein bestimmtes, praklisches Bedürf-
uiß befriedigten, kaufte.
Jm zweiten Abschnitt liefert der Berfasser au sich
selbst den Bcweis der Nichtigkeit der von ihm (Seite 37)
aufgestelltcu Behauptung, daß mau ofl zu keinem sichercn
Resultatc kommeu, oft auch irreu könne, denu die vier
Genieu auf dem Blatt „Die Hexe" (ö. 67) weiß er trotz
seiner langen Untersuchung gar nicht zu erklären und
der Darstellung des „unzüchtigen Alten" (L. 92) legt er,
nach Art v. Eye's, den cr cben in seineu Ansichteu zu
widerlegeu sucht, aus dessen vortrefflicheni Buche er jedoch
viel eutnomuien, eineu tiefen, auf rein subjektiver Stim-
niung beruhenden Sinn unter, welcheu Dürer, der ebeu
nichts Anderes darstelleu wollte, als er wirklich dargestellt
hat, gewiß nicht gekannt hat. In Betresf der K'ompvsition
mit dcn sogeuannten „vier nacktcn Frauen" (H. 75)
meint Allih», nach einer laugen Abhandlung über Hexeu
und Hexenprozesse im Allgemcinen, durch welchc er be-
weist, daß diesc vier Personen keine Hexen sind, was
auch ohne diese Darlegung sehr leicht einzuschen
ist, daß dieselben — er folgt damit einer Ansicht Retberg's
-— mit den Todtcntänzen in Verbindung stehen. Allihn
glaubt, Dürer habe durch diesen Kupserstich aussprccheu
wolleu, daß hinter der weiblichen Eitelkeit Tod und Teu-
fel lauern, was jedenfalls weit hergeholt ist und durch
ähnliche in jener Zeit übliche Darstellungeu nicht
bestätigt wird. Biel einfacher und natürlicher erscheint
cs jedoch, wie ich im Jahrgang 1871 des Nüruber-
ger Korrespoudenten ausführlich nachgewiesen zu haben
glaube, dariu eine Darstellung des Parisurtheils
zu sehcn, wobci man auf keinerlei Schwierigkeiten stößt,
sobald man sich nur cutschließt, die eine Figur nicht für
cin Weib, sondern für einen Mann anzusehen. Freilich
weickt diese Auffassuug der bekanuten und sehr oft darge-
stellten Scene von der gewöhnlichen weseutlich ab, wobei
aber in Betracht zu ziehen, daß es wahrscheinlich die erste
Darstellung dieses Gegenstandes von Seiten eines dcut
sckien Kiinstlers ist, die zu einer Zeit anSgeführt wurde,
l 56
als uiau die Mythologie des Alterthums uur höchst ober
flächlich kannte. Außerdcni ist ja bekannt, daß Dürer
das klassische Alterthum stels iu eigenthümlich phautastischer
Weise auffaßte uud darstcllte.
Jm dritteu Abschnitt gcbraucht Allihn mehr als l >
Seiten, um nachzuweisen, daß Dürer's „Liebesanerbieten"
tr>. 93) gauz im Sinu seiner Zeit erfunden ist, und daß
ähnlichc Darstellungeu öfter vorkonilncu, ohne eigentlich
ueuen Ausschluß über die Art der Darstellung u»d ihr
Berhältuiß zur Zeit zu geben.
Jnteressauter ist der viertc Abschuitt, welcher über
die Stelluug der Bauern am Aufange des scchzehule»
Jahrhnnderts handelt und Dürer's Darstellungcn dci -
selben motivirt.
Am besten ist dcr letzte Abschuitt, welchcr über den
bekailnten Kupferstich mit der Juschrift: „Melaucolia"
handelt. Allihn giebt darin zuuächst eiuc Kritik der be-
tresfenden Ansichten von L. Choulant und A. v. Eye und
motivirt daun seiue, schon vou Heller uud Rctberg angc-
deutete Ansicht, wonach darauf eines ber vierTempera-
uiente*) dargestellt ist, welche, wie er nachweist, im Aber
glauben jeuer Zeit eine hervorragende Rolle spielen unt
welchc nian mit allen möglicheuBerhältnisseu in Berbindung
brachte. Die Beweise für diese Ansicht und die Erklärung
alkerdargestellteu Sylubole(mitAusuahmedesMühlsteins)
bringt er aus der gleichzeitigen Literalur. Dieser lehr-
reiche nnd werthvolle Aufsatz scheiut der crste der gauzen
Folge geivesen zu seiu und die Veraulassuug zu dicsei»
Buche gegebeu zu habeu. R. Bcraau.
Zcitschristk».
.liilirliiii'Iioi' l'iir Lnii8lavi88eii8<;Iiui>. I V.,4. Iloli
I)Ie OriiLt6!1uni>' <168 Vdendinadle8 sturoli stle d) rruntluiLLlie KunLt.
Von Vr. vst. voddert. — veder äen ^nottv»»>8 ster IInkü din ste-
^vanclten krotilküpfe. Von Or. IiIori2 'l'd a 118 in — vrn>8 Holdei»
ster ^.oitero und dlrr»8 Ladlunr; Orien unter den IlaiiclLeiedinin^en
xu Koiiendr>r;ott. Vo» vrof. .-^lfrecl ^Voltman». — vie vortale
von 8ed1oL8 st'lrol und ^enodurg' dei Llerau. Von I'rof. irud. 8 e>' cl e I.
Allaemciue Kiiiisizeituil». Nr. ti — 8.
Pettenkofcn. Bon B. Go'ldsch eid er. — Ein Freund Nafsael'e.
Von B. Ger (ssorts.). — Bictor Mütler. -- Schwind'S „Lchönc
Melusine." Von B. Goldscheid er. — Dae Mnnchcncr Nathdauö.
Düsseldorfer Briefe. — Aus Nom.
Hiltllviluiirxvii <I«8 <>8t«rr. Zlii8<;iiiii8. di>.
vle ^uLstelluug- Ü8terr. Kcmst^everde Ini Ü8torr. IVlu^euni. l. Li>>-
leitun^. II. Vie VIrl8tid. III. Oie ILoiedner. IV. Va8 ölodilirir.
I'iioboKriiiili. Alilllioiililirxeii. Hi !II.
.loiiriuil «iv8 Lvaiix- Irt«. Hr. I.
>>:i/i'II«' <io8 I!> >iix-.4rl^»n»»>.
1. 2VrtIko1 (Netropolitrni musouni ok rirt, dtovv-Vork). — Ileuri
Ile^nanlt. Von L. L1. IVlantlL. (Illustrlrt). — Vo8 faie»e68 clo
ddllis>x>6 le Ilriicli. Von kl. st. Ilouclo^. — I<un8tde>1ii86ii: daeod
vrin Veon, vorträt, nried Heein^kork racl. von ^aocjuemart;
8riIonie, nriod Ilenri lieLsnriult racl. von v. lirt^o n.
nril.
rirt. II. KIountain8. — ^noient ^Ia.88 (Oatalo^ue of tde eolleotion
ot' ßjlri88 forinecl d.v k'elix 81acle). — Lritmd arti8t8. Olll. 1?doniri8
Dranoi8viek8oe. (ill.) — Vi8it to inivato gallerie^ : 'I?de oolleotion of
stodn keiiclor Lr>cj. — Vrt aucl arti8t8 in ^lunied. — 'l'do laiverpool
I'ranoi8 Oradain No on). —'l'ko dlatioiial Oallerv- — dajiano8v äe-
ooration in Dnj;IrincI. — 8eu1pturo dv 1>'. Lar^a^di. — 1)roi 8tadl-
8tiedo 1. von v. 8took8 naod v. Ll. >VarcI, 2. von 0- Oou86»
naod ü. d.i iinoll, Z. naod 'l'deocl (^friea, Ilolief vom .Vldert-
IVIonuniont).
*) Sollie der schöne Kupfcrstich „Rilter, Tod und Teufcl"
(L. !)8) nicht ein zweites Blatt derselben Folge sein? — Daß
der „Hieronymus im GehäuS" (L. 6»,) wahrscheinlich dazu ge-
hört, hat schon A. Springer cmsgesprochen.
155
eben zu viel Studium mit allen Nebenwegen und
Sackgassen, währcnd uns nur die Resultate desselbeu ucbst
dcren Begrüudung iuteressireu. Außerdem ist Allihu viel
zu wcitiaufig. Das was neu oder für die Leser dieser
Abhandlungen von Jnteresse ist, hätte er sehr beguem in
dem Umfang ciues längeren Aufsatzes, statt des 7 Bogen
starken Buches, zusammenfassen köuuen. So braucht er
z. B. i» dem ersteu Abschnitt 29 Oktavseiteu, um mit Auf-
bieluug vieler Gelehrsanikeit die Richtigkeit der Beneu-
uung des unter dcm Titel „Das groste Glllck" bekanntcn
Dürer'schen Kupferstichs darzulegeu, obgleich der einfachc
Hiuweis auf deu alteu Gebrauch eines goldcneu Pokals
als Symbol des Glücks, eines Zügels als Symbol des
llebels, sowie darauf, daß Holbein, Aldcgrever und an-
dere Künstler auS Dürer's Zeit die Fortuua ganz ähnlich
dargcstcllt haben, genügte. Statk dessen wäre es willkomiueii
gewesen, wenu der Berfasser dargelegt hälte, zu welchem
Zweck allegorische Darstelluugeu der Art, die am Endc
dcs füufzehnten Jahrhunderts aufkamen, später in über-
großer Mengc angefertigt wurden, uud die bis dahiu
üblichen Heiligenbilder allmählich gänzlich verdrängten,
von deni Bolke benntzt wurdeu. Da die Künstler Kupfer-
stiche und Holzschnitte der Art in großer Anzahl her
stellten, mußteu sie dafür anch cin großes Publikum sinden,
das diese Blätter aber gewiß nicht aus Jnteresse au der
Kunst, soudern weil sie ein bestimmtes, praklisches Bedürf-
uiß befriedigten, kaufte.
Jm zweiten Abschnitt liefert der Berfasser au sich
selbst den Bcweis der Nichtigkeit der von ihm (Seite 37)
aufgestelltcu Behauptung, daß mau ofl zu keinem sichercn
Resultatc kommeu, oft auch irreu könne, denu die vier
Genieu auf dem Blatt „Die Hexe" (ö. 67) weiß er trotz
seiner langen Untersuchung gar nicht zu erklären und
der Darstellung des „unzüchtigen Alten" (L. 92) legt er,
nach Art v. Eye's, den cr cben in seineu Ansichteu zu
widerlegeu sucht, aus dessen vortrefflicheni Buche er jedoch
viel eutnomuien, eineu tiefen, auf rein subjektiver Stim-
niung beruhenden Sinn unter, welcheu Dürer, der ebeu
nichts Anderes darstelleu wollte, als er wirklich dargestellt
hat, gewiß nicht gekannt hat. In Betresf der K'ompvsition
mit dcn sogeuannten „vier nacktcn Frauen" (H. 75)
meint Allih», nach einer laugen Abhandlung über Hexeu
und Hexenprozesse im Allgemcinen, durch welchc er be-
weist, daß diesc vier Personen keine Hexen sind, was
auch ohne diese Darlegung sehr leicht einzuschen
ist, daß dieselben — er folgt damit einer Ansicht Retberg's
-— mit den Todtcntänzen in Verbindung stehen. Allihn
glaubt, Dürer habe durch diesen Kupserstich aussprccheu
wolleu, daß hinter der weiblichen Eitelkeit Tod und Teu-
fel lauern, was jedenfalls weit hergeholt ist und durch
ähnliche in jener Zeit übliche Darstellungeu nicht
bestätigt wird. Biel einfacher und natürlicher erscheint
cs jedoch, wie ich im Jahrgang 1871 des Nüruber-
ger Korrespoudenten ausführlich nachgewiesen zu haben
glaube, dariu eine Darstellung des Parisurtheils
zu sehcn, wobci man auf keinerlei Schwierigkeiten stößt,
sobald man sich nur cutschließt, die eine Figur nicht für
cin Weib, sondern für einen Mann anzusehen. Freilich
weickt diese Auffassuug der bekanuten und sehr oft darge-
stellten Scene von der gewöhnlichen weseutlich ab, wobei
aber in Betracht zu ziehen, daß es wahrscheinlich die erste
Darstellung dieses Gegenstandes von Seiten eines dcut
sckien Kiinstlers ist, die zu einer Zeit anSgeführt wurde,
l 56
als uiau die Mythologie des Alterthums uur höchst ober
flächlich kannte. Außerdcni ist ja bekannt, daß Dürer
das klassische Alterthum stels iu eigenthümlich phautastischer
Weise auffaßte uud darstcllte.
Jm dritteu Abschnitt gcbraucht Allihn mehr als l >
Seiten, um nachzuweisen, daß Dürer's „Liebesanerbieten"
tr>. 93) gauz im Sinu seiner Zeit erfunden ist, und daß
ähnlichc Darstellungeu öfter vorkonilncu, ohne eigentlich
ueuen Ausschluß über die Art der Darstellung u»d ihr
Berhältuiß zur Zeit zu geben.
Jnteressauter ist der viertc Abschuitt, welcher über
die Stelluug der Bauern am Aufange des scchzehule»
Jahrhnnderts handelt und Dürer's Darstellungcn dci -
selben motivirt.
Am besten ist dcr letzte Abschuitt, welchcr über den
bekailnten Kupferstich mit der Juschrift: „Melaucolia"
handelt. Allihn giebt darin zuuächst eiuc Kritik der be-
tresfenden Ansichten von L. Choulant und A. v. Eye und
motivirt daun seiue, schon vou Heller uud Rctberg angc-
deutete Ansicht, wonach darauf eines ber vierTempera-
uiente*) dargestellt ist, welche, wie er nachweist, im Aber
glauben jeuer Zeit eine hervorragende Rolle spielen unt
welchc nian mit allen möglicheuBerhältnisseu in Berbindung
brachte. Die Beweise für diese Ansicht und die Erklärung
alkerdargestellteu Sylubole(mitAusuahmedesMühlsteins)
bringt er aus der gleichzeitigen Literalur. Dieser lehr-
reiche nnd werthvolle Aufsatz scheiut der crste der gauzen
Folge geivesen zu seiu und die Veraulassuug zu dicsei»
Buche gegebeu zu habeu. R. Bcraau.
Zcitschristk».
.liilirliiii'Iioi' l'iir Lnii8lavi88eii8<;Iiui>. I V.,4. Iloli
I)Ie OriiLt6!1uni>' <168 Vdendinadle8 sturoli stle d) rruntluiLLlie KunLt.
Von Vr. vst. voddert. — veder äen ^nottv»»>8 ster IInkü din ste-
^vanclten krotilküpfe. Von Or. IiIori2 'l'd a 118 in — vrn>8 Holdei»
ster ^.oitero und dlrr»8 Ladlunr; Orien unter den IlaiiclLeiedinin^en
xu Koiiendr>r;ott. Vo» vrof. .-^lfrecl ^Voltman». — vie vortale
von 8ed1oL8 st'lrol und ^enodurg' dei Llerau. Von I'rof. irud. 8 e>' cl e I.
Allaemciue Kiiiisizeituil». Nr. ti — 8.
Pettenkofcn. Bon B. Go'ldsch eid er. — Ein Freund Nafsael'e.
Von B. Ger (ssorts.). — Bictor Mütler. -- Schwind'S „Lchönc
Melusine." Von B. Goldscheid er. — Dae Mnnchcncr Nathdauö.
Düsseldorfer Briefe. — Aus Nom.
Hiltllviluiirxvii <I«8 <>8t«rr. Zlii8<;iiiii8. di>.
vle ^uLstelluug- Ü8terr. Kcmst^everde Ini Ü8torr. IVlu^euni. l. Li>>-
leitun^. II. Vie VIrl8tid. III. Oie ILoiedner. IV. Va8 ölodilirir.
I'iioboKriiiili. Alilllioiililirxeii. Hi !II.
.loiiriuil «iv8 Lvaiix- Irt«. Hr. I.
>>:i/i'II«' <io8 I!> >iix-.4rl^»n»»>.
1. 2VrtIko1 (Netropolitrni musouni ok rirt, dtovv-Vork). — Ileuri
Ile^nanlt. Von L. L1. IVlantlL. (Illustrlrt). — Vo8 faie»e68 clo
ddllis>x>6 le Ilriicli. Von kl. st. Ilouclo^. — I<un8tde>1ii86ii: daeod
vrin Veon, vorträt, nried Heein^kork racl. von ^aocjuemart;
8riIonie, nriod Ilenri lieLsnriult racl. von v. lirt^o n.
nril.
rirt. II. KIountain8. — ^noient ^Ia.88 (Oatalo^ue of tde eolleotion
ot' ßjlri88 forinecl d.v k'elix 81acle). — Lritmd arti8t8. Olll. 1?doniri8
Dranoi8viek8oe. (ill.) — Vi8it to inivato gallerie^ : 'I?de oolleotion of
stodn keiiclor Lr>cj. — Vrt aucl arti8t8 in ^lunied. — 'l'do laiverpool
I'ranoi8 Oradain No on). —'l'ko dlatioiial Oallerv- — dajiano8v äe-
ooration in Dnj;IrincI. — 8eu1pturo dv 1>'. Lar^a^di. — 1)roi 8tadl-
8tiedo 1. von v. 8took8 naod v. Ll. >VarcI, 2. von 0- Oou86»
naod ü. d.i iinoll, Z. naod 'l'deocl (^friea, Ilolief vom .Vldert-
IVIonuniont).
*) Sollie der schöne Kupfcrstich „Rilter, Tod und Teufcl"
(L. !)8) nicht ein zweites Blatt derselben Folge sein? — Daß
der „Hieronymus im GehäuS" (L. 6»,) wahrscheinlich dazu ge-
hört, hat schon A. Springer cmsgesprochen.