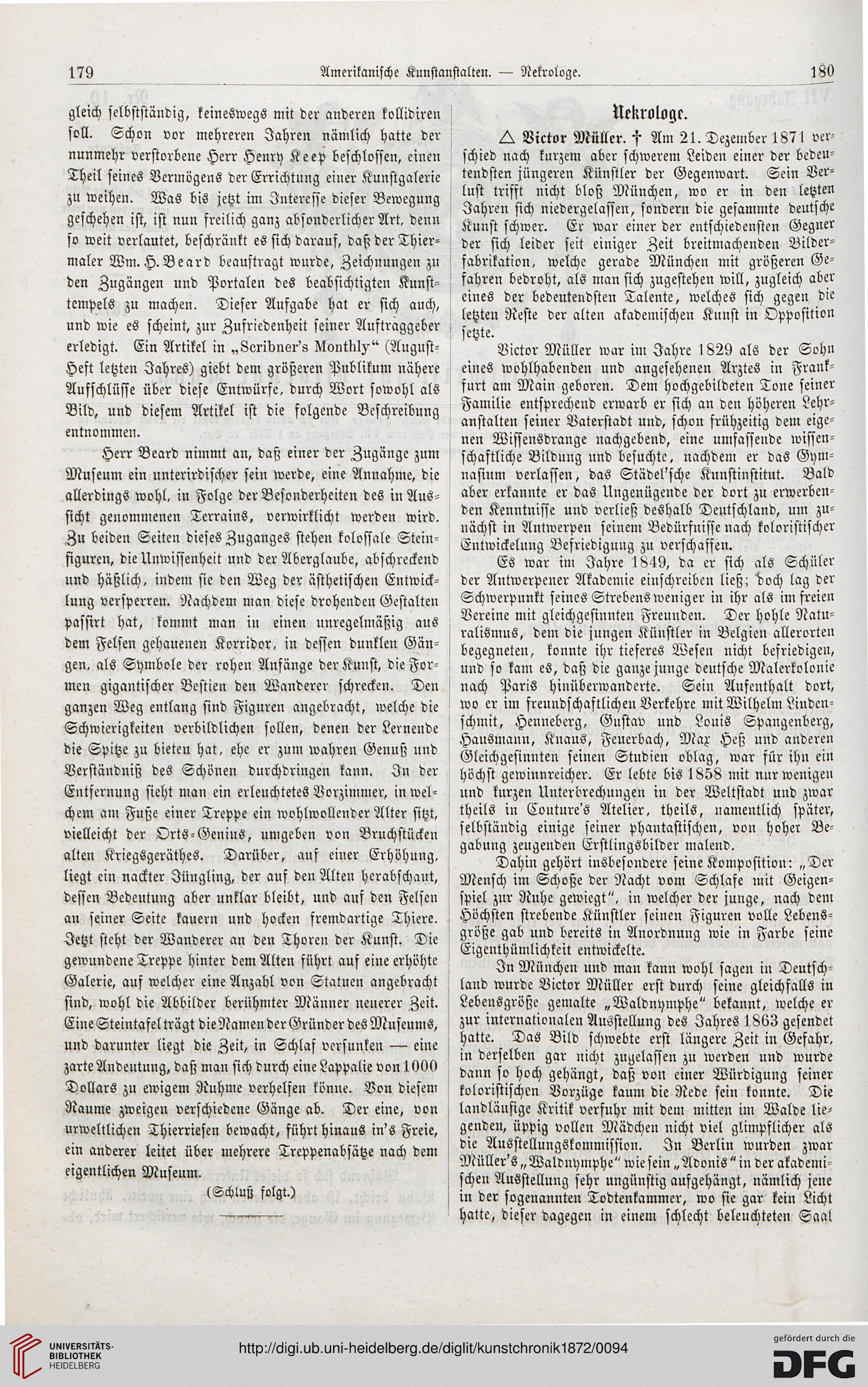179
Amerikanische Kunstanstalten. — Nekrologe.
180
gleich selbstständig, keineswegs mit der anderen kollidiren
soll. Schon vor mehreren Jahren nämlich hatte der
nnnmehr verstorbene Herr Henrh Keep beschlossen, einen
Theil seines Verinögens der Errichtung einer Kunstgalerie
zu weihen. Was bis jetzt im Jnteresse dieser Bewegung
geschehen ist, ist nun freilich ganz absonderlicher Art. denn
so weit verlautet, beschränkt es sich darauf, daß der Thier-
maler Wm. H.Beard beauftragt wurde, Zeichnungen zu
den Zugängen und Portaleu des beabsichtigten Kunst-
tcmpels zu machen. Dieser Aufgabe hat er sich auch,
und wie es scheint, zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber
erledigt. Ein Artikel in „Loridnsr's Nontlil^" (August-
Heft letzten Jahres) giebt dem größeren Publikum nähere
Aufschlüsse über diese Entwürfe, durch Wort sowohl als
Bild, und diesem Artikel ist die folgendc Beschreibung
entnommen.
Herr Beard nimmt an, daß einer der Zugänge zum
Muscum ein unterirdischer sein werde, eine Annahme, die
allerdings wohl, in Folge der Besonderheiten des in Aus-
sicht genommenen Terrains, verwirklicht werden wird.
Zu beiden Seiten dieses Zuganges stehen kolossale Stein-
figuren, die Unwissenheit und der Aberglaube, abschreckend
und häßlich, indem sie den Weg der ästhetischeu Entwick-
lung versperren. Nachdem man diese drohenden Gestalte»
passirt hat, kommt man iu einen unregelmäßig aus
dem Felsen gehauenen Korridor, in dessen dunklen Gän-
geu, als Symbole dcr rohen Anfänge der Kuust, die For-
men gigantischer Bestieu den Wanderer schrecken. Den
ganzen Weg entlang sind Figuren angebracht, welche die
Schwierigkeiten verbildlichen sollen, denen der Lernende
die Spitze zu bieten hat, ehe er zum wahren Genuß und
Verständniß des Schönen durchdringen kann. In der
Entfernung sieht man ein erleuchtetes Vorzimmer, in wel-
chem am Fuße einer Treppe ein wohlwollender Alter sitzt,
vielleicht der Orts-Genius, umgeben von Bruchstücken
alten Kriegsgeräthes. Darüber, auf einer Erhöhung,
liegt ein nackter Jüngling, der auf den Alten herabschaut,
dessen Bedeutung aber unklar bleibt, und anf den Felsen
an seiner Seite kauern und hocken fremdartige Thiere.
Jetzt steht der Wanderer an den Thoren der Kunst. Die
gewundene Treppe hinter dem Alten fllhrt auf eine erhöhte
Galerie, auf welcher eine Anzahl von Statuen angebracht
sind, wohl die Abbilder berühmter Männer nenerer Zeit.
EineSteintafelträgt dieNamenderGründerdesMuseums,
und darunter liegt die Zeit, in Schlaf versunken — eine
zarteAndeutung, daß man sich durch eine Lappalie von 1000
Dollars zu ewigem Ruhme verhelfen könne. Bon diesem
Nanme zweigeu verschiedene Gänge ab. Der eine, von
urweltlichen Thierriesen bewacht, führt hinaus in's Freie,
ein anderer leitet über mehrere Treppenabsätze nach dem
eigentlichen Museum.
(Schluß folgt.)
Nekrologe.
/X Victor Müller. P Am 21.Dezember 1871 ver-
schied nach kurzem aber schwerem Leiden einer der bedeu-
tendsten jüngeren Künstler der Gegenwart. Sein Ver-
lust trifft nicht bloß München, wo er in den letzten
Jahren sich niedergelassen, sondern die gesammte deutsche
Kunst schwer. Er war einer der entschiedensten Gegner
der sich leider seit einiger Zeit breitmachenden Bilder-
fabrikation, welche gerade München mit größeren Ge-
fahren bedroht, als man sich zugestehen will, zugleich aber
eines der bedeutendsten Talente, welches sich gegen die
letzten Reste der alten akademischeu Kunst in Opposition
setzte.
Bictor Müller war im Jahre 1829 als der Sohn
eines wohlhabenden und angesehenen Arztes in Frank-
furt am Main geboren. Dem hochgebildeten Tone seiner
Familie entsprechend erwarb er sich an den höheren Lehr-
anstalten seiner Vaterstadt und, schon frühzeitig dem eige-
nen Wissensdrange nachgebend, eine umfassende wissen-
schaftliche Bildung und besuchtc, nachdem er das Gym-
nasinm verlassen, das Städel'sche Kunstinstitut. Bald
aber erkannte er das Ungenügende der dort zu erwerben-
den Kenntnisse und verließ deshalb Deutschland, um zu-
nächst in Antwerpen seineni Bedürfnisse nach koloristischer
Entwickelung Befriediguug zu verschaffen.
Es war im Jahre 1849, da er sich als Schüler
der Antwerpener Akademie einschreiben ließ; ioch lag der
Schwerpunkt seines Strebens weniger in ihr als im freien
Vereine mit gleichgesinnten Freunden. Der hohle Natu-
ralismus, dem die jungen Künstler in Belgien allerorten
begegneten, konnte ihr tieferes Wesen nicht befriedigen,
und so kam es, daß die ganze junge deutsche Malerkolonie
nach Paris hinüberwanderte. Sein Aufenthalt dort,
wo er im freundschaftlichen Verkehre mit Wilhelm Linden-
schmit, Henneberg, Gustav und Louis Spangenberg,
Hausmann, Knaus, Feuerbach, Max Heß und anderen
Gleichgesinnten seinen Studien oblag, war für ihn eiu
höchst gewinnreicher. Er lebte bis 1858 mit nur wenigen
und kurzen Unterbrechungen in der Weltstadt und zwar
theils in Couture's Atelier, theils, namentlich später,
selbständig einige seiner phantastischen, von hoher Be-
gabung zeugenden Erstlingsbilder malend.
Dahin gehört insbesondere seine Komposition: „Der
Mensch im Schoße der Nacht vom Schlafe mit Geigen-
spiel zur Nnhe gewiegt", in welcher der junge, nach dem
Höchsten strebende Künstler scinen Figuren volle Lebens-
größe gab und bereits in Anordnung wie in Farbe seine
Eigenthümlichkeit entwickelte.
Jn München und man kann wohl sagen in Deutsch-
land wurde Victor Müller erst durch seine gleichfalls in
Lebensgröße gemalte „Waldnymphe" bekannt, welche er
zur internationalen Ausstellung des Jahres 1863 gesendet
hatte. Das Bild schwebte erst längere Zeit in Gefahr,
in derselben gar nicht zugelassen zu werden und wurde
dann so hoch gehangt, daß von eiuer Würdigung seiner
koloristischen Borzüge kaum die Rede sein konnte. Die
landläusige Kritik verfuhr mit deni mitten im Walde lie-
gendcn, üppig volleu Mädchen nicht viel glimpflicher als
die Ausstellungskommission. Jn Berlin wurden zwar
Müller's„Waldnymphe" wiesein „Adonis"in der akademi-
schen Ausstellung sehr ungünstig aufgehängt, nämlich jene
in der sogenannten Todtenkammer, wo sie gar kein Licht
hatte, dieser dagegen in einem schlecht beleuchteten Saal
Amerikanische Kunstanstalten. — Nekrologe.
180
gleich selbstständig, keineswegs mit der anderen kollidiren
soll. Schon vor mehreren Jahren nämlich hatte der
nnnmehr verstorbene Herr Henrh Keep beschlossen, einen
Theil seines Verinögens der Errichtung einer Kunstgalerie
zu weihen. Was bis jetzt im Jnteresse dieser Bewegung
geschehen ist, ist nun freilich ganz absonderlicher Art. denn
so weit verlautet, beschränkt es sich darauf, daß der Thier-
maler Wm. H.Beard beauftragt wurde, Zeichnungen zu
den Zugängen und Portaleu des beabsichtigten Kunst-
tcmpels zu machen. Dieser Aufgabe hat er sich auch,
und wie es scheint, zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber
erledigt. Ein Artikel in „Loridnsr's Nontlil^" (August-
Heft letzten Jahres) giebt dem größeren Publikum nähere
Aufschlüsse über diese Entwürfe, durch Wort sowohl als
Bild, und diesem Artikel ist die folgendc Beschreibung
entnommen.
Herr Beard nimmt an, daß einer der Zugänge zum
Muscum ein unterirdischer sein werde, eine Annahme, die
allerdings wohl, in Folge der Besonderheiten des in Aus-
sicht genommenen Terrains, verwirklicht werden wird.
Zu beiden Seiten dieses Zuganges stehen kolossale Stein-
figuren, die Unwissenheit und der Aberglaube, abschreckend
und häßlich, indem sie den Weg der ästhetischeu Entwick-
lung versperren. Nachdem man diese drohenden Gestalte»
passirt hat, kommt man iu einen unregelmäßig aus
dem Felsen gehauenen Korridor, in dessen dunklen Gän-
geu, als Symbole dcr rohen Anfänge der Kuust, die For-
men gigantischer Bestieu den Wanderer schrecken. Den
ganzen Weg entlang sind Figuren angebracht, welche die
Schwierigkeiten verbildlichen sollen, denen der Lernende
die Spitze zu bieten hat, ehe er zum wahren Genuß und
Verständniß des Schönen durchdringen kann. In der
Entfernung sieht man ein erleuchtetes Vorzimmer, in wel-
chem am Fuße einer Treppe ein wohlwollender Alter sitzt,
vielleicht der Orts-Genius, umgeben von Bruchstücken
alten Kriegsgeräthes. Darüber, auf einer Erhöhung,
liegt ein nackter Jüngling, der auf den Alten herabschaut,
dessen Bedeutung aber unklar bleibt, und anf den Felsen
an seiner Seite kauern und hocken fremdartige Thiere.
Jetzt steht der Wanderer an den Thoren der Kunst. Die
gewundene Treppe hinter dem Alten fllhrt auf eine erhöhte
Galerie, auf welcher eine Anzahl von Statuen angebracht
sind, wohl die Abbilder berühmter Männer nenerer Zeit.
EineSteintafelträgt dieNamenderGründerdesMuseums,
und darunter liegt die Zeit, in Schlaf versunken — eine
zarteAndeutung, daß man sich durch eine Lappalie von 1000
Dollars zu ewigem Ruhme verhelfen könne. Bon diesem
Nanme zweigeu verschiedene Gänge ab. Der eine, von
urweltlichen Thierriesen bewacht, führt hinaus in's Freie,
ein anderer leitet über mehrere Treppenabsätze nach dem
eigentlichen Museum.
(Schluß folgt.)
Nekrologe.
/X Victor Müller. P Am 21.Dezember 1871 ver-
schied nach kurzem aber schwerem Leiden einer der bedeu-
tendsten jüngeren Künstler der Gegenwart. Sein Ver-
lust trifft nicht bloß München, wo er in den letzten
Jahren sich niedergelassen, sondern die gesammte deutsche
Kunst schwer. Er war einer der entschiedensten Gegner
der sich leider seit einiger Zeit breitmachenden Bilder-
fabrikation, welche gerade München mit größeren Ge-
fahren bedroht, als man sich zugestehen will, zugleich aber
eines der bedeutendsten Talente, welches sich gegen die
letzten Reste der alten akademischeu Kunst in Opposition
setzte.
Bictor Müller war im Jahre 1829 als der Sohn
eines wohlhabenden und angesehenen Arztes in Frank-
furt am Main geboren. Dem hochgebildeten Tone seiner
Familie entsprechend erwarb er sich an den höheren Lehr-
anstalten seiner Vaterstadt und, schon frühzeitig dem eige-
nen Wissensdrange nachgebend, eine umfassende wissen-
schaftliche Bildung und besuchtc, nachdem er das Gym-
nasinm verlassen, das Städel'sche Kunstinstitut. Bald
aber erkannte er das Ungenügende der dort zu erwerben-
den Kenntnisse und verließ deshalb Deutschland, um zu-
nächst in Antwerpen seineni Bedürfnisse nach koloristischer
Entwickelung Befriediguug zu verschaffen.
Es war im Jahre 1849, da er sich als Schüler
der Antwerpener Akademie einschreiben ließ; ioch lag der
Schwerpunkt seines Strebens weniger in ihr als im freien
Vereine mit gleichgesinnten Freunden. Der hohle Natu-
ralismus, dem die jungen Künstler in Belgien allerorten
begegneten, konnte ihr tieferes Wesen nicht befriedigen,
und so kam es, daß die ganze junge deutsche Malerkolonie
nach Paris hinüberwanderte. Sein Aufenthalt dort,
wo er im freundschaftlichen Verkehre mit Wilhelm Linden-
schmit, Henneberg, Gustav und Louis Spangenberg,
Hausmann, Knaus, Feuerbach, Max Heß und anderen
Gleichgesinnten seinen Studien oblag, war für ihn eiu
höchst gewinnreicher. Er lebte bis 1858 mit nur wenigen
und kurzen Unterbrechungen in der Weltstadt und zwar
theils in Couture's Atelier, theils, namentlich später,
selbständig einige seiner phantastischen, von hoher Be-
gabung zeugenden Erstlingsbilder malend.
Dahin gehört insbesondere seine Komposition: „Der
Mensch im Schoße der Nacht vom Schlafe mit Geigen-
spiel zur Nnhe gewiegt", in welcher der junge, nach dem
Höchsten strebende Künstler scinen Figuren volle Lebens-
größe gab und bereits in Anordnung wie in Farbe seine
Eigenthümlichkeit entwickelte.
Jn München und man kann wohl sagen in Deutsch-
land wurde Victor Müller erst durch seine gleichfalls in
Lebensgröße gemalte „Waldnymphe" bekannt, welche er
zur internationalen Ausstellung des Jahres 1863 gesendet
hatte. Das Bild schwebte erst längere Zeit in Gefahr,
in derselben gar nicht zugelassen zu werden und wurde
dann so hoch gehangt, daß von eiuer Würdigung seiner
koloristischen Borzüge kaum die Rede sein konnte. Die
landläusige Kritik verfuhr mit deni mitten im Walde lie-
gendcn, üppig volleu Mädchen nicht viel glimpflicher als
die Ausstellungskommission. Jn Berlin wurden zwar
Müller's„Waldnymphe" wiesein „Adonis"in der akademi-
schen Ausstellung sehr ungünstig aufgehängt, nämlich jene
in der sogenannten Todtenkammer, wo sie gar kein Licht
hatte, dieser dagegen in einem schlecht beleuchteten Saal