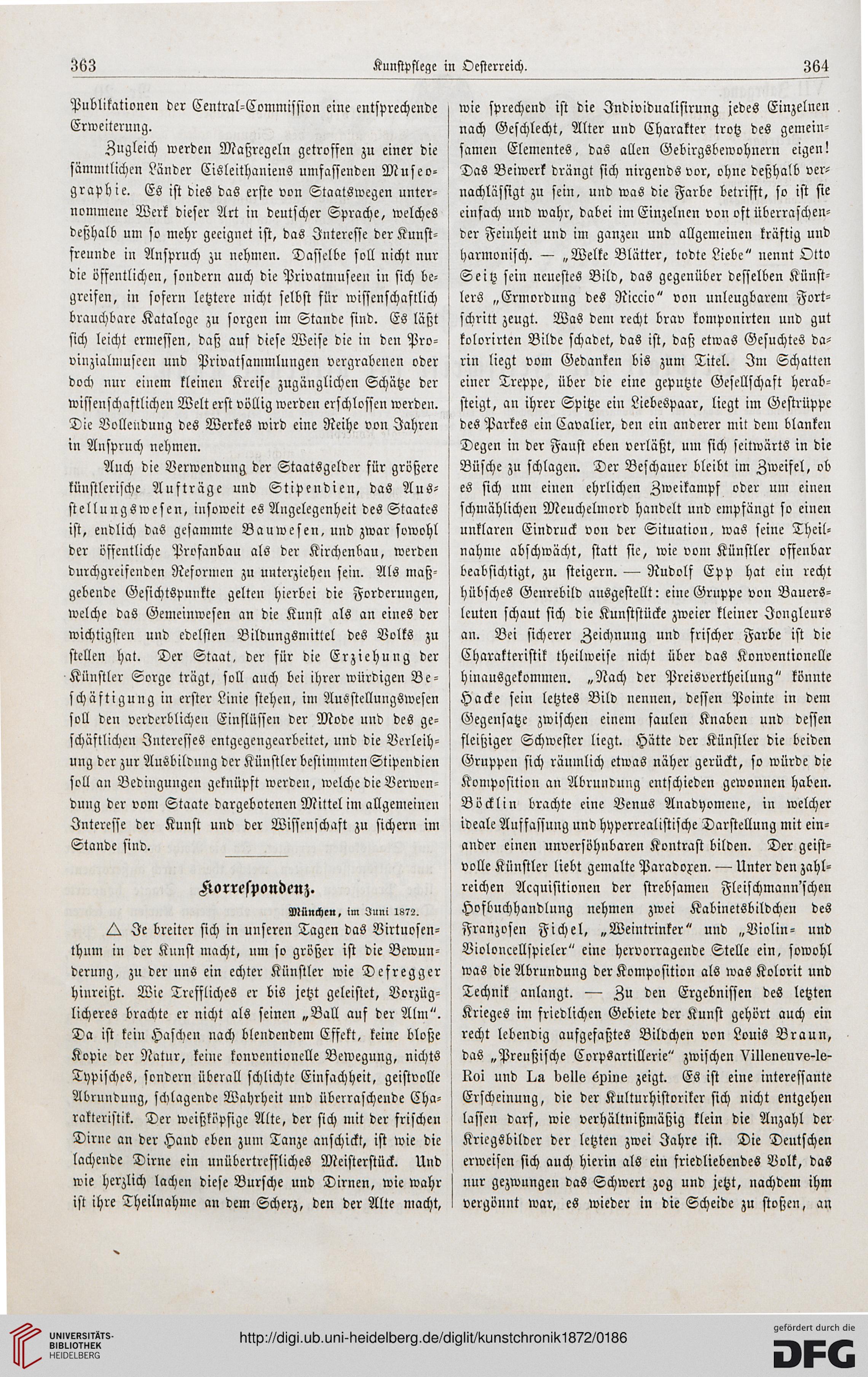363
Kunstpflege in Oesterreich.
364
Pubiikationen der Central-Commission eine entsprechende
Erweiterung.
Zugleich werden Maßregeln getroffen zu einer die
sämmllichen Länder Cisleithaniens umfassenden Museo-
graphie. Es ist dies das erste von Staatswegen unter-
nommene Werk dieser Art in deutscher Sprache, welches
deßhalb um so mehr gecignet ist, das Jnteresse der Knnst-
freunde in Anspruch zu nehmen. Dasselbe soll nicht nur
die öffentlichen, sondern auch die Privatmuseeu in sich be-
greifen, in sofern lctztere nicht selbst für wissenschaftlich ^
brauchbare Kataloge zu sorgen im Stande sind. Es läßt z
sich leicht ermessen, daß auf diese Weise die in den Pro-
vinzialmuseen und Privatsammlungen vergrabenen oder
doch nur einem kleinen Kreise zugänglichen Schätze der
wissenschaftlichen Welt erst völlig werdeu erschlossen werden.
Die Volleüdung des Werkes wird eine Reihe von Jahren
in Anspruch nehmen.
Auch die Verwendung der Staatsgelder für größere ^
künstlerische Aufträge und Stipendien, das Aus-
stellungswesen, iusoweit es Angelegenheit des Staatcs
ist, endlich das gesammte Bauwesen, und zwar sowohl
der öffentliche Profanbau als der Kirchenbau, werden
durchgreifenden Reformen zu unterziehen sein. Als maß-
gebende Gesichtspunkte gelten hierbei die Forderungen,
welche das Gemcinwesen an die Kunst als an eines der
wichtigsten und edelsten Bildungsniittel des Volks zu
stellen hat. Der Staat, der für die Erziehung der
Künstler Sorge trägt, soll anch bei ihrer würdigen Be-
schäftigung in erster Linie stehen, im Auöstellungswesen
soll deu verderblichen Einflüssen der Mode und des ge-
schäftlichen Jnteresses entgegengearbeitet, und die Verleih-
ung der zur Ausbildung der Künstler bestiinmtcn Stipendien
soll an Bediugungen geknüpft werden, welche die Verwen-
dung der vom Staate dargebotenen Mittel im allgemeineu
Jnteresse der Kuust und der Wissenschaft zu sicheru im
Stande sind.
Korrespondenz.
München, im Juni 1S7S.
Je breiter sich in unseren Tagen das Virtnosen-
thum in der Kunst macht, um so größer ist die Bewun-
derung, zu der uns ein echter Künstler wie Defregger
hiureißt. Wie Treffliches er bis jetzt geleistet, Vorzüg-
licheres brachte er nicht als seinen „Ball auf der Alm".
Da ist kein Hascheu nach blendendem Effekt, keine bloße
Kopie der Natur, keiue konventionelle Bewegung, nichts
Typisches, sondern überall schlichte Einfachheit, geistvolle
Abrundung, schlagende Wahrheit und überraschende Cha-
rakteristik. Der weißköpfige Alte, der sich mit der frischen
Dirne an der Hand eben zum Tanze anschickt, ist wie die
lachende Dirne ein unübertreffliches Meisterstück. Und
wie herzlich lachen diese Bursche und Dirnen, wie wahr
ist ihre Theilnahme an dem Scherz, den der Alte macht,
wie sprechend ist die Jndividualisirung jedes Einzelnen
nach Geschlecht, Alter und Charakter trotz des gemein-
samen Elementes, das allen Gebirgsbewohnern eigen!
Das Beiwerk dräugt sich nirgends vor, ohne deßhalb ver-
nachlässigt zu sein, und was die Farbe betrifft, so ist sie
einfach und wahr, dabei im Einzelncn vou oft überraschen-
der Feinheit und im ganzen und allgemeinen kräftig uud
harmonisch. — „Welke Blätter, todte Liebe" nennt Otto
Seitz sein neuestes Bild, das gegenüber desselben Künst-
lers „Ermordung des Riccio" vou unleugbarem Fort-
schritt zeugt. Was dem recht brav kompouirten und gut
kolorirten Bilde schadet, das ist, daß etwas Gesuchtes da-
rin liegt vom Gedanken bis zum Titel. Jm Schatten
einer Treppe, über die eine geputzte Gesellschaft herab-
steigt, an ihrer Spitze ein LiebeSpaar, liegt im Gestrüppe
des Parkes ein Cavalier, den ein anderer mit dem blanken
Degen in der Faust eben verläßt, um sich seitwärts in die
Büsche zu schlagen. Der Beschauer bleibt im Zweifel, ob
es sich um einen ehrlichen Zweikampf oder um einen
schmählichen Meuchelmord handelt und empfängt so einen
unklaren Eindruck von der Situation, was seine Theil-
nahnie abschwächt, statt sie, wie vom Künstler offenbar
beabsichtigt, zu steigern. — Rudolf Epp hat eiu recht
hübsches Genrebild ausgestellt: eine Gruppe von Bauers-
leuten schaut sich die Kunststücke zweier kleiner Jongleurs
an. Bei sicherer Zeichnung und frischer Farbe ist die
Charakteristik theilweise nicht über das Konventionelle
hinausgekommen. „Nach der Preisvertheilung" könnte
Hacke sein letztes Bild nennen, dessen Pointe in dem
Gegensatze zwischen einem faulen Knaben und dessen
fleißiger Schwester liegt. Hätte der Künstler die beiden
Gruppen sich räumlich etwas näher gerückt, so würde die
Koniposition an Abrundung entschieden gewounen haben.
Böcklin brachte eine Venus Anadyomene, in welcher
ideale Auffassung und hyperrealistische Darstellung mit ein-
ander einen unversöhnbaren Kontrast bilden. Der geist-
volle Künstler liebt gemalte Paradoxen. — Uuter den zahl-
reichen Acquisitionen der strebsamen Fleischmann'schen
Hofbuchhandlung nehmen zwei Kabinetsbildchen des
Franzosen Fichel, „Weintrinker" und „Violin- und
Violoncellspieler" eine hervorragende Stelle ein, sowohl
was die Abrundung der Komposition als was Kolorit und
Technik anlangt. — Zu den Ergebnissen des letzten
Krieges im friedlichen Gebiete der Kunst gehört auch ein
recht lebendig aufgefaßtes Bildchen von Louis Braun,
das „Preußische Corpsartillerie" zwischen Villeneuve-Io-
Roi und Uu dello 6xine zeigt. Es ist eine interessante
Erscheinung, die der Kulturhistoriker sich nicht entgehen
lassen darf, wie verhältnißmäßig klein die Anzahl der
Kriegsbilder der letzten zwei Jahre ist. Die Deutschen
erweisen sich auch hierin als eiu friedliebendes Bolk, das
nur gezwungen das Schwert zog und jetzt, nachdem ihm
vergönnt war, es wieder in die Scheide zu stoßen, an
Kunstpflege in Oesterreich.
364
Pubiikationen der Central-Commission eine entsprechende
Erweiterung.
Zugleich werden Maßregeln getroffen zu einer die
sämmllichen Länder Cisleithaniens umfassenden Museo-
graphie. Es ist dies das erste von Staatswegen unter-
nommene Werk dieser Art in deutscher Sprache, welches
deßhalb um so mehr gecignet ist, das Jnteresse der Knnst-
freunde in Anspruch zu nehmen. Dasselbe soll nicht nur
die öffentlichen, sondern auch die Privatmuseeu in sich be-
greifen, in sofern lctztere nicht selbst für wissenschaftlich ^
brauchbare Kataloge zu sorgen im Stande sind. Es läßt z
sich leicht ermessen, daß auf diese Weise die in den Pro-
vinzialmuseen und Privatsammlungen vergrabenen oder
doch nur einem kleinen Kreise zugänglichen Schätze der
wissenschaftlichen Welt erst völlig werdeu erschlossen werden.
Die Volleüdung des Werkes wird eine Reihe von Jahren
in Anspruch nehmen.
Auch die Verwendung der Staatsgelder für größere ^
künstlerische Aufträge und Stipendien, das Aus-
stellungswesen, iusoweit es Angelegenheit des Staatcs
ist, endlich das gesammte Bauwesen, und zwar sowohl
der öffentliche Profanbau als der Kirchenbau, werden
durchgreifenden Reformen zu unterziehen sein. Als maß-
gebende Gesichtspunkte gelten hierbei die Forderungen,
welche das Gemcinwesen an die Kunst als an eines der
wichtigsten und edelsten Bildungsniittel des Volks zu
stellen hat. Der Staat, der für die Erziehung der
Künstler Sorge trägt, soll anch bei ihrer würdigen Be-
schäftigung in erster Linie stehen, im Auöstellungswesen
soll deu verderblichen Einflüssen der Mode und des ge-
schäftlichen Jnteresses entgegengearbeitet, und die Verleih-
ung der zur Ausbildung der Künstler bestiinmtcn Stipendien
soll an Bediugungen geknüpft werden, welche die Verwen-
dung der vom Staate dargebotenen Mittel im allgemeineu
Jnteresse der Kuust und der Wissenschaft zu sicheru im
Stande sind.
Korrespondenz.
München, im Juni 1S7S.
Je breiter sich in unseren Tagen das Virtnosen-
thum in der Kunst macht, um so größer ist die Bewun-
derung, zu der uns ein echter Künstler wie Defregger
hiureißt. Wie Treffliches er bis jetzt geleistet, Vorzüg-
licheres brachte er nicht als seinen „Ball auf der Alm".
Da ist kein Hascheu nach blendendem Effekt, keine bloße
Kopie der Natur, keiue konventionelle Bewegung, nichts
Typisches, sondern überall schlichte Einfachheit, geistvolle
Abrundung, schlagende Wahrheit und überraschende Cha-
rakteristik. Der weißköpfige Alte, der sich mit der frischen
Dirne an der Hand eben zum Tanze anschickt, ist wie die
lachende Dirne ein unübertreffliches Meisterstück. Und
wie herzlich lachen diese Bursche und Dirnen, wie wahr
ist ihre Theilnahme an dem Scherz, den der Alte macht,
wie sprechend ist die Jndividualisirung jedes Einzelnen
nach Geschlecht, Alter und Charakter trotz des gemein-
samen Elementes, das allen Gebirgsbewohnern eigen!
Das Beiwerk dräugt sich nirgends vor, ohne deßhalb ver-
nachlässigt zu sein, und was die Farbe betrifft, so ist sie
einfach und wahr, dabei im Einzelncn vou oft überraschen-
der Feinheit und im ganzen und allgemeinen kräftig uud
harmonisch. — „Welke Blätter, todte Liebe" nennt Otto
Seitz sein neuestes Bild, das gegenüber desselben Künst-
lers „Ermordung des Riccio" vou unleugbarem Fort-
schritt zeugt. Was dem recht brav kompouirten und gut
kolorirten Bilde schadet, das ist, daß etwas Gesuchtes da-
rin liegt vom Gedanken bis zum Titel. Jm Schatten
einer Treppe, über die eine geputzte Gesellschaft herab-
steigt, an ihrer Spitze ein LiebeSpaar, liegt im Gestrüppe
des Parkes ein Cavalier, den ein anderer mit dem blanken
Degen in der Faust eben verläßt, um sich seitwärts in die
Büsche zu schlagen. Der Beschauer bleibt im Zweifel, ob
es sich um einen ehrlichen Zweikampf oder um einen
schmählichen Meuchelmord handelt und empfängt so einen
unklaren Eindruck von der Situation, was seine Theil-
nahnie abschwächt, statt sie, wie vom Künstler offenbar
beabsichtigt, zu steigern. — Rudolf Epp hat eiu recht
hübsches Genrebild ausgestellt: eine Gruppe von Bauers-
leuten schaut sich die Kunststücke zweier kleiner Jongleurs
an. Bei sicherer Zeichnung und frischer Farbe ist die
Charakteristik theilweise nicht über das Konventionelle
hinausgekommen. „Nach der Preisvertheilung" könnte
Hacke sein letztes Bild nennen, dessen Pointe in dem
Gegensatze zwischen einem faulen Knaben und dessen
fleißiger Schwester liegt. Hätte der Künstler die beiden
Gruppen sich räumlich etwas näher gerückt, so würde die
Koniposition an Abrundung entschieden gewounen haben.
Böcklin brachte eine Venus Anadyomene, in welcher
ideale Auffassung und hyperrealistische Darstellung mit ein-
ander einen unversöhnbaren Kontrast bilden. Der geist-
volle Künstler liebt gemalte Paradoxen. — Uuter den zahl-
reichen Acquisitionen der strebsamen Fleischmann'schen
Hofbuchhandlung nehmen zwei Kabinetsbildchen des
Franzosen Fichel, „Weintrinker" und „Violin- und
Violoncellspieler" eine hervorragende Stelle ein, sowohl
was die Abrundung der Komposition als was Kolorit und
Technik anlangt. — Zu den Ergebnissen des letzten
Krieges im friedlichen Gebiete der Kunst gehört auch ein
recht lebendig aufgefaßtes Bildchen von Louis Braun,
das „Preußische Corpsartillerie" zwischen Villeneuve-Io-
Roi und Uu dello 6xine zeigt. Es ist eine interessante
Erscheinung, die der Kulturhistoriker sich nicht entgehen
lassen darf, wie verhältnißmäßig klein die Anzahl der
Kriegsbilder der letzten zwei Jahre ist. Die Deutschen
erweisen sich auch hierin als eiu friedliebendes Bolk, das
nur gezwungen das Schwert zog und jetzt, nachdem ihm
vergönnt war, es wieder in die Scheide zu stoßen, an