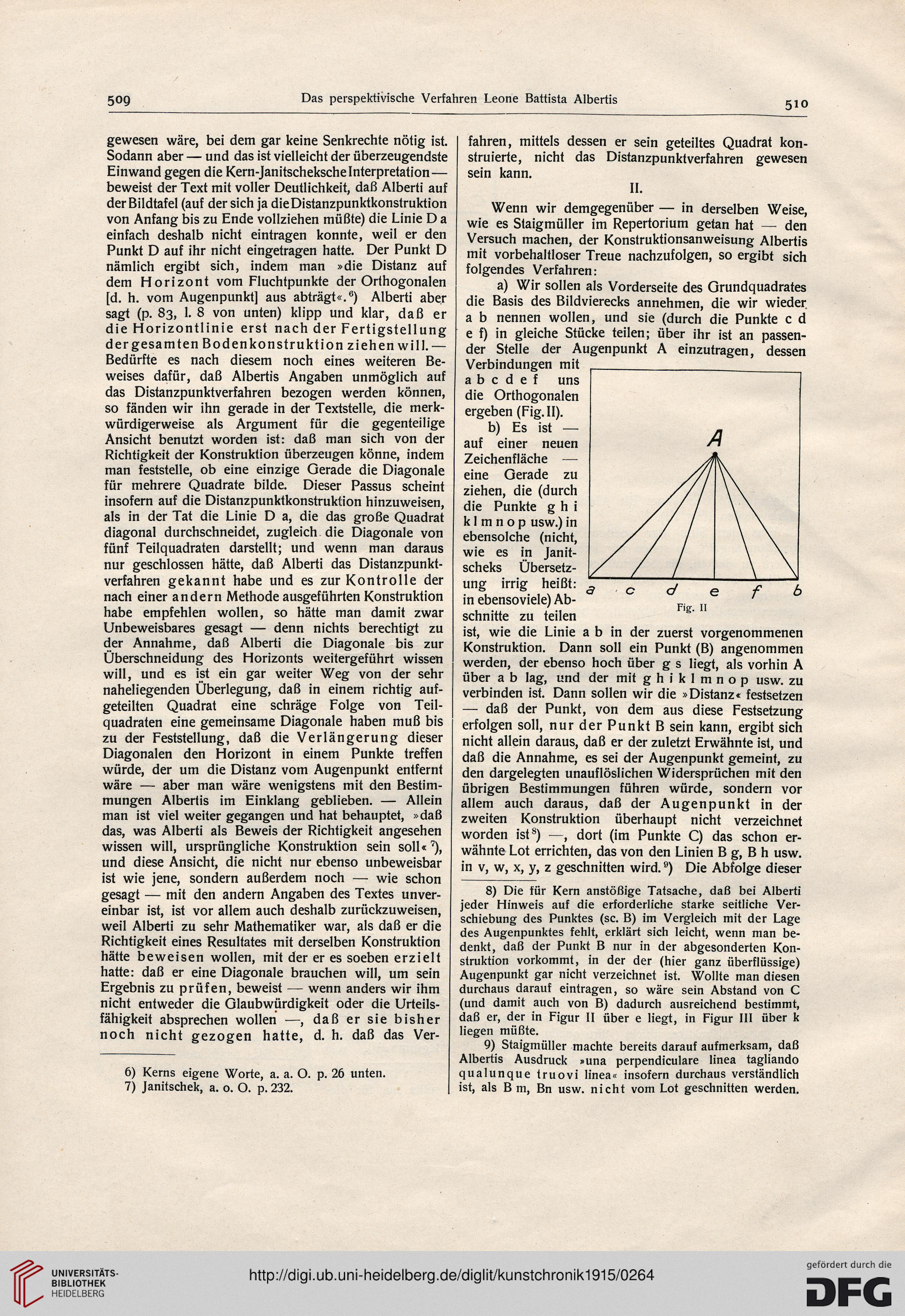509
Das perspektivische Verfahren Leone Battista Albertis
510
gewesen wäre, bei dem gar keine Senkrechte nötig ist.
Sodann aber — und das ist vielleicht der überzeugendste
Einwand gegen die Kern-Janitscheksche Interpretation—
beweist der Text mit voller Deutlichkeit, daß Alberti auf
der Bildtafel (auf der sich ja die Distanzpunktkonstruktion
von Anfang bis zu Ende vollziehen müßte) die Linie D a
einfach deshalb nicht eintragen konnte, weil er den
Punkt D auf ihr nicht eingetragen hatte. Der Punkt D
nämlich ergibt sich, indem man »die Distanz auf
dem Horizont vom Fluchtpunkte der Orthogonalen
[d. h. vom Augenpunkt] aus abträgt«.8) Alberti aber
sagt (p. 83, 1. 8 von unten) klipp und klar, daß er
die Horizontlinie erst nach der Fertigstellung
dergesamten Bodenkonstruktion ziehen will.—
Bedürfte es nach diesem noch eines weiteren Be-
weises dafür, daß Albertis Angaben unmöglich auf
das Distanzpunktverfahren bezogen werden können,
so fänden wir ihn gerade in der Textstelle, die merk-
würdigerweise als Argument für die gegenteilige
Ansicht benutzt worden ist: daß man sich von der
Richtigkeit der Konstruktion überzeugen könne, indem
man feststelle, ob eine einzige Gerade die Diagonale
für mehrere Quadrate bilde. Dieser Passus scheint
insofern auf die Distanzpunktkonstruktion hinzuweisen,
als in der Tat die Linie D a, die das große Quadrat
diagonal durchschneidet, zugleich die Diagonale von
fünf Teilquadraten darstellt; und wenn man daraus
nur geschlossen hätte, daß Alberti das Distanzpunkt-
verfahren gekannt habe und es zur Kontrolle der
nach einer andern Methode ausgeführten Konstruktion
habe empfehlen wollen, so hätte man damit zwar
Unbeweisbares gesagt — denn nichts berechtigt zu
der Annahme, daß Alberti die Diagonale bis zur
Überschneidung des Horizonts weitergeführt wissen
will, und es ist ein gar weiter Weg von der sehr
naheliegenden Überlegung, daß in einem richtig auf-
geteilten Quadrat eine schräge Folge von Teil-
quadraten eine gemeinsame Diagonale haben muß bis
zu der Feststellung, daß die Verlängerung dieser
Diagonalen den Horizont in einem Punkte treffen
würde, der um die Distanz vom Augenpunkt entfernt
wäre — aber man wäre wenigstens mit den Bestim-
mungen Albertis im Einklang geblieben. — Allein
man ist viel weiter gegangen und hat behauptet, »daß
das, was Alberti als Beweis der Richtigkeit angesehen
wissen will, ursprüngliche Konstruktion sein soll«7),
und diese Ansicht, die nicht nur ebenso unbeweisbar
ist wie jene, sondern außerdem noch — wie schon
gesagt — mit den andern Angaben des Textes unver-
einbar ist, ist vor allem auch deshalb zurückzuweisen,
weil Alberti zu sehr Mathematiker war, als daß er die
Richtigkeit eines Resultates mit derselben Konstruktion
hätte beweisen wollen, mit der er es soeben erzielt
hatte: daß er eine Diagonale brauchen will, um sein
Ergebnis zu prüfen, beweist — wenn anders wir ihm
nicht entweder die Glaubwürdigkeit oder die Urteils-
fähigkeit absprechen wollen —, daß er sie bisher
noch nicht gezogen hatte, d. h. daß das Ver-
6) Kerns eigene Worte, a. a. O. p. 26 unten.
7) Janitschek, a. o. O. p. 232.
fahren, mittels dessen er sein geteiltes Quadrat kon-
struierte, nicht das Distanzpunktverfahren gewesen
sein kann.
II.
Wenn wir demgegenüber — in derselben Weise,
wie es Staigmüller im Repertorium getan hat — den
Versuch machen, der Konstruktionsanweisung Albertis
mit vorbehaltloser Treue nachzufolgen, so ergibt sich
folgendes Verfahren:
a) Wir sollen als Vorderseite des Grundquadrates
die Basis des Bildvierecks annehmen, die wir wieder,
a b nennen wollen, und sie (durch die Punkte c d
e f) in gleiche Stücke teilen; über ihr ist an passen-
der Stelle der Augenpunkt A einzutragen, dessen
Verbindungen mit
a b c d e f uns
die Orthogonalen
ergeben (Fig. II).
b) Es ist —
auf einer neuen
Zeichenfläche —
eine Gerade zu
ziehen, die (durch
die Punkte g h i
k 1 m n o p usw.) in
ebensolche (nicht,
wie es in Janit-
scheks Übersetz-
ung irrig heißt:
in ebensoviele) Ab-
schnitte zu teilen
ist, wie die Linie a b in der zuerst vorgenommenen
Konstruktion. Dann soll ein Punkt (B) angenommen
werden, der ebenso hoch über g s liegt, als vorhin A
über a b lag, und der mit g h i k I m n o p usw. zu
verbinden ist. Dann sollen wir die »Distanz« festsetzen
— daß der Punkt, von dem aus diese Festsetzung
erfolgen soll, nur der Punkt B sein kann, ergibt sich
nicht allein daraus, daß er der zuletzt Erwähnte ist, und
daß die Annahme, es sei der Augenpunkt gemeint, zu
den dargelegten unauflöslichen Widersprüchen mit den
übrigen Bestimmungen führen würde, sondern vor
allem auch daraus, daß der Augenpunkt in der
zweiten Konstruktion überhaupt nicht verzeichnet
worden ist8) —, dort (im Punkte C) das schon er-
wähnte Lot errichten, das von den Linien B g, B h usw.
in v, w, x, y, z geschnitten wird.9) Die Abfolge dieser
8) Die für Kern anstößige Tatsache, daß bei Alberti
jeder Hinweis auf die erforderliche starke seitliche Ver-
schiebung des Punktes (sc. B) im Vergleich mit der Lage
des Augenpunktes fehlt, erklärt sich leicht, wenn man be-
denkt, daß der Punkt B nur in der abgesonderten Kon-
struktion vorkommt, in der der (hier ganz überflüssige)
Augenpunkt gar nicht verzeichnet ist. Wollte man diesen
durchaus darauf eintragen, so wäre sein Abstand von C
(und damit auch von B) dadurch ausreichend bestimmt,
daß er, der in Figur II über e liegt, in Figur III über k
liegen müßte.
9) Staigmüller machte bereits darauf aufmerksam, daß
Albertis Ausdruck »una perpendiculare linea tagliando
qualunque truovi linea« insofern durchaus verständlich
ist, als B m, Bn usw. nicht vom Lot geschnitten werden.
Das perspektivische Verfahren Leone Battista Albertis
510
gewesen wäre, bei dem gar keine Senkrechte nötig ist.
Sodann aber — und das ist vielleicht der überzeugendste
Einwand gegen die Kern-Janitscheksche Interpretation—
beweist der Text mit voller Deutlichkeit, daß Alberti auf
der Bildtafel (auf der sich ja die Distanzpunktkonstruktion
von Anfang bis zu Ende vollziehen müßte) die Linie D a
einfach deshalb nicht eintragen konnte, weil er den
Punkt D auf ihr nicht eingetragen hatte. Der Punkt D
nämlich ergibt sich, indem man »die Distanz auf
dem Horizont vom Fluchtpunkte der Orthogonalen
[d. h. vom Augenpunkt] aus abträgt«.8) Alberti aber
sagt (p. 83, 1. 8 von unten) klipp und klar, daß er
die Horizontlinie erst nach der Fertigstellung
dergesamten Bodenkonstruktion ziehen will.—
Bedürfte es nach diesem noch eines weiteren Be-
weises dafür, daß Albertis Angaben unmöglich auf
das Distanzpunktverfahren bezogen werden können,
so fänden wir ihn gerade in der Textstelle, die merk-
würdigerweise als Argument für die gegenteilige
Ansicht benutzt worden ist: daß man sich von der
Richtigkeit der Konstruktion überzeugen könne, indem
man feststelle, ob eine einzige Gerade die Diagonale
für mehrere Quadrate bilde. Dieser Passus scheint
insofern auf die Distanzpunktkonstruktion hinzuweisen,
als in der Tat die Linie D a, die das große Quadrat
diagonal durchschneidet, zugleich die Diagonale von
fünf Teilquadraten darstellt; und wenn man daraus
nur geschlossen hätte, daß Alberti das Distanzpunkt-
verfahren gekannt habe und es zur Kontrolle der
nach einer andern Methode ausgeführten Konstruktion
habe empfehlen wollen, so hätte man damit zwar
Unbeweisbares gesagt — denn nichts berechtigt zu
der Annahme, daß Alberti die Diagonale bis zur
Überschneidung des Horizonts weitergeführt wissen
will, und es ist ein gar weiter Weg von der sehr
naheliegenden Überlegung, daß in einem richtig auf-
geteilten Quadrat eine schräge Folge von Teil-
quadraten eine gemeinsame Diagonale haben muß bis
zu der Feststellung, daß die Verlängerung dieser
Diagonalen den Horizont in einem Punkte treffen
würde, der um die Distanz vom Augenpunkt entfernt
wäre — aber man wäre wenigstens mit den Bestim-
mungen Albertis im Einklang geblieben. — Allein
man ist viel weiter gegangen und hat behauptet, »daß
das, was Alberti als Beweis der Richtigkeit angesehen
wissen will, ursprüngliche Konstruktion sein soll«7),
und diese Ansicht, die nicht nur ebenso unbeweisbar
ist wie jene, sondern außerdem noch — wie schon
gesagt — mit den andern Angaben des Textes unver-
einbar ist, ist vor allem auch deshalb zurückzuweisen,
weil Alberti zu sehr Mathematiker war, als daß er die
Richtigkeit eines Resultates mit derselben Konstruktion
hätte beweisen wollen, mit der er es soeben erzielt
hatte: daß er eine Diagonale brauchen will, um sein
Ergebnis zu prüfen, beweist — wenn anders wir ihm
nicht entweder die Glaubwürdigkeit oder die Urteils-
fähigkeit absprechen wollen —, daß er sie bisher
noch nicht gezogen hatte, d. h. daß das Ver-
6) Kerns eigene Worte, a. a. O. p. 26 unten.
7) Janitschek, a. o. O. p. 232.
fahren, mittels dessen er sein geteiltes Quadrat kon-
struierte, nicht das Distanzpunktverfahren gewesen
sein kann.
II.
Wenn wir demgegenüber — in derselben Weise,
wie es Staigmüller im Repertorium getan hat — den
Versuch machen, der Konstruktionsanweisung Albertis
mit vorbehaltloser Treue nachzufolgen, so ergibt sich
folgendes Verfahren:
a) Wir sollen als Vorderseite des Grundquadrates
die Basis des Bildvierecks annehmen, die wir wieder,
a b nennen wollen, und sie (durch die Punkte c d
e f) in gleiche Stücke teilen; über ihr ist an passen-
der Stelle der Augenpunkt A einzutragen, dessen
Verbindungen mit
a b c d e f uns
die Orthogonalen
ergeben (Fig. II).
b) Es ist —
auf einer neuen
Zeichenfläche —
eine Gerade zu
ziehen, die (durch
die Punkte g h i
k 1 m n o p usw.) in
ebensolche (nicht,
wie es in Janit-
scheks Übersetz-
ung irrig heißt:
in ebensoviele) Ab-
schnitte zu teilen
ist, wie die Linie a b in der zuerst vorgenommenen
Konstruktion. Dann soll ein Punkt (B) angenommen
werden, der ebenso hoch über g s liegt, als vorhin A
über a b lag, und der mit g h i k I m n o p usw. zu
verbinden ist. Dann sollen wir die »Distanz« festsetzen
— daß der Punkt, von dem aus diese Festsetzung
erfolgen soll, nur der Punkt B sein kann, ergibt sich
nicht allein daraus, daß er der zuletzt Erwähnte ist, und
daß die Annahme, es sei der Augenpunkt gemeint, zu
den dargelegten unauflöslichen Widersprüchen mit den
übrigen Bestimmungen führen würde, sondern vor
allem auch daraus, daß der Augenpunkt in der
zweiten Konstruktion überhaupt nicht verzeichnet
worden ist8) —, dort (im Punkte C) das schon er-
wähnte Lot errichten, das von den Linien B g, B h usw.
in v, w, x, y, z geschnitten wird.9) Die Abfolge dieser
8) Die für Kern anstößige Tatsache, daß bei Alberti
jeder Hinweis auf die erforderliche starke seitliche Ver-
schiebung des Punktes (sc. B) im Vergleich mit der Lage
des Augenpunktes fehlt, erklärt sich leicht, wenn man be-
denkt, daß der Punkt B nur in der abgesonderten Kon-
struktion vorkommt, in der der (hier ganz überflüssige)
Augenpunkt gar nicht verzeichnet ist. Wollte man diesen
durchaus darauf eintragen, so wäre sein Abstand von C
(und damit auch von B) dadurch ausreichend bestimmt,
daß er, der in Figur II über e liegt, in Figur III über k
liegen müßte.
9) Staigmüller machte bereits darauf aufmerksam, daß
Albertis Ausdruck »una perpendiculare linea tagliando
qualunque truovi linea« insofern durchaus verständlich
ist, als B m, Bn usw. nicht vom Lot geschnitten werden.