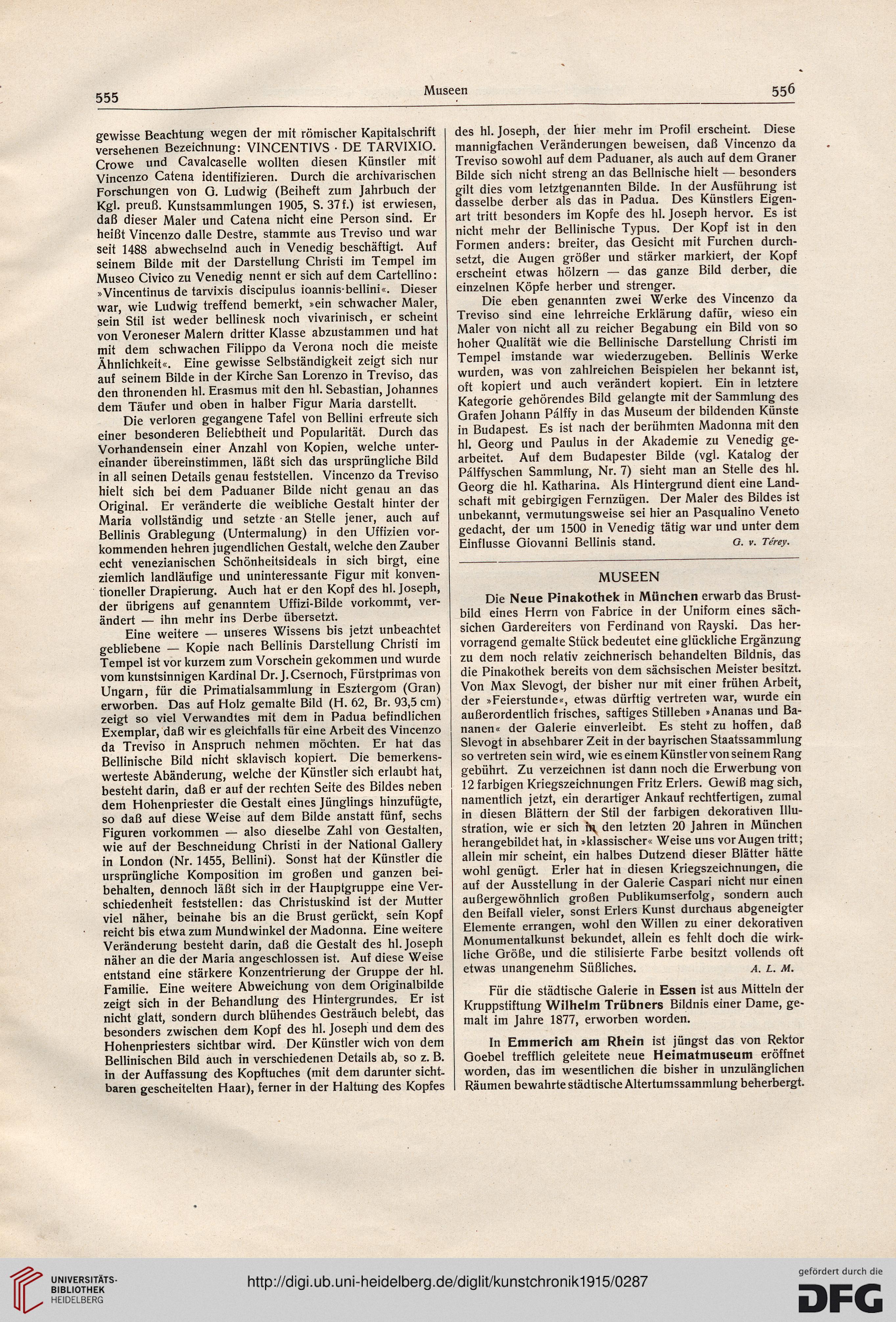555
Museen
556
gewisse Beachtung wegen der mit römischer Kapitalschrift
versehenen Bezeichnung: VINCENTIVS • DE TARVIXIO.
Crowe und Cavalcaselle wollten diesen Künstler mit
Vincenzo Catena identifizieren. Durch die archivarischen
Forschungen von Q. Ludwig (Beiheft zum Jahrbuch der
Kgl. preuß. Kunstsammlungen 1905, S. 37f.) ist erwiesen,
daß dieser Maler und Catena nicht eine Person sind. Er
heißt Vincenzo dalle Destre, stammte aus Treviso und war
seit 1488 abwechselnd auch in Venedig beschäftigt. Auf
seinem Bilde mit der Darstellung Christi im Tempel im
Museo Civico zu Venedig nennt er sich auf dem Cartellino:
»Vincentinus de tarvixis discipulus ioannis-bellini«. Dieser
war, wie Ludwig treffend bemerkt, »ein schwacher Maler,
sein Stil ist weder bellinesk noch vivarinisch, er scheint
von Veroneser Malern dritter Klasse abzustammen und hat
mit dem schwachen Filippo da Verona noch die meiste
Ähnlichkeit«. Eine gewisse Selbständigkeit zeigt sich nur
auf seinem Bilde in der Kirche San Lorenzo in Treviso, das
den thronenden hl. Erasmus mit den hl. Sebastian, Johannes
dem Täufer und oben in halber Figur Maria darstellt.
Die verloren gegangene Tafel von Bellini erfreute sich
einer besonderen Beliebtheit und Popularität. Durch das
Vorhandensein einer Anzahl von Kopien, welche unter-
einander übereinstimmen, läßt sich das ursprüngliche Bild
in all seinen Details genau feststellen. Vincenzo da Treviso
hielt sich bei dem Paduaner Bilde nicht genau an das
Original. Er veränderte die weibliche Gestalt hinter der
Maria vollständig und setzte an Stelle jener, auch auf
Bellinis Grablegung (Untermalung) in den Uffizien vor-
kommenden hehren jugendlichen Gestalt, welche den Zauber
echt venezianischen Schönheitsideals in sich birgt, eine
ziemlich landläufige und uninteressante Figur mit konven-
tioneller Drapierung. Auch hat er den Kopf des hl. Joseph,
der übrigens auf genanntem Uffizi-Bilde vorkommt, ver-
ändert — ihn mehr ins Derbe übersetzt.
Eine weitere — unseres Wissens bis jetzt unbeachtet
gebliebene — Kopie nach Bellinis Darstellung Christi im
Tempel ist vor kurzem zum Vorschein gekommen und wurde
vom kunstsinnigen Kardinal Dr. J.Csernoch, Fürstprimas von
Ungarn, für die Primatialsammlung in Esztergom (Gran)
erworben. Das auf Holz gemalte Bild (H. 62, Br. 93,5 cm)
zeigt so viel Verwandtes mit dem in Padua befindlichen
Exemplar, daß wir es gleichfalls für eine Arbeit des Vincenzo
da Treviso in Anspruch nehmen möchten. Er hat das
Bellinische Bild nicht sklavisch kopiert. Die bemerkens-
werteste Abänderung, welche der Künstler sich erlaubt hat,
besteht darin, daß er auf der rechten Seite des Bildes neben
dem Hohenpriester die Gestalt eines Jünglings hinzufügte,
so daß auf diese Weise auf dem Bilde anstatt fünf, sechs
Figuren vorkommen — also dieselbe Zahl von Gestalten,
wie auf der Beschneidung Christi in der National Gallery
in London (Nr. 1455, Bellini). Sonst hat der Künstler die
ursprüngliche Komposition im großen und ganzen bei-
behalten, dennoch läßt sich irr der Hauptgruppe eine Ver-
schiedenheit feststellen: das Christuskind ist der Mutter
viel näher, beinahe bis an die Brust gerückt, sein Kopf
reicht bis etwa zum Mundwinkel der Madonna. Eine weitere
Veränderung besteht darin, daß die Gestalt des hl. Joseph
näher an die der Maria angeschlossen ist. Auf diese Weise
entstand eine stärkere Konzentrierung der Gruppe der hl.
Familie. Eine weitere Abweichung von dem Originalbilde
zeigt sich in der Behandlung des Hintergrundes. Er ist
nicht glatt, sondern durch blühendes Gesträuch belebt, das
besonders zwischen dem Kopf des hl. Joseph und dem des
Hohenpriesters sichtbar wird. Der Künstler wich von dem
Bellinischen Bild auch in verschiedenen Details ab, so z. B.
in der Auffassung des Kopftuches (mit dem darunter sicht-
baren gescheitelten Haar), ferner in der Haltung des Kopfes
des hl. Joseph, der hier mehr im Profil erscheint. Diese
mannigfachen Veränderungen beweisen, daß Vincenzo da
Treviso sowohl auf dem Paduaner, als auch auf dem Graner
Bilde sich nicht streng an das Bellnische hielt — besonders
gilt dies vom letztgenannten Bilde. In der Ausführung ist
dasselbe derber als das in Padua. Des Künstlers Eigen-
art tritt besonders im Kopfe des hl. Joseph hervor. Es ist
nicht mehr der Bellinische Typus. Der Kopf ist in den
Formen anders: breiter, das Gesicht mit Furchen durch-
setzt, die Augen größer und stärker markiert, der Kopf
erscheint etwas hölzern — das ganze Bild derber, die
einzelnen Köpfe herber und strenger.
Die eben genannten zwei Werke des Vincenzo da
Treviso sind eine lehrreiche Erklärung dafür, wieso ein
Maler von nicht all zu reicher Begabung ein Bild von so
hoher Qualität wie die Bellinische Darstellung Christi im
Tempel imstande war wiederzugeben. Bellinis Werke
wurden, was von zahlreichen Beispielen her bekannt ist,
oft kopiert und auch verändert kopiert. Ein in letztere
Kategorie gehörendes Bild gelangte mit der Sammlung des
Grafen Johann Pälffy in das Museum der bildenden Künste
in Budapest. Es ist nach der berühmten Madonna mit den
hl. Georg und Paulus in der Akademie zu Venedig ge-
arbeitet. Auf dem Budapester Bilde (vgl. Katalog der
Pälffyschen Sammlung, Nr. 7) sieht man an Stelle des hl.
Georg die hl. Katharina. Als Hintergrund dient eine Land-
schaft mit gebirgigen Fernzügen. Der Maler des Bildes ist
unbekannt, vermutungsweise sei hier an Pasqualino Veneto
gedacht, der um 1500 in Venedig tätig war und unter dem
Einflüsse Giovanni Bellinis stand. o, v. Te'rey.
MUSEEN
Die Neue Pinakothek in München erwarb das Brust-
bild eines Herrn von Fabrice in der Uniform eines säch-
sichen Gardereiters von Ferdinand von Rayski. Das her-
vorragend gemalte Stück bedeutet eine glückliche Ergänzung
zu dem noch relativ zeichnerisch behandelten Bildnis, das
die Pinakothek bereits von dem sächsischen Meister besitzt.
Von Max Sievogt, der bisher nur mit einer frühen Arbeit,
der »Feierstunde«, etwas dürftig vertreten war, wurde ein
außerordentlich frisches, saftiges Stilleben »Ananas und Ba-
nanen« der Galerie einverleibt. Es steht zu hoffen, daß
Slevogt in absehbarer Zeit in der bayrischen Staatssammlung
so vertreten sein wird, wie es einem Künstler von seinem Rang
gebührt. Zu verzeichnen ist dann noch die Erwerbung von
12 farbigen Kriegszeichnungen Fritz Erlers. Gewiß mag sich,
namentlich jetzt, ein derartiger Ankauf rechtfertigen, zumal
in diesen Blättern der Stil der farbigen dekorativen Illu-
stration, wie er sich den letzten 20 Jahren in München
herangebildet hat, in »klassischer« Weise uns vor Augen tritt;
allein mir scheint, ein halbes Dutzend dieser Blätter hätte
wohl genügt. Erler hat in diesen Kriegszeichnungen, die
auf der Ausstellung in der Galerie Caspari nicht nur einen
außergewöhnlich großen Publikumserfolg, sondern auch
den Beifall vieler, sonst Erlers Kunst durchaus abgeneigter
Elemente errangen, wohl den Willen zu einer dekorativen
Monumentalkunst bekundet, allein es fehlt doch die wirk-
liche Größe, und die stilisierte Farbe besitzt vollends oft
etwas unangenehm Süßliches. a. l. m.
Für die städtische Galerie in Essen ist aus Mitteln der
Kruppstiftung Wilhelm Trübners Bildnis einer Dame, ge-
malt im Jahre 1877, erworben worden.
In Emmerich am Rhein ist jüngst das von Rektor
Goebel trefflich geleitete neue Heimatmuseum eröffnet
worden, das im wesentlichen die bisher in unzulänglichen
Räumen bewahrte städtische Altertumssammlung beherbergt.
Museen
556
gewisse Beachtung wegen der mit römischer Kapitalschrift
versehenen Bezeichnung: VINCENTIVS • DE TARVIXIO.
Crowe und Cavalcaselle wollten diesen Künstler mit
Vincenzo Catena identifizieren. Durch die archivarischen
Forschungen von Q. Ludwig (Beiheft zum Jahrbuch der
Kgl. preuß. Kunstsammlungen 1905, S. 37f.) ist erwiesen,
daß dieser Maler und Catena nicht eine Person sind. Er
heißt Vincenzo dalle Destre, stammte aus Treviso und war
seit 1488 abwechselnd auch in Venedig beschäftigt. Auf
seinem Bilde mit der Darstellung Christi im Tempel im
Museo Civico zu Venedig nennt er sich auf dem Cartellino:
»Vincentinus de tarvixis discipulus ioannis-bellini«. Dieser
war, wie Ludwig treffend bemerkt, »ein schwacher Maler,
sein Stil ist weder bellinesk noch vivarinisch, er scheint
von Veroneser Malern dritter Klasse abzustammen und hat
mit dem schwachen Filippo da Verona noch die meiste
Ähnlichkeit«. Eine gewisse Selbständigkeit zeigt sich nur
auf seinem Bilde in der Kirche San Lorenzo in Treviso, das
den thronenden hl. Erasmus mit den hl. Sebastian, Johannes
dem Täufer und oben in halber Figur Maria darstellt.
Die verloren gegangene Tafel von Bellini erfreute sich
einer besonderen Beliebtheit und Popularität. Durch das
Vorhandensein einer Anzahl von Kopien, welche unter-
einander übereinstimmen, läßt sich das ursprüngliche Bild
in all seinen Details genau feststellen. Vincenzo da Treviso
hielt sich bei dem Paduaner Bilde nicht genau an das
Original. Er veränderte die weibliche Gestalt hinter der
Maria vollständig und setzte an Stelle jener, auch auf
Bellinis Grablegung (Untermalung) in den Uffizien vor-
kommenden hehren jugendlichen Gestalt, welche den Zauber
echt venezianischen Schönheitsideals in sich birgt, eine
ziemlich landläufige und uninteressante Figur mit konven-
tioneller Drapierung. Auch hat er den Kopf des hl. Joseph,
der übrigens auf genanntem Uffizi-Bilde vorkommt, ver-
ändert — ihn mehr ins Derbe übersetzt.
Eine weitere — unseres Wissens bis jetzt unbeachtet
gebliebene — Kopie nach Bellinis Darstellung Christi im
Tempel ist vor kurzem zum Vorschein gekommen und wurde
vom kunstsinnigen Kardinal Dr. J.Csernoch, Fürstprimas von
Ungarn, für die Primatialsammlung in Esztergom (Gran)
erworben. Das auf Holz gemalte Bild (H. 62, Br. 93,5 cm)
zeigt so viel Verwandtes mit dem in Padua befindlichen
Exemplar, daß wir es gleichfalls für eine Arbeit des Vincenzo
da Treviso in Anspruch nehmen möchten. Er hat das
Bellinische Bild nicht sklavisch kopiert. Die bemerkens-
werteste Abänderung, welche der Künstler sich erlaubt hat,
besteht darin, daß er auf der rechten Seite des Bildes neben
dem Hohenpriester die Gestalt eines Jünglings hinzufügte,
so daß auf diese Weise auf dem Bilde anstatt fünf, sechs
Figuren vorkommen — also dieselbe Zahl von Gestalten,
wie auf der Beschneidung Christi in der National Gallery
in London (Nr. 1455, Bellini). Sonst hat der Künstler die
ursprüngliche Komposition im großen und ganzen bei-
behalten, dennoch läßt sich irr der Hauptgruppe eine Ver-
schiedenheit feststellen: das Christuskind ist der Mutter
viel näher, beinahe bis an die Brust gerückt, sein Kopf
reicht bis etwa zum Mundwinkel der Madonna. Eine weitere
Veränderung besteht darin, daß die Gestalt des hl. Joseph
näher an die der Maria angeschlossen ist. Auf diese Weise
entstand eine stärkere Konzentrierung der Gruppe der hl.
Familie. Eine weitere Abweichung von dem Originalbilde
zeigt sich in der Behandlung des Hintergrundes. Er ist
nicht glatt, sondern durch blühendes Gesträuch belebt, das
besonders zwischen dem Kopf des hl. Joseph und dem des
Hohenpriesters sichtbar wird. Der Künstler wich von dem
Bellinischen Bild auch in verschiedenen Details ab, so z. B.
in der Auffassung des Kopftuches (mit dem darunter sicht-
baren gescheitelten Haar), ferner in der Haltung des Kopfes
des hl. Joseph, der hier mehr im Profil erscheint. Diese
mannigfachen Veränderungen beweisen, daß Vincenzo da
Treviso sowohl auf dem Paduaner, als auch auf dem Graner
Bilde sich nicht streng an das Bellnische hielt — besonders
gilt dies vom letztgenannten Bilde. In der Ausführung ist
dasselbe derber als das in Padua. Des Künstlers Eigen-
art tritt besonders im Kopfe des hl. Joseph hervor. Es ist
nicht mehr der Bellinische Typus. Der Kopf ist in den
Formen anders: breiter, das Gesicht mit Furchen durch-
setzt, die Augen größer und stärker markiert, der Kopf
erscheint etwas hölzern — das ganze Bild derber, die
einzelnen Köpfe herber und strenger.
Die eben genannten zwei Werke des Vincenzo da
Treviso sind eine lehrreiche Erklärung dafür, wieso ein
Maler von nicht all zu reicher Begabung ein Bild von so
hoher Qualität wie die Bellinische Darstellung Christi im
Tempel imstande war wiederzugeben. Bellinis Werke
wurden, was von zahlreichen Beispielen her bekannt ist,
oft kopiert und auch verändert kopiert. Ein in letztere
Kategorie gehörendes Bild gelangte mit der Sammlung des
Grafen Johann Pälffy in das Museum der bildenden Künste
in Budapest. Es ist nach der berühmten Madonna mit den
hl. Georg und Paulus in der Akademie zu Venedig ge-
arbeitet. Auf dem Budapester Bilde (vgl. Katalog der
Pälffyschen Sammlung, Nr. 7) sieht man an Stelle des hl.
Georg die hl. Katharina. Als Hintergrund dient eine Land-
schaft mit gebirgigen Fernzügen. Der Maler des Bildes ist
unbekannt, vermutungsweise sei hier an Pasqualino Veneto
gedacht, der um 1500 in Venedig tätig war und unter dem
Einflüsse Giovanni Bellinis stand. o, v. Te'rey.
MUSEEN
Die Neue Pinakothek in München erwarb das Brust-
bild eines Herrn von Fabrice in der Uniform eines säch-
sichen Gardereiters von Ferdinand von Rayski. Das her-
vorragend gemalte Stück bedeutet eine glückliche Ergänzung
zu dem noch relativ zeichnerisch behandelten Bildnis, das
die Pinakothek bereits von dem sächsischen Meister besitzt.
Von Max Sievogt, der bisher nur mit einer frühen Arbeit,
der »Feierstunde«, etwas dürftig vertreten war, wurde ein
außerordentlich frisches, saftiges Stilleben »Ananas und Ba-
nanen« der Galerie einverleibt. Es steht zu hoffen, daß
Slevogt in absehbarer Zeit in der bayrischen Staatssammlung
so vertreten sein wird, wie es einem Künstler von seinem Rang
gebührt. Zu verzeichnen ist dann noch die Erwerbung von
12 farbigen Kriegszeichnungen Fritz Erlers. Gewiß mag sich,
namentlich jetzt, ein derartiger Ankauf rechtfertigen, zumal
in diesen Blättern der Stil der farbigen dekorativen Illu-
stration, wie er sich den letzten 20 Jahren in München
herangebildet hat, in »klassischer« Weise uns vor Augen tritt;
allein mir scheint, ein halbes Dutzend dieser Blätter hätte
wohl genügt. Erler hat in diesen Kriegszeichnungen, die
auf der Ausstellung in der Galerie Caspari nicht nur einen
außergewöhnlich großen Publikumserfolg, sondern auch
den Beifall vieler, sonst Erlers Kunst durchaus abgeneigter
Elemente errangen, wohl den Willen zu einer dekorativen
Monumentalkunst bekundet, allein es fehlt doch die wirk-
liche Größe, und die stilisierte Farbe besitzt vollends oft
etwas unangenehm Süßliches. a. l. m.
Für die städtische Galerie in Essen ist aus Mitteln der
Kruppstiftung Wilhelm Trübners Bildnis einer Dame, ge-
malt im Jahre 1877, erworben worden.
In Emmerich am Rhein ist jüngst das von Rektor
Goebel trefflich geleitete neue Heimatmuseum eröffnet
worden, das im wesentlichen die bisher in unzulänglichen
Räumen bewahrte städtische Altertumssammlung beherbergt.