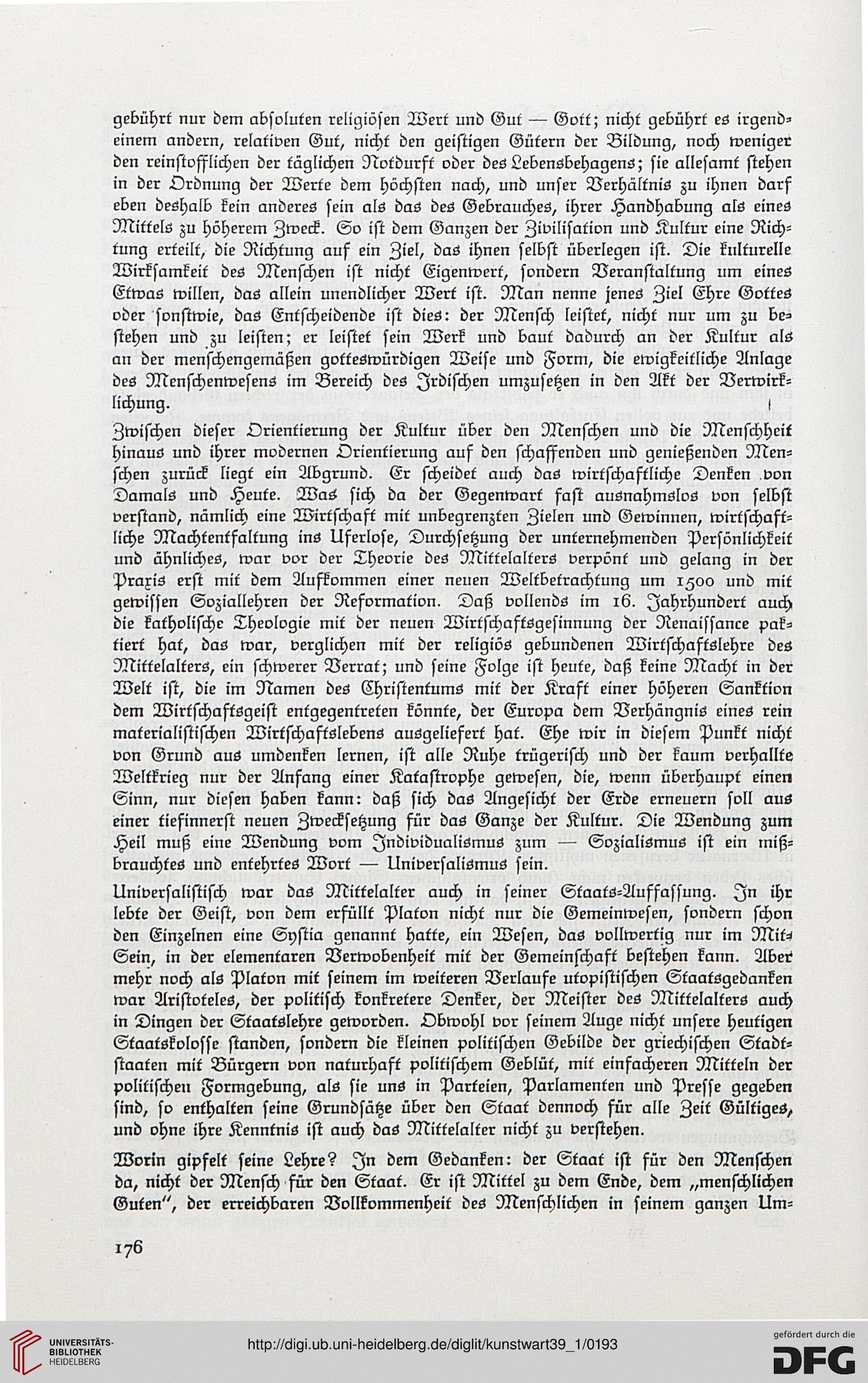gebührt nur dem absoluten religiösen Wert und Gut — Gott; nicht gebührt es irgend-
einem andern, relativen Gut, nicht den geistigen Gütern der Bildung, noch weniger
den reinstosslichen der täglichen Notdurft oder des LebensbehagenS; sie allesamt stehen
in der Ordnung der Werte dem höchsten nach, und unser Verhältni'S zu ihnen darf
eben deshalb kein anderes sein als das des GebraucheS, ihrer Handhabung alö eineS
Mittels zu höherem Zweck. So ist dem Ganzen der Zivilisation und Kultur eine Rich-
tung erteilt, die Richtung auf ein Ziel, das ihnen selbst überlegen ist. Die knlturelle
Wirksamkeit deö Menschen ist nicht Eigenwert, sondern Deranstaltung um eines
Etwas willen, das allein unendlicher Wert i'st. Man nenne jeneö Ziel Ehre Gottes
oder soristwie, das Entscheidende ist dies: der Mensch leistet, nicht nur um zu be-
stehen und zu leisten; er leistet sein Werk und baut dadurch an der Kultur als
an der menschengemäßen gotteswürdigen Weise und Form, die ewigkeitliche Anlage
des MenschenwesenS im Bereich des Jrdischen umzusetzen in den Akt der Verwirk-
lichung. i
Zwischen dieser Orientierung der Kultur über den Menschen und die Menschheit
hinauö und ihrer modernen Qrientierung auf den schasfenden und genießenden Men-
schen zurück liegt ein Abgrund. Er scheidet auch das wirtschaftliche Denken von
Damals und Heute. Was sich da der Gegenwart fast ausnahmslos von selbst
verstand, nämlich eine Wirtschaft mit unbegrenzten Zielen und Gewinnen, wirtschaft-
liche Machtentfalkung ins Uferlose, Durchsetzung der unternehmenden Persönlichkeit
und ähnlicheS, war vor der Theorie des Mittelalters verpönt und gelang in der
Praxis erst mit dem Aufkommen einer neuen Weltbetrachtung um iZvo und mit
gewissen Soziallehren der Reformation. Daß vollends im 16. Jahrhundcrt auch
die katholi'sche Theologie mit der neuen Wirtschaftsgesinnung der Nenaissance pak-
tiert hat, daö war, verglichen mit der religiös gebundenen Wirtschafkslehre des
Mittelalters, ein schwerer Verrat; und seine Folge heute, daß keine Macht in der
Welt ist, die lm Namen des Christentums mi't der Kraft einer höheren Sanktion
dem Wi'rtschaftsgeist entgegentreten könnte, der Europa dem Derhängnis eines rein
materi'ali'stischen Wirtschaftslebens ausgeliefert hat. Ehe wir in diesem Punkt nicht
von Grund aus umdenken lernen, ist alle Ruhe trügerisch und der kaum verhallto
Weltkrieg nur der Anfang einer Katastrophe gewesen, die, wenn überhaupt einen
Sinn, nur diesen haben kann: daß sich daS Angesicht der Erde erneuern soll aus
einer tiefinnerst neuen Zwecksetzung für daS Ganze der Kultur. Die Wendung zum
Heil muß eine Wendung vom Jndividualismus zum — Sozialismus ist ein miß-
brauchtes und entehrtes Wort — Universalismus sein.
Universalistisch war das Mittelalter auch in seiner Staats-Auffassung. Jn ihr
lebte der Geist, von dem erfüllt Platon nicht nur die Gemeinwesen, sondern schon
den Einzelnen eine Systia genannt hatte, ein Wesen, das vollwertig nur im Mit^
Sein, in der elementaren Berwobenheit mit der Gemeinschaft bestehen kann. Aber
mehr noch als Platon mit seinem im weiteren Verlaufe utopistischen Staatsgedanken
war Aristoteles, der politisch konkretere Denker, der Meister des Mittelalters auch
in Dingen der Staatslehre geworden. Obwohl vor seinem Auge nicht unsere heutigen
Staatskolosse standen, sondern die kleinen politischen Gebilde der griechischen Stadt-
staaten mit Bürgern von naturhaft politischem Geblüt, mit einsacheren Mitteln der
politischen Formgebung, als sie uns in Parteien, Parlamenten und Presse gegeben
sind, so enthalten seine Grundsätze über den Staat dennoch für alle Zeit Gültiges,
und ohne ihre Kenntnis ist auch das Mittelalter nicht zu verstehen.
Worin gipfelt seine Lehre? Jn dem Gedanken: der Staat ist für den Menschen
da, nicht der Mensch für den Skaat. Er ist Mittel zu dem Ende, dem „menschlichen
Guten", der erreichbaren Dollkommenheit des Menschlichen in seinem ganzen Um-
176
einem andern, relativen Gut, nicht den geistigen Gütern der Bildung, noch weniger
den reinstosslichen der täglichen Notdurft oder des LebensbehagenS; sie allesamt stehen
in der Ordnung der Werte dem höchsten nach, und unser Verhältni'S zu ihnen darf
eben deshalb kein anderes sein als das des GebraucheS, ihrer Handhabung alö eineS
Mittels zu höherem Zweck. So ist dem Ganzen der Zivilisation und Kultur eine Rich-
tung erteilt, die Richtung auf ein Ziel, das ihnen selbst überlegen ist. Die knlturelle
Wirksamkeit deö Menschen ist nicht Eigenwert, sondern Deranstaltung um eines
Etwas willen, das allein unendlicher Wert i'st. Man nenne jeneö Ziel Ehre Gottes
oder soristwie, das Entscheidende ist dies: der Mensch leistet, nicht nur um zu be-
stehen und zu leisten; er leistet sein Werk und baut dadurch an der Kultur als
an der menschengemäßen gotteswürdigen Weise und Form, die ewigkeitliche Anlage
des MenschenwesenS im Bereich des Jrdischen umzusetzen in den Akt der Verwirk-
lichung. i
Zwischen dieser Orientierung der Kultur über den Menschen und die Menschheit
hinauö und ihrer modernen Qrientierung auf den schasfenden und genießenden Men-
schen zurück liegt ein Abgrund. Er scheidet auch das wirtschaftliche Denken von
Damals und Heute. Was sich da der Gegenwart fast ausnahmslos von selbst
verstand, nämlich eine Wirtschaft mit unbegrenzten Zielen und Gewinnen, wirtschaft-
liche Machtentfalkung ins Uferlose, Durchsetzung der unternehmenden Persönlichkeit
und ähnlicheS, war vor der Theorie des Mittelalters verpönt und gelang in der
Praxis erst mit dem Aufkommen einer neuen Weltbetrachtung um iZvo und mit
gewissen Soziallehren der Reformation. Daß vollends im 16. Jahrhundcrt auch
die katholi'sche Theologie mit der neuen Wirtschaftsgesinnung der Nenaissance pak-
tiert hat, daö war, verglichen mit der religiös gebundenen Wirtschafkslehre des
Mittelalters, ein schwerer Verrat; und seine Folge heute, daß keine Macht in der
Welt ist, die lm Namen des Christentums mi't der Kraft einer höheren Sanktion
dem Wi'rtschaftsgeist entgegentreten könnte, der Europa dem Derhängnis eines rein
materi'ali'stischen Wirtschaftslebens ausgeliefert hat. Ehe wir in diesem Punkt nicht
von Grund aus umdenken lernen, ist alle Ruhe trügerisch und der kaum verhallto
Weltkrieg nur der Anfang einer Katastrophe gewesen, die, wenn überhaupt einen
Sinn, nur diesen haben kann: daß sich daS Angesicht der Erde erneuern soll aus
einer tiefinnerst neuen Zwecksetzung für daS Ganze der Kultur. Die Wendung zum
Heil muß eine Wendung vom Jndividualismus zum — Sozialismus ist ein miß-
brauchtes und entehrtes Wort — Universalismus sein.
Universalistisch war das Mittelalter auch in seiner Staats-Auffassung. Jn ihr
lebte der Geist, von dem erfüllt Platon nicht nur die Gemeinwesen, sondern schon
den Einzelnen eine Systia genannt hatte, ein Wesen, das vollwertig nur im Mit^
Sein, in der elementaren Berwobenheit mit der Gemeinschaft bestehen kann. Aber
mehr noch als Platon mit seinem im weiteren Verlaufe utopistischen Staatsgedanken
war Aristoteles, der politisch konkretere Denker, der Meister des Mittelalters auch
in Dingen der Staatslehre geworden. Obwohl vor seinem Auge nicht unsere heutigen
Staatskolosse standen, sondern die kleinen politischen Gebilde der griechischen Stadt-
staaten mit Bürgern von naturhaft politischem Geblüt, mit einsacheren Mitteln der
politischen Formgebung, als sie uns in Parteien, Parlamenten und Presse gegeben
sind, so enthalten seine Grundsätze über den Staat dennoch für alle Zeit Gültiges,
und ohne ihre Kenntnis ist auch das Mittelalter nicht zu verstehen.
Worin gipfelt seine Lehre? Jn dem Gedanken: der Staat ist für den Menschen
da, nicht der Mensch für den Skaat. Er ist Mittel zu dem Ende, dem „menschlichen
Guten", der erreichbaren Dollkommenheit des Menschlichen in seinem ganzen Um-
176