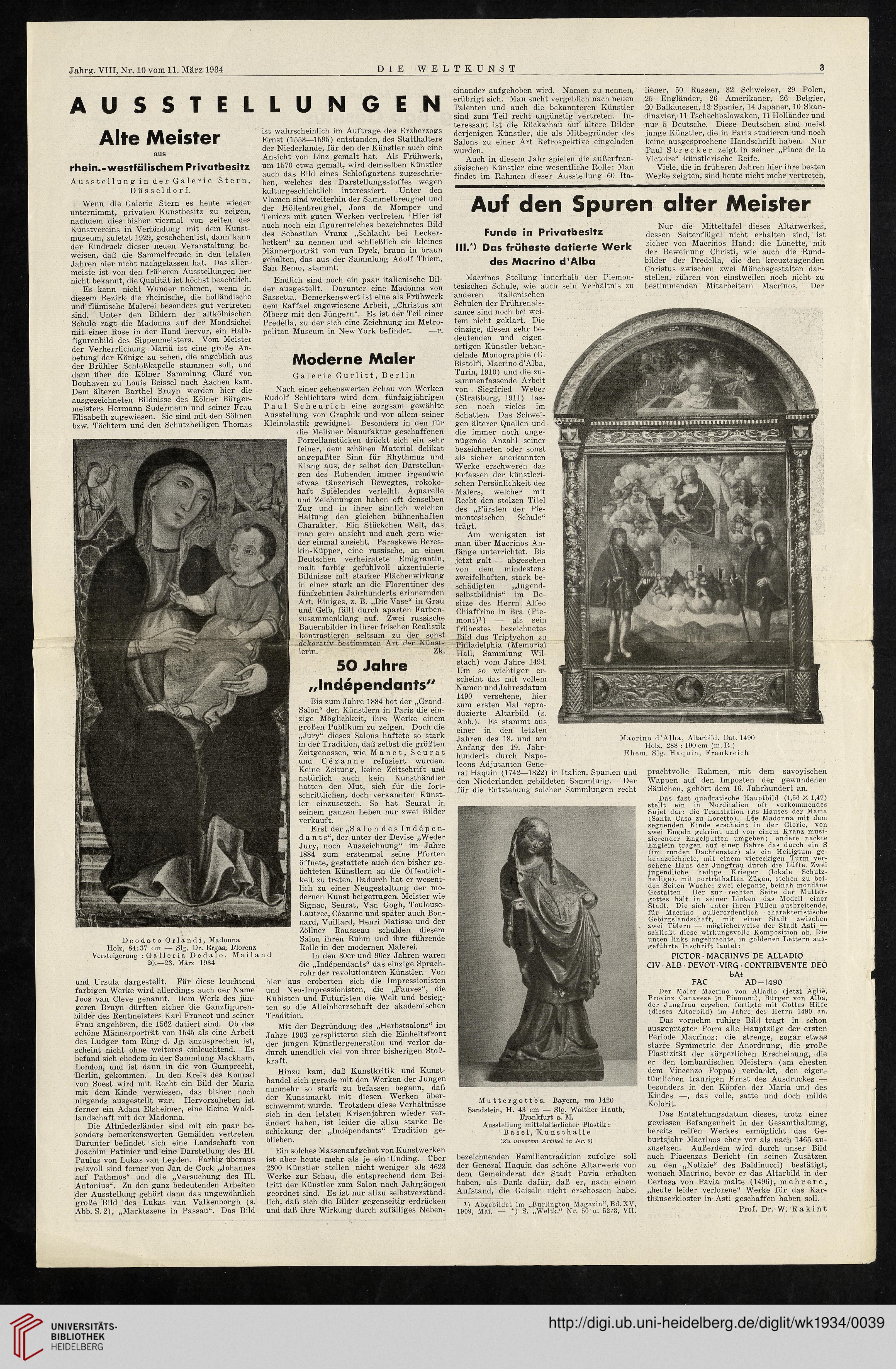Jahrg. VIII, Nr. 10 vom 11. März 1934
DIE WELTKUNST
3
AUSSTELLUNGEN
Alte Meister
aus
rhein.-westfälischem Privatbesitz
Ausstellung in der Galerie Stern,
Düsseldorf.
Wenn die Galerie Stern es heute wieder
unternimmt, privaten Kunstbesitz zu zeigen,
nachdem dies bisher viermal von Seiten des
Kunstvereins in Verbindung mit dem Kunst-
museum, zuletzt 1929, geschehen ist, dann kann
der Eindruck dieser neuen Veranstaltung be-
weisen, daß die Sammelfreude in den letzten
Jahren hier nicht nachgelassen hat. Das aller-
meiste ist von den früheren Ausstellungen her
nicht bekannt, die Qualität ist höchst beachtlich.
Es kann nicht Wunder nehmen, wenn in
diesem Bezirk die rheinische, die holländische
und' flämische Malerei besonders gut vertreten
sind. Unter den Bildern der altkölnischen
Schule ragt die Madonna auf der Mondsichel
mit einer Rose in der Hand hervor, ein Halb-
figurenbild des Sippenmeisters. Vom Meister
der Verherrlichung Mariä ist eine große An-
betung der Könige zu sehen, die angeblich aus
der Brühler Schloßkapelle stammen soll, und
dann über die Kölner Sammlung Clare von
Bouhaven zu Louis Beissel nach Aachen kam.
Dem älteren Barthel Bruyn werden hier die
ausgezeichneten Bildnisse des Kölner Bürger-
meisters Hermann Sudermann und seiner Frau
Elisabeth zugewiesen. Sie sind mit den Söhnen
bzw. Töchtern und den Schutzheiligen Thomas
ist wahrscheinlich im Auftrage des Erzherzogs
Emst (1553—1595) entstanden, des Statthalters
der Niederlande, für den der Künstler auch eine
Ansicht von Linz gemalt hat. Als Frühwerk,
um 1570 etwa gemalt, wird demselben Künstler
auch das Bild eines Schloßgartens zugeschrie-
ben, welches des Darstellungsstoffes wegen
kulturgeschichtlich interessiert. Unter den
Vlamen sind weiterhin der Sammetbreughel und
der Höllenbreughel, Joos de Momper und
Teniers mit guten Werken vertreten. Hier ist
auch noch ein figurenreiches bezeichnetes Bild
des Sebastian Vranx „Schlacht bei Lecker-
betken“ zu nennen und schließlich ein kleines
.Männerporträt von van Dyck, braun in braun
gehalten, das aus der Sammlung Adolf Thiem,
San Remo, stammt.
Endlich sind noch ein paar italienische Bil-
der ausgestellt. Darunter eine Madonna von
Sassetta. Bemerkenswert ist eine als Frühwerk
dem Raffael zugewiesene Arbeit, „Christus am
Ölberg mit den Jüngern“. Es ist der Teil einer
Predella, zu der sich eine Zeichnung im Metro-
politan Museum in New York befindet. —r.
Moderne Maler
Galerie Gurlitt, Berlin
Nach einer sehenswerten Schau von Werken
Rudolf Schlichters wird dem fünfzigjährigen
Paul Scheurich eine sorgsam gewählte
Ausstellung von Graphik und vor allem seiner
Kleinplastik gewidmet. Besonders in den für
die Meißner Manufaktur geschaffenen
Porzellanstücken drückt sich ein sehr
feiner, dem schönen Material delikat
angepaßter Sinn für Rhythmus und
Klang aus, der selbst den Darstellun-
gen des Ruhenden immer irgendwie
etwas tänzerisch Bewegtes, rokoko-
haft Spielendes verleiht. Aquarelle
und Zeichnungen haben oft denselben
Zug und in ihrer’ sinnlich weichen
Haltung den gleichen bühnenhaften
Charakter. Ein Stückchen Welt, das
man gern ansieht und auch gern wie-
der einmal ansieht. Paraskewe Beres-
kin-Küpper, eine russische, an einen
Deutschen verheiratete Emigrantin,
malt farbig gefühlvoll akzentuierte
Bildnisse mit starker Flächenwirkung
in einer stark an die Florentiner des
fünfzehnten Jahrhunderts erinnernden
Art. Einiges, z. B. „Die Vase“ in Grau
und Gelb, fällt durch aparten Farben-
zusammenklang auf. Zwei rassische
Bauernbilder in ihrer frischen Realistik
kontrastieren seltsam zu der sonst
dekorativ bestimmten Art der Künst-
lerin. Zk.
50 Jahre
„Independants"
Bis zum Jahre 1884 bot der „Grand-
Salon“ den Künstlern in Paris die ein-
zige Möglichkeit, ihre Werke einem
großen Publikum zu zeigen. Doch die
„Jury“ dieses Salons haftete so stark
in der Tradition, daß selbst die größten
Zeitgenossen, wie Manet, Seurat
und C e z a n n e refüsiert wurden.
Keine Zeitung, keine Zeitschrift und
natürlich auch kein Kunsthändler
hatten den Mut, sich für die fort-
schrittlichen, doch verkannten Künst-
ler einzusetzen. So hat Seurat in
seinem ganzen Leben nur zwei Bilder
verkauft.
Erst der „Salon des Indepen-
d a n t s“, der unter der Devise „Weder
Jury, noch Auszeichnung“ im Jahre
1884 zum erstenmal seine Pforten
öffnete, gestattete auch den bisher ge-
ächteten Künstlern an die Öffentlich-
keit zu treten. Dadurch hat er wesent-
lich zu einer Neugestaltung der mo-
dernen Kunst beigetragen. Meister wie
Signac, Seurat, Van Gogh, Toulouse-
Lautrec, Cezanne und später auch Bon-
nard, Vuillard, Henri Matisse und der
Zöllner Rousseau schulden diesem
Salon ihren Ruhm und ihre führende
Rolle in der modernen Malerei.
In den 80er und 90er Jahren waren
die „Independants“ das einzige Sprach-
rohr der revolutionären Künstler. Von
und Ursula dargestellt. Für diese leuchtend
farbigen Werke wird allerdings auch der Name
Joos van Cleve genannt. Dem Werk des jün-
geren Bruyn dürften sicher die Ganzfiguren-
bilder des Rentmeisters Karl Francot und seiner
hier aus eroberten sich die Impressionisten
und Neo-Impressionisten, die „Fauves“, die
Kubisten und Futuristen die Welt und besieg-
ten so die Alleinherrschaft der akademischen
Tradition.
Frau angehören, die 1562 datiert sind. Ob das
schöne Männerporträt von 1545 als eine Arbeit
des Ludger tom Ring d. Jg. anzusprechen ist,
scheint nicht ohne weiteres einleuchtend. Es
befand sich ehedem in der Sammlung Mackham,
London, und ist dann in die von Gumprecht,
Berlin, gekommen. In den Kreis des Konrad
von Soest wird mit Recht ein Bild der Maria
mit dem Kinde verwiesen, das bisher noch
nirgends ausgestellt war. Hervorzuheben ist
ferner ein Adam Elsheimer, eine kleine Wald-
landschaft mit der Madonna.
Die Altniederländer sind mit ein paar be-
sonders bemerkenswerten Gemälden vertreten.
Darunter befindet sich eine Landschaft von
Joachim Patinier und eine Darstellung des Hl.
Paulus von Lukas van Leyden. Farbig überaus
reizvoll sind ferner von Jan de Cock „Johannes
auf Pathmos“ und die „Versuchung des Hl.
Antonius“. Zu den ganz bedeutenden Arbeiten
der Ausstellung gehört dann das ungewöhnlich
große Bild des Lukas van Valkenborgh (s.
Abb. S. 2), „Marktszene in Passau“. Das Bild
Mit der Begründung des „Herbstsalons“ im
Jahre 1903 zersplitterte sich die Einheitsfront
der jungen Künstlergeneration und verlor da-
durch unendlich viel von ihrer bisherigen Stoß-
kraft.
Hinzu kam, daß Kunstkritik und Kunst-
handel sich gerade mit den Werken der Jungen
nunmehr so stark zu befassen begann, daß
der Kunstmarkt mit diesen Werken über-
schwemmt wurde. Trotzdem diese Verhältnisse
sich in den letzten Krisenjahren wieder ver-
ändert haben, ist leider die allzu starke Be-
schickung der „Independants“ Tradition ge-
blieben.
Ein solches Massenaufgebot von Kunstwerken
ist aber heute mehr als je ein Unding. Über
2300 Künstler stellen nicht weniger als 4623
Werke zur Schau, die entsprechend dem Bei-
tritt der Künstler zum Salon nach Jahrgängen
geordnet sind. Es ist nur allzu selbstverständ-
lich, daß sich die Bilder gegenseitig erdrücken
und daß ihre Wirkung durch zufälliges Neben-
einander aufgehoben wird. Namen zu nennen,
erübrigt sich. Man sucht vergeblich nach neuen
Talenten und auch die bekannteren Künstler
sind zum Teil recht ungünstig vertreten. In-
teressant ist die Rückschau auf ältere Bilder
derjenigen Künstler, die als Mitbegründer des
Salons zu einer Art Retrospektive eingeladen
wurden.
Auch in diesem Jahr spielen die außerfran-
zösischen Künstler eine wesentliche Rolle: Man
findet im Rahmen dieser Ausstellung 60 Ita-
liener, 50 Russen, 32 Schweizer, 29 Polen,
25 Engländer, 26 Amerikaner, 26 Belgier,
20 Balkanesen, 13 Spanier, 14 Japaner, 10 Skan-
dinavier, 11 Tschechoslowaken, 11 Holländer und
nur 5 Deutsche. Diese Deutschen sind meist
junge Künstler, die in Paris studieren und noch
keine ausgesprochene Handschrift haben. Nur
Paul Strecker zeigt in seiner „Place de la
Victoire“ künstlerische Reife.
Viele, die in früheren Jahren hier ihre besten
Werke zeigten, sind heute nicht mehr vertreten,
Auf den Spuren alter Meister
Funde in Privatbesitz
III.*) Das früheste datierte Werk
des Macrino d’Alba
Macrinos Stellung innerhalb der Piemon-
tesischen Schule, wie auch sein Verhältnis zu
Nur die Mitteltafel dieses Altarwerkes,
dessen Seitenflügel nicht erhalten sind, ist
sicher von Macrinos Hand: die Lünette, mit
der Beweinung Christi, wie auch die Rund-
bilder der Predella, die den kreuztragenden
Christus zwischen zwei Mönchsgestalten dar-
stellen, rühren von einstweilen noch nicht zu
bestimmenden Mitarbeitern Macrinos. Der
anderen italienischen
Schulen der Frührenais-
sance sind noch bei wei-
tem nicht geklärt. Die
einzige, diesen sehr be-
deutenden und eigen-
artigen Künstler behan-
delnde Monographie (G.
Bistolfi, Macrino d’Alba,
Turin, 1910) und die zu-
sammenfassende Arbeit
von Siegfried Weber
(Straßburg, 1911) las-
sen noch vieles im
Schatten. Das Schwei-
gen älterer Quellen und
die immer noch unge-
nügende Anzahl seiner
bezeichneten oder sonst
als sicher anerkannten
Werke erschweren das
Erfassen der künstleri-
schen Persönlichkeit des
Malers, welcher mit
Recht den stolzen Titel
des „Fürsten der Pie-
montesischen Schule“
trägt.
Am wenigsten ist
man über Macrinos An-
fänge unterrichtet. Bis
jetzt galt — abgesehen
von dem mindestens
zweifelhaften, stark be-
schädigten „Jugend-
selbstbildnis“ im Be-
sitze des Herrn Alfeo
Chiaffrino in Bra (Pie-
mont)1) —- als sein
frühestes bezeichnetes
Bild das Triptychon zu
Philadelphia (Memorial
Hall, Sammlung Wil-
stach) vom Jahre 1494.
Um so wichtiger er-
scheint das mit vollem
Namen und Jahresdatum
1490 versehene, hier
zum ersten Mal repro-
duzierte Altarbild (s.
Abb.). Es stammt aus
einer in den letzten
soll
Macrino d’Alba, Altarbild. Dat. 1490
Holz, 288 : 190 cm (m. R.)
Ehern. Slg. Haquin, Frankreich
Muttergottes. Bayern, um 1420
Sandstein, II. 43 cm — Slg. Walther Hauth,
Frankfurt a. M.
Ausstellung mittelalterlicher Plastik:
Basel, Kunsthalle
(Zu unserem Artikel in Nr. 9)
Jahren des 18. und am
Anfang des 19. Jahr¬
hunderts durch Napo¬
leons Adjutanten Gene¬
ral Haquin (1742—1822) in Italien, Spanien und
den Niederlanden gebildeten Sammlung. Der
für die Entstehung solcher Sammlungen recht
bezeichnenden Familientradition zufolge
der General Haquin das schöne Altarwerk von
dem Gemeinderat der Stadt Pavia erhalten
haben, als Dank dafür, daß er, nach einem
Aufstand, die Geiseln nicht erschossen habe.
1) Abgebildet im „Burlington Magazin“, Bd. XV,
1909, Mai. — *) S. „Weltk.“ Nr. 50 u. 52/3, VII.
prachtvolle Rahmen, mit dem savoyischen
Wappen auf den Imposten der gewundenen
Säulchen, gehört dem 16. Jahrhundert an.
Das fast quadratische Hauptbild (1,56 X 1,47)
stellt ein in Norditalien oft vorkommendes
Sujet dar: die Translation (los Hauses der Maria
(Santa Casa zu Loretta). Die Madonna mit dem
segnenden Kinde erscheint in der Glorie, von
zwei Engeln gekrönt und von einem Kranz musi-
zierender Engelputten umgeben; andere nackte
Englein tragen auf einer Bahre das durch ein S
(im runden Dachfenster) als ein Heiligtum ge-
kennzeichnete, mit einem viereckigen Turm ver-
sehene Haus der Jungfrau durch die Lüfte. Zwei
jugendliche heilige Krieger (lokale Schutz-
heilige), mit porträthaften Zügen, stehen zu bei-
den Seiten Wache: zwei elegante, beinah mondäne
Gestalten. Der zur rechten Seite der Mutter-
gottes hält in seiner Linken das Modell einer
Stadt. Die sich unter ihren Füßen ausbreitende,
für Macrino außerordentlich charakteristische
Gebirgslandschaft, mit einer Stadt zwischen
zwei Tälern — möglicherweise der Stadt Asti —■
schließt diese wirkungsvolle Komposition ab. Die
unten links angebrachte, in goldenen Lettern aus-
geführte Inschrift lautet:
PICTOR • MACR1NVS DE ALLADIO
CIV ■ ALB • DEVOT -VIRQ • CONTRIBVENTE DEO
bAt
FAC AD-1490
Der Maler Macrino von Alladio (jetzt Aglie,
Provinz Canavese in Piemont), Bürger von Alba,
der Jungfrau ergeben, fertigte mit Gottes Hilfe
(dieses Altarbild) im Jahre des Herrn 1490 an.
Das vornehm ruhige Bild trägt in schon
ausgeprägter Form alle Hauptzüge der ersten
Periode Macrinos: die strenge, sogar etwas
starre Symmetrie der Anordnung, die große
Plastizität der körperlichen Erscheinung, die
er den lombardischen Meistern (am ehesten
dem Vincenzo Foppa) verdankt, den eigen-
tümlichen traurigen Ernst des Ausdruckes —
besonders in den Köpfen der Maria und des
Kindes —, das volle, satte und doch milde
Kolorit.
Das Entstehungsdatum dieses, trotz einer
gewissen Befangenheit in der Gesamthaltung,
bereits reifen Werkes ermöglicht das Ge-
burtsjahr Macrinos eher vor als nach 1465 an-
zusetzen. Außerdem wird durch unser Bild
auch Piacenzas Bericht (in seinen Zusätzen
zu den „Notizie“ des Baldinucci) bestätigt,
wonach Macrino, bevor er das Altarbild in der
Certosa von Pavia malte (1496), mehrere,
„heute leider verlorene“ Werke für das Kar-
thäuserkloster in Asti geschaffen haben soll.
Prof. Dr. W. R a k i n t
DIE WELTKUNST
3
AUSSTELLUNGEN
Alte Meister
aus
rhein.-westfälischem Privatbesitz
Ausstellung in der Galerie Stern,
Düsseldorf.
Wenn die Galerie Stern es heute wieder
unternimmt, privaten Kunstbesitz zu zeigen,
nachdem dies bisher viermal von Seiten des
Kunstvereins in Verbindung mit dem Kunst-
museum, zuletzt 1929, geschehen ist, dann kann
der Eindruck dieser neuen Veranstaltung be-
weisen, daß die Sammelfreude in den letzten
Jahren hier nicht nachgelassen hat. Das aller-
meiste ist von den früheren Ausstellungen her
nicht bekannt, die Qualität ist höchst beachtlich.
Es kann nicht Wunder nehmen, wenn in
diesem Bezirk die rheinische, die holländische
und' flämische Malerei besonders gut vertreten
sind. Unter den Bildern der altkölnischen
Schule ragt die Madonna auf der Mondsichel
mit einer Rose in der Hand hervor, ein Halb-
figurenbild des Sippenmeisters. Vom Meister
der Verherrlichung Mariä ist eine große An-
betung der Könige zu sehen, die angeblich aus
der Brühler Schloßkapelle stammen soll, und
dann über die Kölner Sammlung Clare von
Bouhaven zu Louis Beissel nach Aachen kam.
Dem älteren Barthel Bruyn werden hier die
ausgezeichneten Bildnisse des Kölner Bürger-
meisters Hermann Sudermann und seiner Frau
Elisabeth zugewiesen. Sie sind mit den Söhnen
bzw. Töchtern und den Schutzheiligen Thomas
ist wahrscheinlich im Auftrage des Erzherzogs
Emst (1553—1595) entstanden, des Statthalters
der Niederlande, für den der Künstler auch eine
Ansicht von Linz gemalt hat. Als Frühwerk,
um 1570 etwa gemalt, wird demselben Künstler
auch das Bild eines Schloßgartens zugeschrie-
ben, welches des Darstellungsstoffes wegen
kulturgeschichtlich interessiert. Unter den
Vlamen sind weiterhin der Sammetbreughel und
der Höllenbreughel, Joos de Momper und
Teniers mit guten Werken vertreten. Hier ist
auch noch ein figurenreiches bezeichnetes Bild
des Sebastian Vranx „Schlacht bei Lecker-
betken“ zu nennen und schließlich ein kleines
.Männerporträt von van Dyck, braun in braun
gehalten, das aus der Sammlung Adolf Thiem,
San Remo, stammt.
Endlich sind noch ein paar italienische Bil-
der ausgestellt. Darunter eine Madonna von
Sassetta. Bemerkenswert ist eine als Frühwerk
dem Raffael zugewiesene Arbeit, „Christus am
Ölberg mit den Jüngern“. Es ist der Teil einer
Predella, zu der sich eine Zeichnung im Metro-
politan Museum in New York befindet. —r.
Moderne Maler
Galerie Gurlitt, Berlin
Nach einer sehenswerten Schau von Werken
Rudolf Schlichters wird dem fünfzigjährigen
Paul Scheurich eine sorgsam gewählte
Ausstellung von Graphik und vor allem seiner
Kleinplastik gewidmet. Besonders in den für
die Meißner Manufaktur geschaffenen
Porzellanstücken drückt sich ein sehr
feiner, dem schönen Material delikat
angepaßter Sinn für Rhythmus und
Klang aus, der selbst den Darstellun-
gen des Ruhenden immer irgendwie
etwas tänzerisch Bewegtes, rokoko-
haft Spielendes verleiht. Aquarelle
und Zeichnungen haben oft denselben
Zug und in ihrer’ sinnlich weichen
Haltung den gleichen bühnenhaften
Charakter. Ein Stückchen Welt, das
man gern ansieht und auch gern wie-
der einmal ansieht. Paraskewe Beres-
kin-Küpper, eine russische, an einen
Deutschen verheiratete Emigrantin,
malt farbig gefühlvoll akzentuierte
Bildnisse mit starker Flächenwirkung
in einer stark an die Florentiner des
fünfzehnten Jahrhunderts erinnernden
Art. Einiges, z. B. „Die Vase“ in Grau
und Gelb, fällt durch aparten Farben-
zusammenklang auf. Zwei rassische
Bauernbilder in ihrer frischen Realistik
kontrastieren seltsam zu der sonst
dekorativ bestimmten Art der Künst-
lerin. Zk.
50 Jahre
„Independants"
Bis zum Jahre 1884 bot der „Grand-
Salon“ den Künstlern in Paris die ein-
zige Möglichkeit, ihre Werke einem
großen Publikum zu zeigen. Doch die
„Jury“ dieses Salons haftete so stark
in der Tradition, daß selbst die größten
Zeitgenossen, wie Manet, Seurat
und C e z a n n e refüsiert wurden.
Keine Zeitung, keine Zeitschrift und
natürlich auch kein Kunsthändler
hatten den Mut, sich für die fort-
schrittlichen, doch verkannten Künst-
ler einzusetzen. So hat Seurat in
seinem ganzen Leben nur zwei Bilder
verkauft.
Erst der „Salon des Indepen-
d a n t s“, der unter der Devise „Weder
Jury, noch Auszeichnung“ im Jahre
1884 zum erstenmal seine Pforten
öffnete, gestattete auch den bisher ge-
ächteten Künstlern an die Öffentlich-
keit zu treten. Dadurch hat er wesent-
lich zu einer Neugestaltung der mo-
dernen Kunst beigetragen. Meister wie
Signac, Seurat, Van Gogh, Toulouse-
Lautrec, Cezanne und später auch Bon-
nard, Vuillard, Henri Matisse und der
Zöllner Rousseau schulden diesem
Salon ihren Ruhm und ihre führende
Rolle in der modernen Malerei.
In den 80er und 90er Jahren waren
die „Independants“ das einzige Sprach-
rohr der revolutionären Künstler. Von
und Ursula dargestellt. Für diese leuchtend
farbigen Werke wird allerdings auch der Name
Joos van Cleve genannt. Dem Werk des jün-
geren Bruyn dürften sicher die Ganzfiguren-
bilder des Rentmeisters Karl Francot und seiner
hier aus eroberten sich die Impressionisten
und Neo-Impressionisten, die „Fauves“, die
Kubisten und Futuristen die Welt und besieg-
ten so die Alleinherrschaft der akademischen
Tradition.
Frau angehören, die 1562 datiert sind. Ob das
schöne Männerporträt von 1545 als eine Arbeit
des Ludger tom Ring d. Jg. anzusprechen ist,
scheint nicht ohne weiteres einleuchtend. Es
befand sich ehedem in der Sammlung Mackham,
London, und ist dann in die von Gumprecht,
Berlin, gekommen. In den Kreis des Konrad
von Soest wird mit Recht ein Bild der Maria
mit dem Kinde verwiesen, das bisher noch
nirgends ausgestellt war. Hervorzuheben ist
ferner ein Adam Elsheimer, eine kleine Wald-
landschaft mit der Madonna.
Die Altniederländer sind mit ein paar be-
sonders bemerkenswerten Gemälden vertreten.
Darunter befindet sich eine Landschaft von
Joachim Patinier und eine Darstellung des Hl.
Paulus von Lukas van Leyden. Farbig überaus
reizvoll sind ferner von Jan de Cock „Johannes
auf Pathmos“ und die „Versuchung des Hl.
Antonius“. Zu den ganz bedeutenden Arbeiten
der Ausstellung gehört dann das ungewöhnlich
große Bild des Lukas van Valkenborgh (s.
Abb. S. 2), „Marktszene in Passau“. Das Bild
Mit der Begründung des „Herbstsalons“ im
Jahre 1903 zersplitterte sich die Einheitsfront
der jungen Künstlergeneration und verlor da-
durch unendlich viel von ihrer bisherigen Stoß-
kraft.
Hinzu kam, daß Kunstkritik und Kunst-
handel sich gerade mit den Werken der Jungen
nunmehr so stark zu befassen begann, daß
der Kunstmarkt mit diesen Werken über-
schwemmt wurde. Trotzdem diese Verhältnisse
sich in den letzten Krisenjahren wieder ver-
ändert haben, ist leider die allzu starke Be-
schickung der „Independants“ Tradition ge-
blieben.
Ein solches Massenaufgebot von Kunstwerken
ist aber heute mehr als je ein Unding. Über
2300 Künstler stellen nicht weniger als 4623
Werke zur Schau, die entsprechend dem Bei-
tritt der Künstler zum Salon nach Jahrgängen
geordnet sind. Es ist nur allzu selbstverständ-
lich, daß sich die Bilder gegenseitig erdrücken
und daß ihre Wirkung durch zufälliges Neben-
einander aufgehoben wird. Namen zu nennen,
erübrigt sich. Man sucht vergeblich nach neuen
Talenten und auch die bekannteren Künstler
sind zum Teil recht ungünstig vertreten. In-
teressant ist die Rückschau auf ältere Bilder
derjenigen Künstler, die als Mitbegründer des
Salons zu einer Art Retrospektive eingeladen
wurden.
Auch in diesem Jahr spielen die außerfran-
zösischen Künstler eine wesentliche Rolle: Man
findet im Rahmen dieser Ausstellung 60 Ita-
liener, 50 Russen, 32 Schweizer, 29 Polen,
25 Engländer, 26 Amerikaner, 26 Belgier,
20 Balkanesen, 13 Spanier, 14 Japaner, 10 Skan-
dinavier, 11 Tschechoslowaken, 11 Holländer und
nur 5 Deutsche. Diese Deutschen sind meist
junge Künstler, die in Paris studieren und noch
keine ausgesprochene Handschrift haben. Nur
Paul Strecker zeigt in seiner „Place de la
Victoire“ künstlerische Reife.
Viele, die in früheren Jahren hier ihre besten
Werke zeigten, sind heute nicht mehr vertreten,
Auf den Spuren alter Meister
Funde in Privatbesitz
III.*) Das früheste datierte Werk
des Macrino d’Alba
Macrinos Stellung innerhalb der Piemon-
tesischen Schule, wie auch sein Verhältnis zu
Nur die Mitteltafel dieses Altarwerkes,
dessen Seitenflügel nicht erhalten sind, ist
sicher von Macrinos Hand: die Lünette, mit
der Beweinung Christi, wie auch die Rund-
bilder der Predella, die den kreuztragenden
Christus zwischen zwei Mönchsgestalten dar-
stellen, rühren von einstweilen noch nicht zu
bestimmenden Mitarbeitern Macrinos. Der
anderen italienischen
Schulen der Frührenais-
sance sind noch bei wei-
tem nicht geklärt. Die
einzige, diesen sehr be-
deutenden und eigen-
artigen Künstler behan-
delnde Monographie (G.
Bistolfi, Macrino d’Alba,
Turin, 1910) und die zu-
sammenfassende Arbeit
von Siegfried Weber
(Straßburg, 1911) las-
sen noch vieles im
Schatten. Das Schwei-
gen älterer Quellen und
die immer noch unge-
nügende Anzahl seiner
bezeichneten oder sonst
als sicher anerkannten
Werke erschweren das
Erfassen der künstleri-
schen Persönlichkeit des
Malers, welcher mit
Recht den stolzen Titel
des „Fürsten der Pie-
montesischen Schule“
trägt.
Am wenigsten ist
man über Macrinos An-
fänge unterrichtet. Bis
jetzt galt — abgesehen
von dem mindestens
zweifelhaften, stark be-
schädigten „Jugend-
selbstbildnis“ im Be-
sitze des Herrn Alfeo
Chiaffrino in Bra (Pie-
mont)1) —- als sein
frühestes bezeichnetes
Bild das Triptychon zu
Philadelphia (Memorial
Hall, Sammlung Wil-
stach) vom Jahre 1494.
Um so wichtiger er-
scheint das mit vollem
Namen und Jahresdatum
1490 versehene, hier
zum ersten Mal repro-
duzierte Altarbild (s.
Abb.). Es stammt aus
einer in den letzten
soll
Macrino d’Alba, Altarbild. Dat. 1490
Holz, 288 : 190 cm (m. R.)
Ehern. Slg. Haquin, Frankreich
Muttergottes. Bayern, um 1420
Sandstein, II. 43 cm — Slg. Walther Hauth,
Frankfurt a. M.
Ausstellung mittelalterlicher Plastik:
Basel, Kunsthalle
(Zu unserem Artikel in Nr. 9)
Jahren des 18. und am
Anfang des 19. Jahr¬
hunderts durch Napo¬
leons Adjutanten Gene¬
ral Haquin (1742—1822) in Italien, Spanien und
den Niederlanden gebildeten Sammlung. Der
für die Entstehung solcher Sammlungen recht
bezeichnenden Familientradition zufolge
der General Haquin das schöne Altarwerk von
dem Gemeinderat der Stadt Pavia erhalten
haben, als Dank dafür, daß er, nach einem
Aufstand, die Geiseln nicht erschossen habe.
1) Abgebildet im „Burlington Magazin“, Bd. XV,
1909, Mai. — *) S. „Weltk.“ Nr. 50 u. 52/3, VII.
prachtvolle Rahmen, mit dem savoyischen
Wappen auf den Imposten der gewundenen
Säulchen, gehört dem 16. Jahrhundert an.
Das fast quadratische Hauptbild (1,56 X 1,47)
stellt ein in Norditalien oft vorkommendes
Sujet dar: die Translation (los Hauses der Maria
(Santa Casa zu Loretta). Die Madonna mit dem
segnenden Kinde erscheint in der Glorie, von
zwei Engeln gekrönt und von einem Kranz musi-
zierender Engelputten umgeben; andere nackte
Englein tragen auf einer Bahre das durch ein S
(im runden Dachfenster) als ein Heiligtum ge-
kennzeichnete, mit einem viereckigen Turm ver-
sehene Haus der Jungfrau durch die Lüfte. Zwei
jugendliche heilige Krieger (lokale Schutz-
heilige), mit porträthaften Zügen, stehen zu bei-
den Seiten Wache: zwei elegante, beinah mondäne
Gestalten. Der zur rechten Seite der Mutter-
gottes hält in seiner Linken das Modell einer
Stadt. Die sich unter ihren Füßen ausbreitende,
für Macrino außerordentlich charakteristische
Gebirgslandschaft, mit einer Stadt zwischen
zwei Tälern — möglicherweise der Stadt Asti —■
schließt diese wirkungsvolle Komposition ab. Die
unten links angebrachte, in goldenen Lettern aus-
geführte Inschrift lautet:
PICTOR • MACR1NVS DE ALLADIO
CIV ■ ALB • DEVOT -VIRQ • CONTRIBVENTE DEO
bAt
FAC AD-1490
Der Maler Macrino von Alladio (jetzt Aglie,
Provinz Canavese in Piemont), Bürger von Alba,
der Jungfrau ergeben, fertigte mit Gottes Hilfe
(dieses Altarbild) im Jahre des Herrn 1490 an.
Das vornehm ruhige Bild trägt in schon
ausgeprägter Form alle Hauptzüge der ersten
Periode Macrinos: die strenge, sogar etwas
starre Symmetrie der Anordnung, die große
Plastizität der körperlichen Erscheinung, die
er den lombardischen Meistern (am ehesten
dem Vincenzo Foppa) verdankt, den eigen-
tümlichen traurigen Ernst des Ausdruckes —
besonders in den Köpfen der Maria und des
Kindes —, das volle, satte und doch milde
Kolorit.
Das Entstehungsdatum dieses, trotz einer
gewissen Befangenheit in der Gesamthaltung,
bereits reifen Werkes ermöglicht das Ge-
burtsjahr Macrinos eher vor als nach 1465 an-
zusetzen. Außerdem wird durch unser Bild
auch Piacenzas Bericht (in seinen Zusätzen
zu den „Notizie“ des Baldinucci) bestätigt,
wonach Macrino, bevor er das Altarbild in der
Certosa von Pavia malte (1496), mehrere,
„heute leider verlorene“ Werke für das Kar-
thäuserkloster in Asti geschaffen haben soll.
Prof. Dr. W. R a k i n t