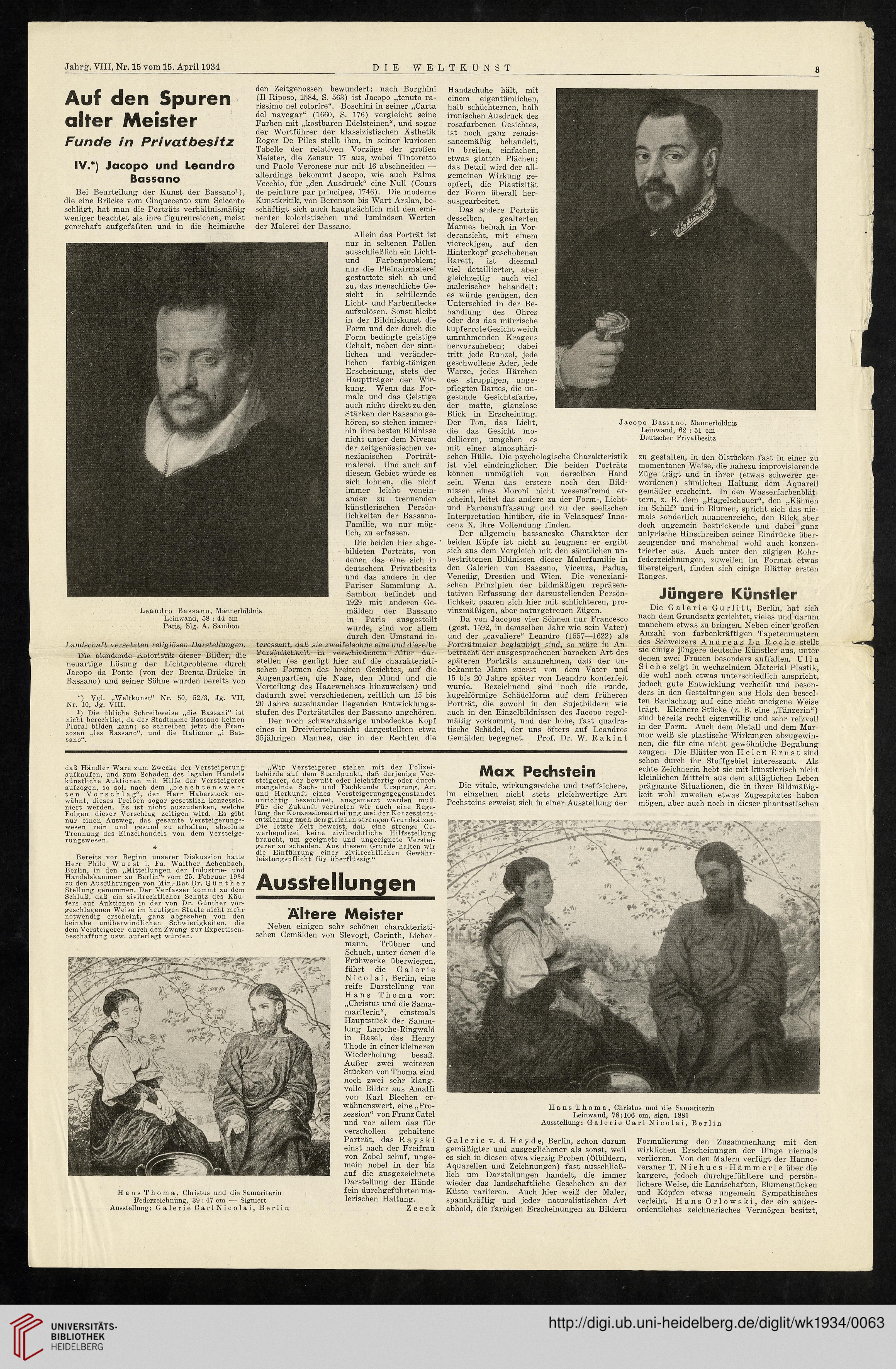Jahrg. VIII, Nr. 15 vom 15. April 1934
DIE WELTKUNST
3
Auf den Spuren
alter Meister
Funde in Privatbesitz
IV.* *) Jacopo und Leandro
Bassano
Bei Beurteilung der Kunst der Bassano1),
die eine Brücke vom Cinquecento zum Seicento
schlägt, hat man die Porträts verhältnismäßig
weniger beachtet als ihre figurenreichen, meist
genrehaft aufgefaßten und in die heimische
Landschaft versetzten religiösen Darstellungen.
Die blendende Koloristik dieser Bilder, die
neuartige Lösung der Lichtprobleme durch
Jacopo da Ponte (von der Brenta-Brücke in
Bassano) und seiner Söhne wurden bereits von
*) Vgl. „Weltkunst“ Nr. 50, 52/3, Jg. VII,
Nr. 10, Jg. VIII.
1) Die übliche Schreibweise „die Bassani“ ist
nicht berechtigt, da der Stadtname Bassano keinen
Plural bilden kann; so schreiben jetzt die Fran-
zosen „les Bassano“, und die Italiener „i Bas-
sano“.
den Zeitgenossen bewundert: nach Borghini
(II Riposo, 1584, S. 563) ist Jacopo „tenuto ra-
rissimo nel colorire“. Boschini in seiner „Carta
del navegar“ (1660, S. 176) vergleicht seine
Farben mit „kostbaren Edelsteinen“, und sogar
der Wortführer der klassizistischen Ästhetik
Roger De Piles stellt ihm, in seiner kuriosen
Tabelle der relativen Vorzüge der großen
Meister, die Zensur 17 aus, wobei Tintoretto
und Paolo Veronese nur mit 16 abschneiden —
allerdings bekommt Jacopo, wie auch Palma
Vecchio, für „den Ausdruck“ eine Null (Cours
de peinture par principes, 1746). Die moderne
Kunstkritik, von Berenson bis Wart Arslan, be-
schäftigt sich auch hauptsächlich mit den emi-
nenten koloristischen und luminösen Werten
der Malerei der Bassano.
Allein das Porträt ist
nur in seltenen Fällen
ausschließlich ein Licht-
und Farbenproblem;
nur die Pleinairmalerei
gestattete sich ab und
zu, das menschliche Ge-
sicht in schillernde
Licht- und Farbenflecke
aufzulösen. Sonst bleibt
in der Bildniskunst die
Form und der durch die
Form bedingte geistige
Gehalt, neben der sinn-
lichen und veränder-
lichen farbig-tönigen
Erscheinung, stets der
Hauptträger der Wir-
kung. Wenn das For-
male und das Geistige
auch nicht direkt zu den
Stärken der Bassano ge-
hören, so stehen immer-
hin ihre besten Bildnisse
nicht unter dem Niveau
der zeitgenössischen ve-
nezianischen Porträt-
malerei. Und auch auf
diesem Gebiet würde es
sich lohnen, die nicht
immer leicht vonein-
ander zu trennenden
künstlerischen Persön-
lichkeiten der Bassano-
Familie, wo nur mög-
lich, zu erfassen.
Die beiden hier abge-
bildeten Porträts, von
denen das eine sich in
deutschem Privatbesitz
und das andere in der
Pariser Sammlung A.
Sambon befindet und
1929 mit anderen Ge-
mälden der Bassano
in Paris ausgestellt
wurde, sind vor allem
durch den Umstand in-
teressant, daß sie zweifelsohne eine und dieselbe
Persönlichkeit in verschiedenem Alter dar-
stellen (es genügt hier auf die charakteristi-
schen Formen des breiten Gesichtes, auf die
Augenpartien, die Nase, den Mund und die
Verteilung des Haarwuchses hinzuweisen) und
dadurch zwei verschiedenen, zeitlich um 15 bis
20 Jahre auseinander liegenden Entwicklungs-
stufen des Porträtstiles der Bassano angehören.
Der noch schwarzhaarige unbedeckte Kopf
eines in Dreiviertelansicht dargestellten etwa
35jährigen Mannes, der in der Rechten die
Leandro Bassano, Männerbildnis
Leinwand, 58 : 44 ein
Paris, Slg. A. Sambon
daß Händler Ware zum Zwecke der Versteigerung
aufkaufen, und zum Schaden des legalen Handels
künstliche Auktionen mit Hilfe der Versteigerer
aufzogen, so soll nach dem „beachtenswer-
ten Vorschlag“, den Herr Haberstock er-
wähnt, dieses Treiben sogar gesetzlich konzessio-
niert werden. Es ist nicht auszudenken, welche
Folgen dieser Vorschlag zeitigen wird. Es gibt
nur einen Ausweg, das gesamte Versteigerungs-
wesen rein und gesund zu erhalten, absolute
Trennung des Einzelhandels von dem Versteige-
rungswesen.
*
Bereits vor Beginn unserer Diskussion hatte
Herr Philo W u e st i. Fa. Walther Achenbach,
Berlin, in den „Mitteilungen der Industrie- und
Handelskammer zu Berlin“- vom 25. Februar 1934
zu den Ausführungen von Min.-Rat Dr. Günther
Stellung genommen. Der Verfasser kommt zu dem
Schluß, daß ein zivilrechtlicher Schutz des Käu-
fers auf Auktionen in der von Dr. Günther vor-
geschlagenen Weise im heutigen Staate nicht mehr
notwendig erscheint, ganz abgesehen von den
beinahe unüberwindlichen Schwierigkeiten, die
dem Versteigerer durch den Zwang zur Expertisen-
beschaffung usw. auferlegt würden.
„Wir Versteigerer stehen mit der Polizei-
behörde auf dem Standpunkt, daß derjenige Ver-
steigerer, der bewußt oder leichtfertig oder durch
mangelnde Sach- und Fachkunde Ursprung, Art
und Herkunft eines Versteigerungsgegenstandes
unrichtig bezeichnet, ausgemerzt werden muß.
Für die Zukunft vertreten wir auch eine Rege-
lung der Konizessioniserteilung unid der Konzessiions-
entziehuing nach dien gleichen strengen Grundsätzen.
Die letzte Zeit beweist, daß eine strenge Ge-
werbepolizei keine zivilrechtliche Hilfsstellung
braucht, um geeignete und ungeeignete Verstei-
gerer zu scheiden. Aus diesem Grunde halten wir
die Einführung einer zivilrechtlichen Gewähr-
leistungspflicht für überflüssig.“
Ausstellungen
Ältere Meister
Neben einigen sehr schönen charakteristi-
schen Gemälden von Slevogt, Corinth, Lieber-
mann, Trübner und
Schuch, unter denen die
Frühwerke überwiegen,
führt die Galerie
Nicolai, Berlin, eine
reife Darstellung von
Hans Thoma vor:
„Christus und die Sama-
mariterin“, einstmals
Hauptstück der Samm-
lung Laroche-Ringwald
in Basel, das Henry
Thode in einer kleineren
Wiederholung besaß.
Außer zwei weiteren
Stücken von Thoma sind
noch zwei sehr klang-
volle Bilder aus Amalfi
von Karl Blechen er-
wähnenswert, eine „Pro-
zession“ von Franz Catel
und vor allem das für
verschollen gehaltene
Porträt, das R ay ski
einst nach der Freifrau
von Zobel schuf, unge-
mein nobel in der bis
auf die ausgezeichnete
Darstellung der Hände
fein durchgeführten ma-
lerischen Haltung.
Z e e c k
Hans Tlioma, Christus und die Samariterin
Federzeichnung, 39 : 47 cm — Signiert
Ausstellung: Galerie CarlNicolai, Berlin
Handschuhe hält, mit
einem eigentümlichen,
halb schüchternen, halb
ironischen Ausdruck des
rosafarbenen Gesichtes,
ist noch ganz renais¬
sancemäßig behandelt,
in breiten, einfachen,
etwas glatten Flächen;
das Detail wird der all¬
gemeinen Wirkung ge¬
opfert, die Plastizität
der Form überall her-
ausgearbeitet.
Das andere Porträt
desselben, gealterten
Mannes beinah in Vor¬
deransicht, mit einem
viereckigen, auf den
Hinterkopf geschobenen
Barett, ist diesmal
viel detaillierter, aber
gleichzeitig auch viel
malerischer behandelt:
es würde genügen, den
Unterschied in der Be-
handlung des Ohres
oder des das mürrische
kupferrote Gesicht weich
umrahmenden Kragens
hervorzuheben; dabei
tritt jede Runzel, jede
geschwollene Ader, jede
Warze, jedes Härchen
des struppigen, unge-
pflegten Bartes, die un-
gesunde Gesichtsfarbe,
der matte, glanzlose
Blick in Erscheinung.
Der Ton, das Licht,
die das Gesicht mo¬
dellieren, umgeben es
mit einer atmosphäri¬
schen Hülle. Die psychologische Charakteristik
ist viel eindringlicher. Die beiden Porträts
können unmöglich von derselben Hand
sein. Wenn das erstere noch den Bild-
nissen eines Moroni nicht wesensfremd er-
scheint, leitet das andere zu der Form-, Licht-
und Farbenauffassung und zu der seelischen
Interpretation hinüber, die in Velasquez’ Inno-
cenz X. ihre Vollendung finden.
Der allgemein bassaneske Charakter der
beiden Köpfe ist nicht zu leugnen: er ergibt
sich aus dem Vergleich mit den sämtlichen un-
bestrittenen Bildnissen dieser Malerfamilie in
den Galerien von Bassano, Vicenza, Padua,
Venedig, Dresden und Wien. Die veneziani-
schen Prinzipien der bildmäßigen repräsen-
tativen Erfassung der darzustellenden Persön-
lichkeit paaren sich hier mit schlichteren, pro-
vinzmäßigen, aber naturgetreuen Zügen.
Da von Jacopos vier Söhnen nur Francesco
(gest. 1592, in demselben Jahr wie sein Vater)
und der „Cavaliere“ Leandro (1557—1622) als
Porträtmaler beglaubigt sind, so wäre in An-
betracht der ausgesprochenen barocken Art des
späteren Porträts anzunehmen, daß der un-
bekannte Mann zuerst von dem Vater und
15 bis 20 Jahre später von Leandro konterfeit
wurde. Bezeichnend sind noch die runde,
kugelförmige Schädelform auf dem früheren
Porträt, die sowohl in den Sujetbildern wie
auch in den Einzelbildnissen des Jacopo regel-
mäßig vorkommt, und der hohe, fast quadra-
tische Schädel, der uns öfters auf Leandros
Gemälden begegnet. Prof. Dr. W. R a k i n t
Max Pechstein
Die vitale, wirkungsreiche und treffsichere,
im einzelnen nicht stets gleichwertige Art
Pechsteins erweist sich in einer Ausstellung der
acopo Bassano, Männerbildiüs
Leinwand, 62 : 51 cm
Deutscher Privatbesitz
zu gestalten, in den Ölstücken fast in einer zu
momentanen Weise, die nahezu improvisierende
Züge trägt und in ihrer (etwas schwerer ge-
wordenen) sinnlichen Haltung dem Aquarell
gemäßer erscheint. In den Wasserfarbenblät-
tern, z. B. dem „Hagelschauer“, den „Kähnen
im Schilf“ und in Blumen, spricht sich das nie-
mals sonderlich nuancenreiche, den Blick aber
doch ungemein bestrickende und dabei ganz
unlyrische Hinschreiben seiner Eindrücke über-
zeugender und manchmal wohl auch konzen-
trierter aus. Auch unter den zügigen Rohr-
federzeichnungen, zuweilen im Format etwas
übersteigert, finden sich einige Blätter ersten
Ranges.
Jüngere Künstler
Die Galerie Gurlitt, Berlin, hat sich
nach dem Grundsatz gerichtet, vieles und darum
manchem etwas zu bringen. Neben einer großen
Anzahl von farbenkräftigen Tapetenmustern
des Schweizers Andreas La Roche stellt
sie einige jüngere deutsche Künstler aus, unter
denen zwei Frauen besonders auffallen. Ulla
Siebe zeigt in wechselndem Material Plastik,
die wohl noch etwas unterschiedlich anspricht,
jedoch gute Entwicklung verheißt und beson-
ders in den Gestaltungen aus Holz den beseel-
ten Barlachzug auf eine nicht uneigene Weise
trägt. Kleinere Stücke (z. B. eine „Tänzerin“)
sind bereits recht eigenwillig und sehr reizvoll
in der Form. Auch dem Metall und dem Mar-
mor weiß sie plastische Wirkungen abzugewin-
nen, die für eine nicht gewöhnliche Begabung
zeugen. Die Blätter von Helen Ernst sind
schon durch ihr Stoffgebiet interessant. Als
echte Zeichnerin hebt sie mit künstlerisch nicht
kleinlichen Mitteln aus dem alltäglichen Leben
prägnante Situationen, die in ihrer Bildmäßig-
keit wohl zuweilen etwas Zugespitztes haben
mögen, aber auch noch in dieser phantastischen
J
Hans Thoma, Christus und die Samariterin
Leinwand, 78:106 cm, sign. 1881
Ausstellung: Galerie Carl Nicolai, Berlin
Galerie v. d. Heyde, Berlin, schon darum
gemäßigter und ausgeglichener als sonst, weil
es sich in diesen etwa vierzig Proben (Ölbildern,
Aquarellen und Zeichnungen) fast ausschließ-
lich um Darstellungen handelt, die immer
wieder das landschaftliche Geschehen an der
Küste variieren. Auch hier weiß der Maler,
spannkräftig und jeder naturalistischen Art
abhold, die farbigen Erscheinungen zu Bildern
Formulierung den Zusammenhang mit den
wirklichen Erscheinungen der Dinge niemals
verlieren. Von den Malern verfügt der Hanno-
veraner T. Niehues-Hämmerle über die
kargere, jedoch durchgefühltere und persön-
lichere Weise, die Landschaften, Blumenstücken
und Köpfen etwas ungemein Sympathisches
verleiht. Hans Orlowski, der ein außer-
ordentliches zeichnerisches Vermögen besitzt,
DIE WELTKUNST
3
Auf den Spuren
alter Meister
Funde in Privatbesitz
IV.* *) Jacopo und Leandro
Bassano
Bei Beurteilung der Kunst der Bassano1),
die eine Brücke vom Cinquecento zum Seicento
schlägt, hat man die Porträts verhältnismäßig
weniger beachtet als ihre figurenreichen, meist
genrehaft aufgefaßten und in die heimische
Landschaft versetzten religiösen Darstellungen.
Die blendende Koloristik dieser Bilder, die
neuartige Lösung der Lichtprobleme durch
Jacopo da Ponte (von der Brenta-Brücke in
Bassano) und seiner Söhne wurden bereits von
*) Vgl. „Weltkunst“ Nr. 50, 52/3, Jg. VII,
Nr. 10, Jg. VIII.
1) Die übliche Schreibweise „die Bassani“ ist
nicht berechtigt, da der Stadtname Bassano keinen
Plural bilden kann; so schreiben jetzt die Fran-
zosen „les Bassano“, und die Italiener „i Bas-
sano“.
den Zeitgenossen bewundert: nach Borghini
(II Riposo, 1584, S. 563) ist Jacopo „tenuto ra-
rissimo nel colorire“. Boschini in seiner „Carta
del navegar“ (1660, S. 176) vergleicht seine
Farben mit „kostbaren Edelsteinen“, und sogar
der Wortführer der klassizistischen Ästhetik
Roger De Piles stellt ihm, in seiner kuriosen
Tabelle der relativen Vorzüge der großen
Meister, die Zensur 17 aus, wobei Tintoretto
und Paolo Veronese nur mit 16 abschneiden —
allerdings bekommt Jacopo, wie auch Palma
Vecchio, für „den Ausdruck“ eine Null (Cours
de peinture par principes, 1746). Die moderne
Kunstkritik, von Berenson bis Wart Arslan, be-
schäftigt sich auch hauptsächlich mit den emi-
nenten koloristischen und luminösen Werten
der Malerei der Bassano.
Allein das Porträt ist
nur in seltenen Fällen
ausschließlich ein Licht-
und Farbenproblem;
nur die Pleinairmalerei
gestattete sich ab und
zu, das menschliche Ge-
sicht in schillernde
Licht- und Farbenflecke
aufzulösen. Sonst bleibt
in der Bildniskunst die
Form und der durch die
Form bedingte geistige
Gehalt, neben der sinn-
lichen und veränder-
lichen farbig-tönigen
Erscheinung, stets der
Hauptträger der Wir-
kung. Wenn das For-
male und das Geistige
auch nicht direkt zu den
Stärken der Bassano ge-
hören, so stehen immer-
hin ihre besten Bildnisse
nicht unter dem Niveau
der zeitgenössischen ve-
nezianischen Porträt-
malerei. Und auch auf
diesem Gebiet würde es
sich lohnen, die nicht
immer leicht vonein-
ander zu trennenden
künstlerischen Persön-
lichkeiten der Bassano-
Familie, wo nur mög-
lich, zu erfassen.
Die beiden hier abge-
bildeten Porträts, von
denen das eine sich in
deutschem Privatbesitz
und das andere in der
Pariser Sammlung A.
Sambon befindet und
1929 mit anderen Ge-
mälden der Bassano
in Paris ausgestellt
wurde, sind vor allem
durch den Umstand in-
teressant, daß sie zweifelsohne eine und dieselbe
Persönlichkeit in verschiedenem Alter dar-
stellen (es genügt hier auf die charakteristi-
schen Formen des breiten Gesichtes, auf die
Augenpartien, die Nase, den Mund und die
Verteilung des Haarwuchses hinzuweisen) und
dadurch zwei verschiedenen, zeitlich um 15 bis
20 Jahre auseinander liegenden Entwicklungs-
stufen des Porträtstiles der Bassano angehören.
Der noch schwarzhaarige unbedeckte Kopf
eines in Dreiviertelansicht dargestellten etwa
35jährigen Mannes, der in der Rechten die
Leandro Bassano, Männerbildnis
Leinwand, 58 : 44 ein
Paris, Slg. A. Sambon
daß Händler Ware zum Zwecke der Versteigerung
aufkaufen, und zum Schaden des legalen Handels
künstliche Auktionen mit Hilfe der Versteigerer
aufzogen, so soll nach dem „beachtenswer-
ten Vorschlag“, den Herr Haberstock er-
wähnt, dieses Treiben sogar gesetzlich konzessio-
niert werden. Es ist nicht auszudenken, welche
Folgen dieser Vorschlag zeitigen wird. Es gibt
nur einen Ausweg, das gesamte Versteigerungs-
wesen rein und gesund zu erhalten, absolute
Trennung des Einzelhandels von dem Versteige-
rungswesen.
*
Bereits vor Beginn unserer Diskussion hatte
Herr Philo W u e st i. Fa. Walther Achenbach,
Berlin, in den „Mitteilungen der Industrie- und
Handelskammer zu Berlin“- vom 25. Februar 1934
zu den Ausführungen von Min.-Rat Dr. Günther
Stellung genommen. Der Verfasser kommt zu dem
Schluß, daß ein zivilrechtlicher Schutz des Käu-
fers auf Auktionen in der von Dr. Günther vor-
geschlagenen Weise im heutigen Staate nicht mehr
notwendig erscheint, ganz abgesehen von den
beinahe unüberwindlichen Schwierigkeiten, die
dem Versteigerer durch den Zwang zur Expertisen-
beschaffung usw. auferlegt würden.
„Wir Versteigerer stehen mit der Polizei-
behörde auf dem Standpunkt, daß derjenige Ver-
steigerer, der bewußt oder leichtfertig oder durch
mangelnde Sach- und Fachkunde Ursprung, Art
und Herkunft eines Versteigerungsgegenstandes
unrichtig bezeichnet, ausgemerzt werden muß.
Für die Zukunft vertreten wir auch eine Rege-
lung der Konizessioniserteilung unid der Konzessiions-
entziehuing nach dien gleichen strengen Grundsätzen.
Die letzte Zeit beweist, daß eine strenge Ge-
werbepolizei keine zivilrechtliche Hilfsstellung
braucht, um geeignete und ungeeignete Verstei-
gerer zu scheiden. Aus diesem Grunde halten wir
die Einführung einer zivilrechtlichen Gewähr-
leistungspflicht für überflüssig.“
Ausstellungen
Ältere Meister
Neben einigen sehr schönen charakteristi-
schen Gemälden von Slevogt, Corinth, Lieber-
mann, Trübner und
Schuch, unter denen die
Frühwerke überwiegen,
führt die Galerie
Nicolai, Berlin, eine
reife Darstellung von
Hans Thoma vor:
„Christus und die Sama-
mariterin“, einstmals
Hauptstück der Samm-
lung Laroche-Ringwald
in Basel, das Henry
Thode in einer kleineren
Wiederholung besaß.
Außer zwei weiteren
Stücken von Thoma sind
noch zwei sehr klang-
volle Bilder aus Amalfi
von Karl Blechen er-
wähnenswert, eine „Pro-
zession“ von Franz Catel
und vor allem das für
verschollen gehaltene
Porträt, das R ay ski
einst nach der Freifrau
von Zobel schuf, unge-
mein nobel in der bis
auf die ausgezeichnete
Darstellung der Hände
fein durchgeführten ma-
lerischen Haltung.
Z e e c k
Hans Tlioma, Christus und die Samariterin
Federzeichnung, 39 : 47 cm — Signiert
Ausstellung: Galerie CarlNicolai, Berlin
Handschuhe hält, mit
einem eigentümlichen,
halb schüchternen, halb
ironischen Ausdruck des
rosafarbenen Gesichtes,
ist noch ganz renais¬
sancemäßig behandelt,
in breiten, einfachen,
etwas glatten Flächen;
das Detail wird der all¬
gemeinen Wirkung ge¬
opfert, die Plastizität
der Form überall her-
ausgearbeitet.
Das andere Porträt
desselben, gealterten
Mannes beinah in Vor¬
deransicht, mit einem
viereckigen, auf den
Hinterkopf geschobenen
Barett, ist diesmal
viel detaillierter, aber
gleichzeitig auch viel
malerischer behandelt:
es würde genügen, den
Unterschied in der Be-
handlung des Ohres
oder des das mürrische
kupferrote Gesicht weich
umrahmenden Kragens
hervorzuheben; dabei
tritt jede Runzel, jede
geschwollene Ader, jede
Warze, jedes Härchen
des struppigen, unge-
pflegten Bartes, die un-
gesunde Gesichtsfarbe,
der matte, glanzlose
Blick in Erscheinung.
Der Ton, das Licht,
die das Gesicht mo¬
dellieren, umgeben es
mit einer atmosphäri¬
schen Hülle. Die psychologische Charakteristik
ist viel eindringlicher. Die beiden Porträts
können unmöglich von derselben Hand
sein. Wenn das erstere noch den Bild-
nissen eines Moroni nicht wesensfremd er-
scheint, leitet das andere zu der Form-, Licht-
und Farbenauffassung und zu der seelischen
Interpretation hinüber, die in Velasquez’ Inno-
cenz X. ihre Vollendung finden.
Der allgemein bassaneske Charakter der
beiden Köpfe ist nicht zu leugnen: er ergibt
sich aus dem Vergleich mit den sämtlichen un-
bestrittenen Bildnissen dieser Malerfamilie in
den Galerien von Bassano, Vicenza, Padua,
Venedig, Dresden und Wien. Die veneziani-
schen Prinzipien der bildmäßigen repräsen-
tativen Erfassung der darzustellenden Persön-
lichkeit paaren sich hier mit schlichteren, pro-
vinzmäßigen, aber naturgetreuen Zügen.
Da von Jacopos vier Söhnen nur Francesco
(gest. 1592, in demselben Jahr wie sein Vater)
und der „Cavaliere“ Leandro (1557—1622) als
Porträtmaler beglaubigt sind, so wäre in An-
betracht der ausgesprochenen barocken Art des
späteren Porträts anzunehmen, daß der un-
bekannte Mann zuerst von dem Vater und
15 bis 20 Jahre später von Leandro konterfeit
wurde. Bezeichnend sind noch die runde,
kugelförmige Schädelform auf dem früheren
Porträt, die sowohl in den Sujetbildern wie
auch in den Einzelbildnissen des Jacopo regel-
mäßig vorkommt, und der hohe, fast quadra-
tische Schädel, der uns öfters auf Leandros
Gemälden begegnet. Prof. Dr. W. R a k i n t
Max Pechstein
Die vitale, wirkungsreiche und treffsichere,
im einzelnen nicht stets gleichwertige Art
Pechsteins erweist sich in einer Ausstellung der
acopo Bassano, Männerbildiüs
Leinwand, 62 : 51 cm
Deutscher Privatbesitz
zu gestalten, in den Ölstücken fast in einer zu
momentanen Weise, die nahezu improvisierende
Züge trägt und in ihrer (etwas schwerer ge-
wordenen) sinnlichen Haltung dem Aquarell
gemäßer erscheint. In den Wasserfarbenblät-
tern, z. B. dem „Hagelschauer“, den „Kähnen
im Schilf“ und in Blumen, spricht sich das nie-
mals sonderlich nuancenreiche, den Blick aber
doch ungemein bestrickende und dabei ganz
unlyrische Hinschreiben seiner Eindrücke über-
zeugender und manchmal wohl auch konzen-
trierter aus. Auch unter den zügigen Rohr-
federzeichnungen, zuweilen im Format etwas
übersteigert, finden sich einige Blätter ersten
Ranges.
Jüngere Künstler
Die Galerie Gurlitt, Berlin, hat sich
nach dem Grundsatz gerichtet, vieles und darum
manchem etwas zu bringen. Neben einer großen
Anzahl von farbenkräftigen Tapetenmustern
des Schweizers Andreas La Roche stellt
sie einige jüngere deutsche Künstler aus, unter
denen zwei Frauen besonders auffallen. Ulla
Siebe zeigt in wechselndem Material Plastik,
die wohl noch etwas unterschiedlich anspricht,
jedoch gute Entwicklung verheißt und beson-
ders in den Gestaltungen aus Holz den beseel-
ten Barlachzug auf eine nicht uneigene Weise
trägt. Kleinere Stücke (z. B. eine „Tänzerin“)
sind bereits recht eigenwillig und sehr reizvoll
in der Form. Auch dem Metall und dem Mar-
mor weiß sie plastische Wirkungen abzugewin-
nen, die für eine nicht gewöhnliche Begabung
zeugen. Die Blätter von Helen Ernst sind
schon durch ihr Stoffgebiet interessant. Als
echte Zeichnerin hebt sie mit künstlerisch nicht
kleinlichen Mitteln aus dem alltäglichen Leben
prägnante Situationen, die in ihrer Bildmäßig-
keit wohl zuweilen etwas Zugespitztes haben
mögen, aber auch noch in dieser phantastischen
J
Hans Thoma, Christus und die Samariterin
Leinwand, 78:106 cm, sign. 1881
Ausstellung: Galerie Carl Nicolai, Berlin
Galerie v. d. Heyde, Berlin, schon darum
gemäßigter und ausgeglichener als sonst, weil
es sich in diesen etwa vierzig Proben (Ölbildern,
Aquarellen und Zeichnungen) fast ausschließ-
lich um Darstellungen handelt, die immer
wieder das landschaftliche Geschehen an der
Küste variieren. Auch hier weiß der Maler,
spannkräftig und jeder naturalistischen Art
abhold, die farbigen Erscheinungen zu Bildern
Formulierung den Zusammenhang mit den
wirklichen Erscheinungen der Dinge niemals
verlieren. Von den Malern verfügt der Hanno-
veraner T. Niehues-Hämmerle über die
kargere, jedoch durchgefühltere und persön-
lichere Weise, die Landschaften, Blumenstücken
und Köpfen etwas ungemein Sympathisches
verleiht. Hans Orlowski, der ein außer-
ordentliches zeichnerisches Vermögen besitzt,