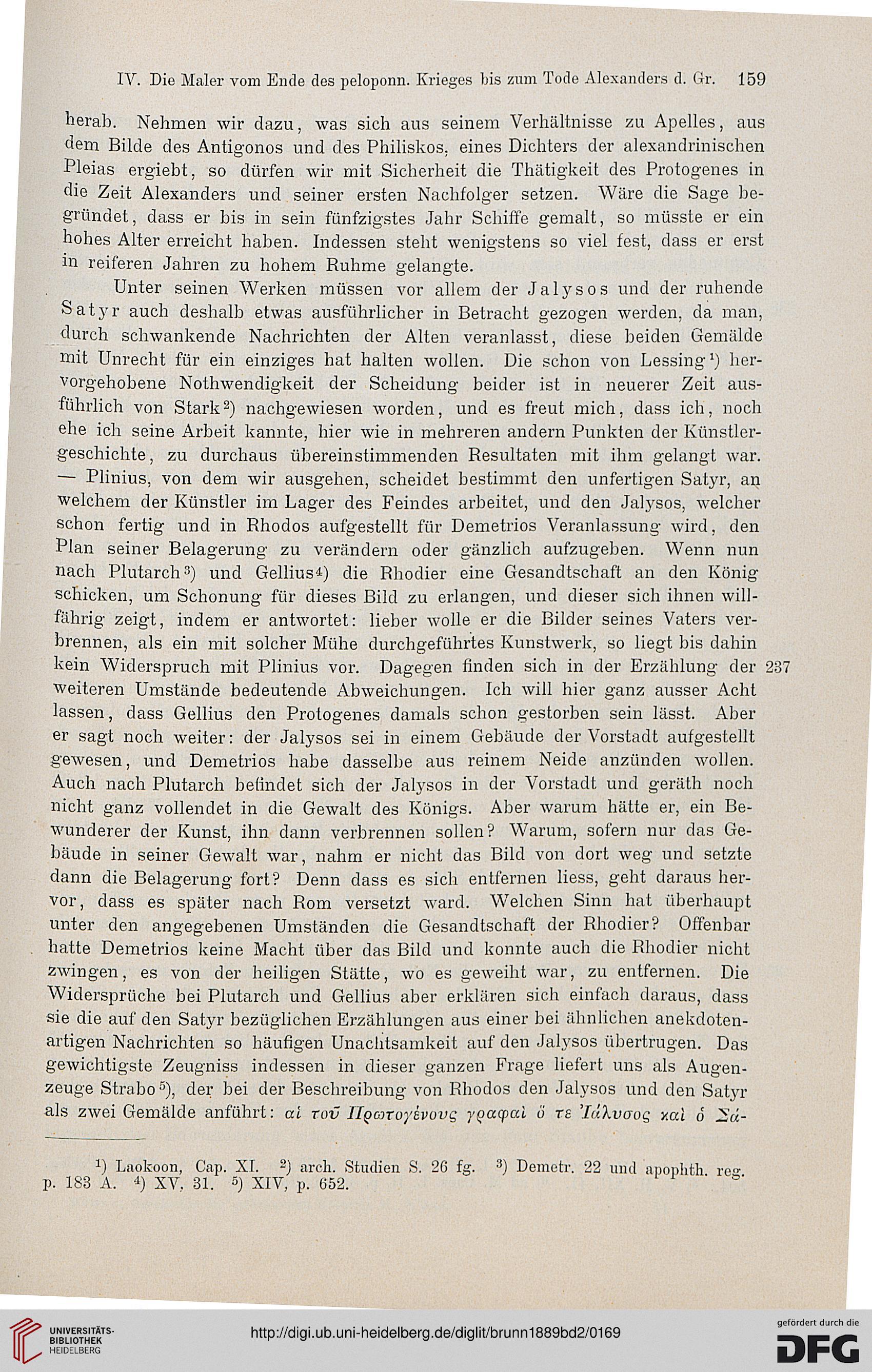IV. Die Maler vom Ende des peloponn. Krieges bis zum Tode Alexanders d. Gr. 159
herab. Nehmen wir dazu, was sich aus seinem Verhältnisse zu Apelles, aus
dem Bilde des Antigonos und des Philiskos. eines Dichters der alexandrinischen
Pleias ergiebt, so dürfen wir mit Sicherheit die Thätigkeit des Protogenes in
die Zeit Alexanders und seiner ersten Nachfolger setzen. Wäre die Sage be-
gründet, dass er bis in sein fünfzigstes Jahr Schiffe gemalt, so müsste er ein
hohes Alter erreicht haben. Indessen steht wenigstens so viel fest, dass er erst
in reiferen Jahren zu hohem Ruhme gelangte.
Unter seinen Werken müssen vor allem der Jalysos und der ruhende
Satyr auch deshalb etwas ausführlicher in Betracht gezogen werden, da man,
durch schwankende Nachrichten der Alten veranlasst, diese beiden Gemälde
mit Unrecht für ein einziges hat halten wollen. Die schon von Lessing1) her-
vorgehobene Notwendigkeit der Scheidung beider ist in neuerer Zeit aus-
führlich von Stark2) nachgewiesen worden, und es freut mich, dass ich, noch
ehe ich seine Arbeit kannte, hier wie in mehreren andern Punkten der Künstler-
geschichte, zu durchaus übereinstimmenden Resultaten mit ihm gelangt war.
— Plinius, von dem wir ausgehen, scheidet bestimmt den unfertigen Satyr, an
welchem der Künstler im Lager des Feindes arbeitet, und den Jalysos, welcher
sch on fertig und in Rhodos aufgestellt für Demetrios Veranlassung wird, den
Plan seiner Belagerung zu verändern oder gänzlich aufzugeben. Wenn nun
nach Plutarch3) und Gellius*) die Rhodier eine Gesandtschaft an den König
schicken, um Schonung für dieses Bild zu erlangen, und dieser sich ihnen will-
fährig zeigt, indem er antwortet: lieber wolle er die Bilder seines Vaters ver-
brennen, als ein mit solcher Mühe durchgeführtes Kunstwerk, so liegt bis dahin
kein Widerspruch mit Plinius vor. Dagegen finden sich in der Erzählung der 237
weiteren Umstände bedeutende Abweichungen. Ich will hier ganz ausser Acht
lassen, dass Gellius den Protogenes damals schon gestorben sein lässt. Aber
er sagt noch weiter: der Jalysos sei in einem Gebäude der Vorstadt aufgestellt
gewesen, und Demetrios habe dasselbe aus reinem Neide anzünden wollen.
Auch nach Plutarch befindet sich der Jalysos in der Vorstadt und geräth noch
nicht ganz vollendet in die Gewalt des Königs. Aber warum hätte er, ein Be-
wunderer der Kunst, ihn dann verbrennen sollen? Warum, sofern nur das Ge-
bäude in seiner Gewalt war, nahm er nicht das Bild von dort weg und setzte
dann die Belagerung fort? Denn dass es sich entfernen Hess, geht daraus her-
vor, dass es später nach Rom versetzt ward. Welchen Sinn hat überhaupt
unter den angegebenen Umständen die Gesandtschaft der Rhodier? Offenbar
hatte Demetrios keine Macht über das Bild und konnte auch die Rhodier nicht
zwingen, es von der heiligen Stätte, wo es geweiht war, zu entfernen. Die
Widersprüche bei Plutarch und Gellius aber erklären sich einfach daraus, dass
sie die auf den Satyr bezüglichen Erzählungen aus einer bei ähnlichen anekdoten-
artigen Nachrichten so häufigen Unachtsamkeit auf den Jalysos übertrugen. Das
gewichtigste Zeugniss indessen in dieser ganzen Frage liefert uns als Augen-
zeuge Strabo5), der bei der Beschreibung von Rhodos den Jalysos und den Satyr
als zwei Gemälde anführt: ai rov llQWToyBvovg y^acpal ö ts 'InXvaoQ y.al 6 2Üd-
!) Laokoon, Cap. XI. 2) arch. Studien S. 2ß fg. 3) Demetr. 22 und apophth re
p. 183 A. *) XV. 31. s) XIV, p. 652.
herab. Nehmen wir dazu, was sich aus seinem Verhältnisse zu Apelles, aus
dem Bilde des Antigonos und des Philiskos. eines Dichters der alexandrinischen
Pleias ergiebt, so dürfen wir mit Sicherheit die Thätigkeit des Protogenes in
die Zeit Alexanders und seiner ersten Nachfolger setzen. Wäre die Sage be-
gründet, dass er bis in sein fünfzigstes Jahr Schiffe gemalt, so müsste er ein
hohes Alter erreicht haben. Indessen steht wenigstens so viel fest, dass er erst
in reiferen Jahren zu hohem Ruhme gelangte.
Unter seinen Werken müssen vor allem der Jalysos und der ruhende
Satyr auch deshalb etwas ausführlicher in Betracht gezogen werden, da man,
durch schwankende Nachrichten der Alten veranlasst, diese beiden Gemälde
mit Unrecht für ein einziges hat halten wollen. Die schon von Lessing1) her-
vorgehobene Notwendigkeit der Scheidung beider ist in neuerer Zeit aus-
führlich von Stark2) nachgewiesen worden, und es freut mich, dass ich, noch
ehe ich seine Arbeit kannte, hier wie in mehreren andern Punkten der Künstler-
geschichte, zu durchaus übereinstimmenden Resultaten mit ihm gelangt war.
— Plinius, von dem wir ausgehen, scheidet bestimmt den unfertigen Satyr, an
welchem der Künstler im Lager des Feindes arbeitet, und den Jalysos, welcher
sch on fertig und in Rhodos aufgestellt für Demetrios Veranlassung wird, den
Plan seiner Belagerung zu verändern oder gänzlich aufzugeben. Wenn nun
nach Plutarch3) und Gellius*) die Rhodier eine Gesandtschaft an den König
schicken, um Schonung für dieses Bild zu erlangen, und dieser sich ihnen will-
fährig zeigt, indem er antwortet: lieber wolle er die Bilder seines Vaters ver-
brennen, als ein mit solcher Mühe durchgeführtes Kunstwerk, so liegt bis dahin
kein Widerspruch mit Plinius vor. Dagegen finden sich in der Erzählung der 237
weiteren Umstände bedeutende Abweichungen. Ich will hier ganz ausser Acht
lassen, dass Gellius den Protogenes damals schon gestorben sein lässt. Aber
er sagt noch weiter: der Jalysos sei in einem Gebäude der Vorstadt aufgestellt
gewesen, und Demetrios habe dasselbe aus reinem Neide anzünden wollen.
Auch nach Plutarch befindet sich der Jalysos in der Vorstadt und geräth noch
nicht ganz vollendet in die Gewalt des Königs. Aber warum hätte er, ein Be-
wunderer der Kunst, ihn dann verbrennen sollen? Warum, sofern nur das Ge-
bäude in seiner Gewalt war, nahm er nicht das Bild von dort weg und setzte
dann die Belagerung fort? Denn dass es sich entfernen Hess, geht daraus her-
vor, dass es später nach Rom versetzt ward. Welchen Sinn hat überhaupt
unter den angegebenen Umständen die Gesandtschaft der Rhodier? Offenbar
hatte Demetrios keine Macht über das Bild und konnte auch die Rhodier nicht
zwingen, es von der heiligen Stätte, wo es geweiht war, zu entfernen. Die
Widersprüche bei Plutarch und Gellius aber erklären sich einfach daraus, dass
sie die auf den Satyr bezüglichen Erzählungen aus einer bei ähnlichen anekdoten-
artigen Nachrichten so häufigen Unachtsamkeit auf den Jalysos übertrugen. Das
gewichtigste Zeugniss indessen in dieser ganzen Frage liefert uns als Augen-
zeuge Strabo5), der bei der Beschreibung von Rhodos den Jalysos und den Satyr
als zwei Gemälde anführt: ai rov llQWToyBvovg y^acpal ö ts 'InXvaoQ y.al 6 2Üd-
!) Laokoon, Cap. XI. 2) arch. Studien S. 2ß fg. 3) Demetr. 22 und apophth re
p. 183 A. *) XV. 31. s) XIV, p. 652.