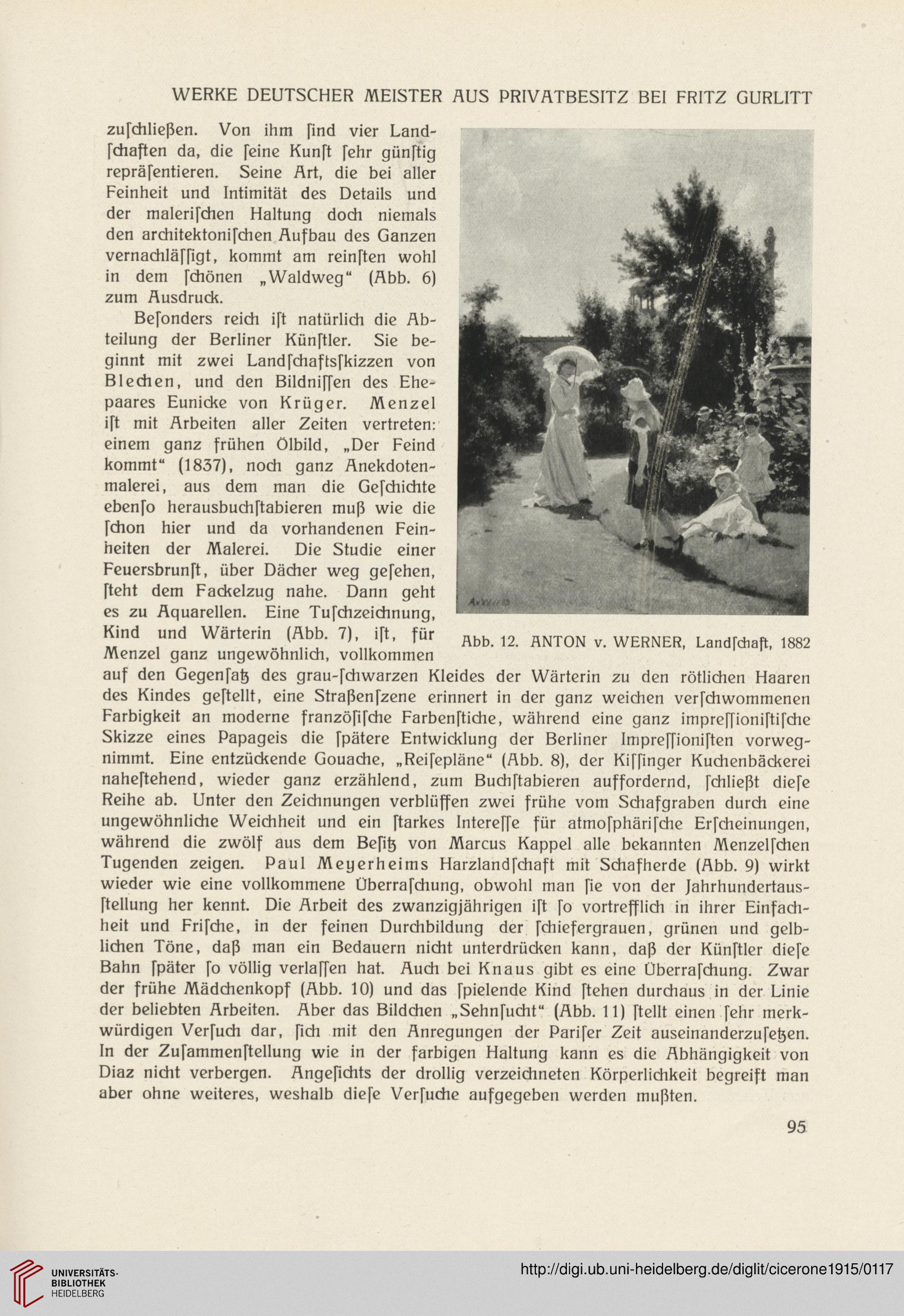Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0117
DOI Heft:
Heft 4
DOI Artikel:Friedeberger, Hans: Werke deutscher Meister aus Privatbesitz bei Fritz Gurlitt
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0117
WERKE DEUTSCHER MEISTER AUS PRIVATBESITZ BEI FRITZ GURLITT
zufchließen. Von ihm find vier Land-
fdiaften da, die feine Kunft fehr günftig
repräfentieren. Seine Art, die bei aller
Feinheit und Intimität des Details und
der malerifchen Haltung doch niemals
den architektonifchen Aufbau des Ganzen
vernachläffigt, kommt am reinften wohl
in dem fchönen „Waldweg“ (Abb. 6)
zum Ausdruck.
Befonders reich ift natürlich die Ab-
teilung der Berliner Künftler. Sie be-
ginnt mit zwei Landfchaftsfkizzen von
Blechen, und den Bildniffen des Ehe-
paares Eunicke von Krüger. Menzel
ift mit Arbeiten aller Zeiten vertreten:
einem ganz frühen Ölbild, „Der Feind
kommt“ (1837), noch ganz Anekdoten-
malerei, aus dem man die Gefchichte
ebenfo herausbuchftabieren muß wie die
fchon hier und da vorhandenen Fein-
heiten der Malerei. Die Studie einer
Feuersbrunft, über Dächer weg gefehen,
fteht dem Fackelzug nahe. Dann geht
es zu Aquarellen. Eine Tufchzeichnung,
Kind und Wärterin (Abb. 7), ift, für
Menzel ganz ungewöhnlich, vollkommen
auf den Gegenfalj des grau-fchwarzen Kleides der Wärterin zu den rötlichen Haaren
des Kindes geftellt, eine Straßenfzene erinnert in der ganz weichen verfchwommenen
Farbigkeit an moderne franzöfifche Farbenftiche, während eine ganz impreffioniftifche
Skizze eines Papageis die fpätere Entwicklung der Berliner Impreffioniften vorweg-
nimmt. Eine entzückende Gouache, „Reifepläne“ (Abb. 8), der Kiffinger Kuchenbäckerei
naheftehend, wieder ganz erzählend, zum Buchftabieren auffordernd, fchließt diefe
Reihe ab. Unter den Zeichnungen verblüffen zwei frühe vom Schafgraben durch eine
ungewöhnliche Weichheit und ein ftarkes Intereffe für atmofphärifche Erfcheinungen,
während die zwölf aus dem Befiß von Marcus Kappel alle bekannten Menzelfchen
Tugenden zeigen. Paul Megerheims Harzlandfchaft mit Schafherde (Abb. 9) wirkt
wieder wie eine vollkommene Überrafchung, obwohl man fie von der Jahrhundertaus-
ftellung her kennt. Die Arbeit des zwanzigjährigen ift fo vortrefflich in ihrer Einfach-
heit und Frifche, in der feinen Durchbildung der fchiefergrauen, grünen und gelb-
lichen Töne, daß man ein Bedauern nicht unterdrücken kann, daß der Künftler diefe
Bahn fpäter fo völlig verlaffen hat. Auch bei Knaus gibt es eine Überrafchung. Zwar
der frühe Mädchenkopf (Abb. 10) und das fpielende Kind ftehen durchaus in der Linie
der beliebten Arbeiten. Aber das Bildchen „Sehnfucht“ (Abb. 11) ftellt einen fehr merk-
würdigen Verfuch dar, fich mit den Anregungen der Parifer Zeit auseinanderzufeßen.
In der Zufammenftellung wie in der farbigen Haltung kann es die Abhängigkeit von
Diaz nicht verbergen. Angefichts der drollig verzeichneten Körperlichkeit begreift man
aber ohne weiteres, weshalb diefe Verfudie aufgegeben werden mußten.
Abb. 12. ANTON v. WERNER, Landfdiaft, 1882
95
zufchließen. Von ihm find vier Land-
fdiaften da, die feine Kunft fehr günftig
repräfentieren. Seine Art, die bei aller
Feinheit und Intimität des Details und
der malerifchen Haltung doch niemals
den architektonifchen Aufbau des Ganzen
vernachläffigt, kommt am reinften wohl
in dem fchönen „Waldweg“ (Abb. 6)
zum Ausdruck.
Befonders reich ift natürlich die Ab-
teilung der Berliner Künftler. Sie be-
ginnt mit zwei Landfchaftsfkizzen von
Blechen, und den Bildniffen des Ehe-
paares Eunicke von Krüger. Menzel
ift mit Arbeiten aller Zeiten vertreten:
einem ganz frühen Ölbild, „Der Feind
kommt“ (1837), noch ganz Anekdoten-
malerei, aus dem man die Gefchichte
ebenfo herausbuchftabieren muß wie die
fchon hier und da vorhandenen Fein-
heiten der Malerei. Die Studie einer
Feuersbrunft, über Dächer weg gefehen,
fteht dem Fackelzug nahe. Dann geht
es zu Aquarellen. Eine Tufchzeichnung,
Kind und Wärterin (Abb. 7), ift, für
Menzel ganz ungewöhnlich, vollkommen
auf den Gegenfalj des grau-fchwarzen Kleides der Wärterin zu den rötlichen Haaren
des Kindes geftellt, eine Straßenfzene erinnert in der ganz weichen verfchwommenen
Farbigkeit an moderne franzöfifche Farbenftiche, während eine ganz impreffioniftifche
Skizze eines Papageis die fpätere Entwicklung der Berliner Impreffioniften vorweg-
nimmt. Eine entzückende Gouache, „Reifepläne“ (Abb. 8), der Kiffinger Kuchenbäckerei
naheftehend, wieder ganz erzählend, zum Buchftabieren auffordernd, fchließt diefe
Reihe ab. Unter den Zeichnungen verblüffen zwei frühe vom Schafgraben durch eine
ungewöhnliche Weichheit und ein ftarkes Intereffe für atmofphärifche Erfcheinungen,
während die zwölf aus dem Befiß von Marcus Kappel alle bekannten Menzelfchen
Tugenden zeigen. Paul Megerheims Harzlandfchaft mit Schafherde (Abb. 9) wirkt
wieder wie eine vollkommene Überrafchung, obwohl man fie von der Jahrhundertaus-
ftellung her kennt. Die Arbeit des zwanzigjährigen ift fo vortrefflich in ihrer Einfach-
heit und Frifche, in der feinen Durchbildung der fchiefergrauen, grünen und gelb-
lichen Töne, daß man ein Bedauern nicht unterdrücken kann, daß der Künftler diefe
Bahn fpäter fo völlig verlaffen hat. Auch bei Knaus gibt es eine Überrafchung. Zwar
der frühe Mädchenkopf (Abb. 10) und das fpielende Kind ftehen durchaus in der Linie
der beliebten Arbeiten. Aber das Bildchen „Sehnfucht“ (Abb. 11) ftellt einen fehr merk-
würdigen Verfuch dar, fich mit den Anregungen der Parifer Zeit auseinanderzufeßen.
In der Zufammenftellung wie in der farbigen Haltung kann es die Abhängigkeit von
Diaz nicht verbergen. Angefichts der drollig verzeichneten Körperlichkeit begreift man
aber ohne weiteres, weshalb diefe Verfudie aufgegeben werden mußten.
Abb. 12. ANTON v. WERNER, Landfdiaft, 1882
95