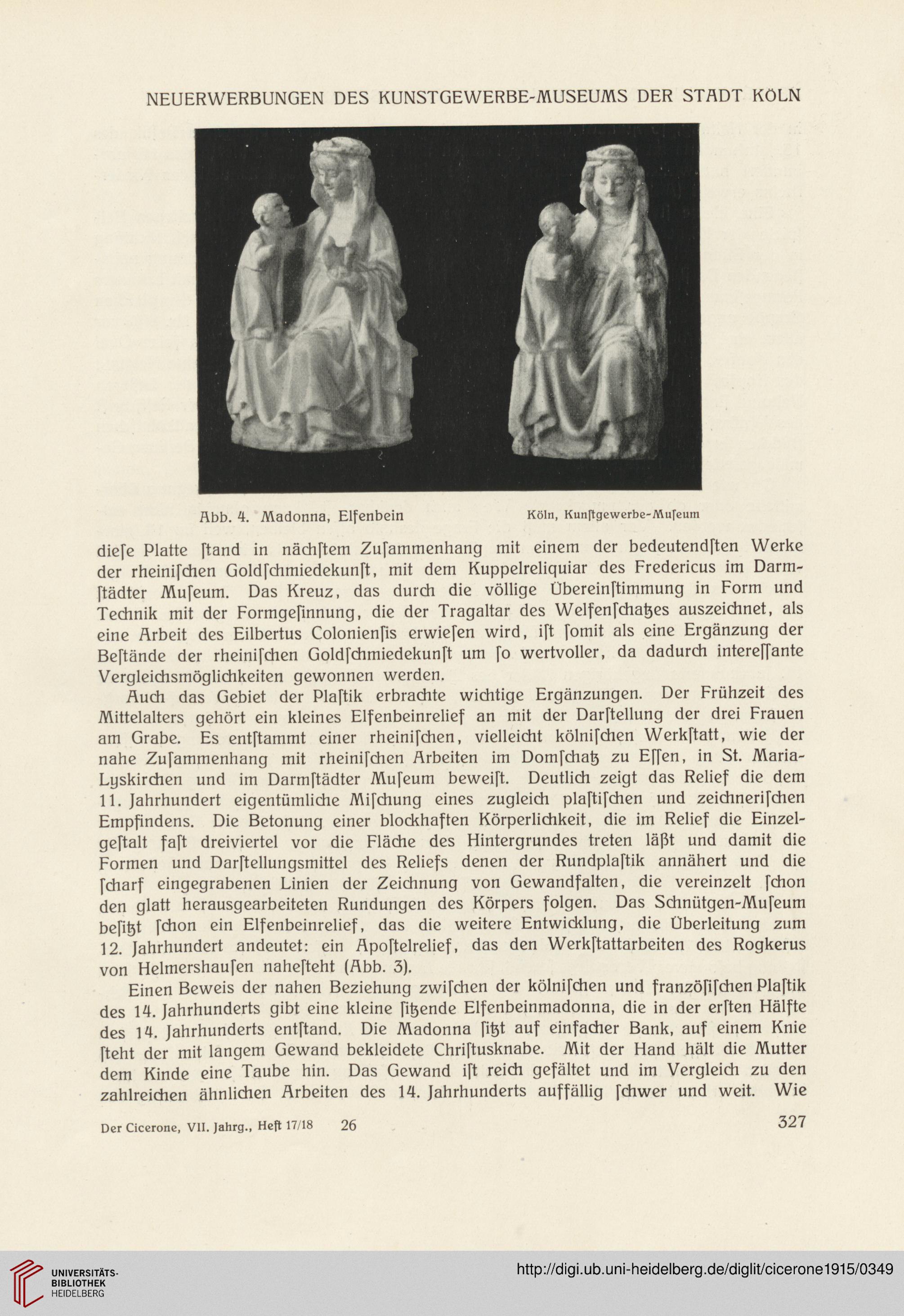Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0349
DOI Heft:
Heft 17/18
DOI Artikel:Lüthgen, Eugen: Neuerwerbungen des Kunstgewerbe-Museums der Stadt Köln
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0349
NEUERWERBUNGEN DES KUNSTGEWERBE-MUSEUMS DER STADT KÖLN
Äbb. 4. Madonna, Elfenbein Köln, Kunftgewerbe-Mufeum
diefe Platte ftand in nächftem Zufammenhang mit einem der bedeutendften Werke
der rheinifdien Goldfchmiedekunft, mit dem Kuppelreliquiar des Fredericus im Darm-
ftädter Mufeum. Das Kreuz, das durch die völlige Übereinftimmung in Form und
Technik mit der Formgefinnung, die der Tragaltar des Welfenfchatjes auszeichnet, als
eine Arbeit des Eilbertus Colonienfis erwiefen wird, ift formt als eine Ergänzung der
Beftände der rheinifchen Goldfchmiedekunft um fo wertvoller, da dadurch intereffante
Vergleichsmöglichkeiten gewonnen werden.
Auch das Gebiet der Plaftik erbrachte wichtige Ergänzungen. Der Frühzeit des
Mittelalters gehört ein kleines Elfenbeinrelief an mit der Darftellung der drei Frauen
am Grabe. Es entftammt einer rheinifchen, vielleicht kölnifchen Werkftatt, wie der
nahe Zufammenhang mit rheinifchen Arbeiten im Domfchatj zu Effen, in St. Maria-
Lgskirdien und im Darmftädter Mufeum beweift. Deutlich zeigt das Relief die dem
11. Jahrhundert eigentümliche Mifchung eines zugleich plaftifchen und zeichnerifchen
Empfindens. Die Betonung einer blockhaften Körperlichkeit, die im Relief die Einzel-
geftalt faft dreiviertel vor die Fläche des Flintergrundes treten läßt und damit die
Formen und Darftellungsmittel des Reliefs denen der Rundplaftik annähert und die
fcharf eingegrabenen Linien der Zeichnung von Gewandfalten, die vereinzelt fchon
den glatt herausgearbeiteten Rundungen des Körpers folgen. Das Schnütgen-Mufeum
befißt fchon ein Elfenbeinrelief, das die weitere Entwicklung, die Überleitung zum
12. Jahrhundert andeutet: ein Apoftelrelief, das den Werkftattarbeiten des Rogkerus
von Helmershaufen nahefteht (Abb. 3).
Einen Beweis der nahen Beziehung zwifchen der kölnifchen und franzöfifchen Plaftik
des 14. Jahrhunderts gibt eine kleine fißende Elfenbeinmadonna, die in der erften Hälfte
des 14. Jahrhunderts entftand. Die Madonna fißt auf einfacher Bank, auf einem Knie
fteht der mit langem Gewand bekleidete Chriftusknabe. Mit der Hand hält die Mutter
dem Kinde eine Taube hin. Das Gewand ift reich gefältet und im Vergleich zu den
zahlreichen ähnlichen Arbeiten des 14. Jahrhunderts auffällig fchwer und weit. Wie
Der Cicerone, VII. Jahrg., Hefl 17/18 26
327
Äbb. 4. Madonna, Elfenbein Köln, Kunftgewerbe-Mufeum
diefe Platte ftand in nächftem Zufammenhang mit einem der bedeutendften Werke
der rheinifdien Goldfchmiedekunft, mit dem Kuppelreliquiar des Fredericus im Darm-
ftädter Mufeum. Das Kreuz, das durch die völlige Übereinftimmung in Form und
Technik mit der Formgefinnung, die der Tragaltar des Welfenfchatjes auszeichnet, als
eine Arbeit des Eilbertus Colonienfis erwiefen wird, ift formt als eine Ergänzung der
Beftände der rheinifchen Goldfchmiedekunft um fo wertvoller, da dadurch intereffante
Vergleichsmöglichkeiten gewonnen werden.
Auch das Gebiet der Plaftik erbrachte wichtige Ergänzungen. Der Frühzeit des
Mittelalters gehört ein kleines Elfenbeinrelief an mit der Darftellung der drei Frauen
am Grabe. Es entftammt einer rheinifchen, vielleicht kölnifchen Werkftatt, wie der
nahe Zufammenhang mit rheinifchen Arbeiten im Domfchatj zu Effen, in St. Maria-
Lgskirdien und im Darmftädter Mufeum beweift. Deutlich zeigt das Relief die dem
11. Jahrhundert eigentümliche Mifchung eines zugleich plaftifchen und zeichnerifchen
Empfindens. Die Betonung einer blockhaften Körperlichkeit, die im Relief die Einzel-
geftalt faft dreiviertel vor die Fläche des Flintergrundes treten läßt und damit die
Formen und Darftellungsmittel des Reliefs denen der Rundplaftik annähert und die
fcharf eingegrabenen Linien der Zeichnung von Gewandfalten, die vereinzelt fchon
den glatt herausgearbeiteten Rundungen des Körpers folgen. Das Schnütgen-Mufeum
befißt fchon ein Elfenbeinrelief, das die weitere Entwicklung, die Überleitung zum
12. Jahrhundert andeutet: ein Apoftelrelief, das den Werkftattarbeiten des Rogkerus
von Helmershaufen nahefteht (Abb. 3).
Einen Beweis der nahen Beziehung zwifchen der kölnifchen und franzöfifchen Plaftik
des 14. Jahrhunderts gibt eine kleine fißende Elfenbeinmadonna, die in der erften Hälfte
des 14. Jahrhunderts entftand. Die Madonna fißt auf einfacher Bank, auf einem Knie
fteht der mit langem Gewand bekleidete Chriftusknabe. Mit der Hand hält die Mutter
dem Kinde eine Taube hin. Das Gewand ift reich gefältet und im Vergleich zu den
zahlreichen ähnlichen Arbeiten des 14. Jahrhunderts auffällig fchwer und weit. Wie
Der Cicerone, VII. Jahrg., Hefl 17/18 26
327