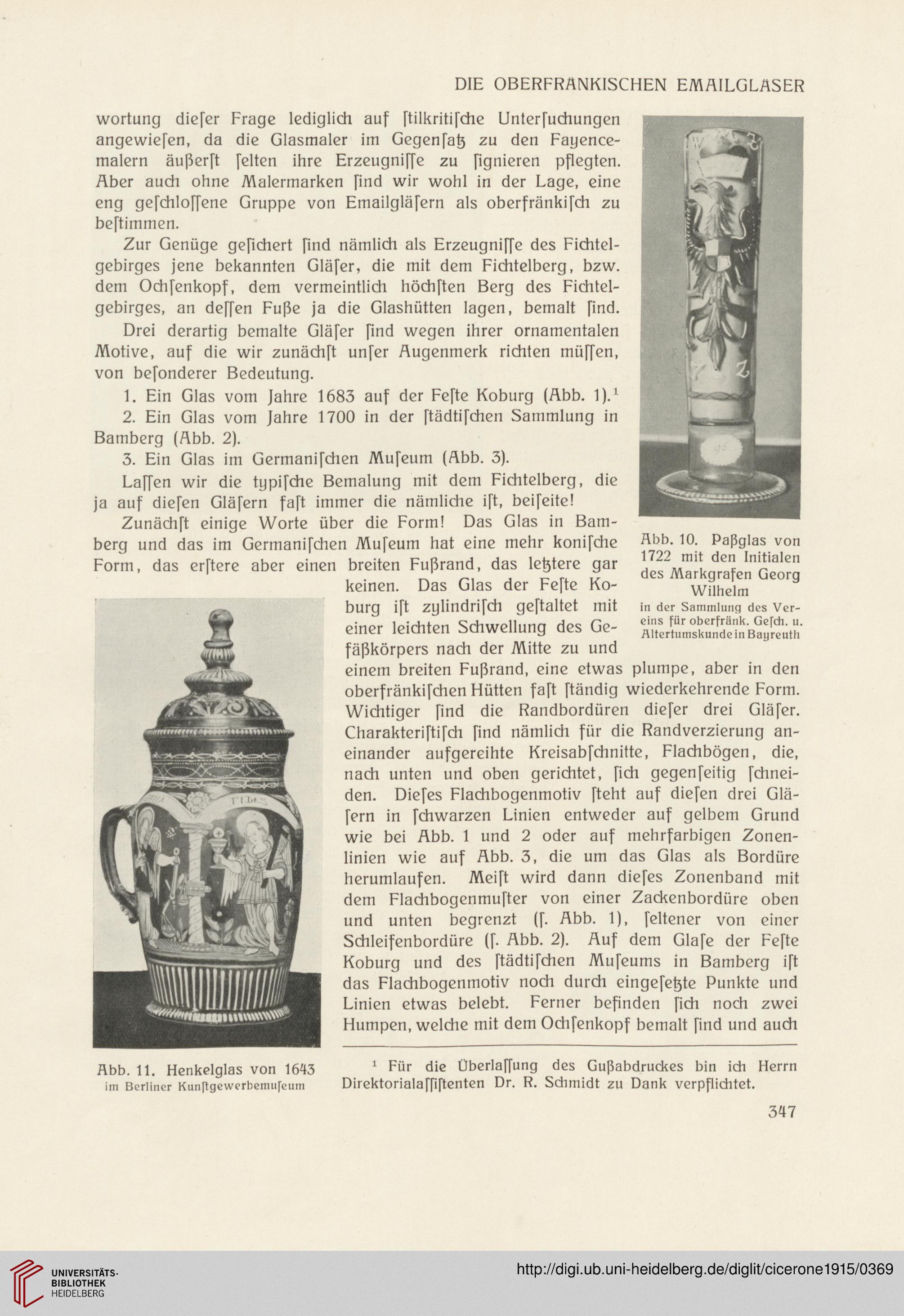Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0369
DOI Heft:
Heft 19/20
DOI Artikel:Zeh, Ernst: Die Oberfränkischen Emailgläser
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0369
DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLÄSER
wortung diefer Frage lediglich auf ftilkritifche Unterfuchungen
angewiefen, da die Glasmaler im Gegenfaß zu den Fayence-
malern äußerft [eiten ihre Erzeugniffe zu fignieren pflegten.
Aber auch ohne Malermarken find wir wohl in der Lage, eine
eng gefchloffene Gruppe von Emailgläfern als oberfränkifch zu
beftimmen.
Zur Genüge gefichert find nämlich als Erzeugniffe des Fichtel-
gebirges jene bekannten Gläfer, die mit dem Fichtelberg, bzw.
dem Ochfenkopf, dem vermeintlich höchften Berg des Fichtel-
gebirges, an deffen Fuße ja die Glashütten lagen, bemalt find.
Drei derartig bemalte Gläfer find wegen ihrer ornamentalen
Motive, auf die wir zunächft unfer Augenmerk richten müffen,
von befonderer Bedeutung.
1. Ein Glas vom Jahre 1683 auf der Fefte Koburg (Äbb. I).1
2. Ein Glas vom Jahre 1700 in der ftädtifchen Sammlung in
Bamberg (Abb. 2).
3. Ein Glas im Germanifchen Mufeum (Abb. 3).
Laffen wir die typifche Bemalung mit dem Fichtelberg, die
ja auf diefen Gläfern faft immer die nämliche ift, beifeite!
Zunächft einige Worte über die Form! Das Glas in Bam-
berg und das im Germanifchen Mufeum hat eine mehr konifche
Form, das erftere aber einen breiten Fußrand, das letztere gar
keinen. Das Glas der Fefte Ko-
burg ift zylindrifch geftaltet mit
einer leichten Schwellung des Ge-
fäßkörpers nach der Mitte zu und
einem breiten Fußrand, eine etwas plumpe, aber in den
oberfränkifchen Hütten faft ftändig wiederkehrende Form.
Wichtiger find die Randbordüren diefer drei Gläfer.
Charakteriftifch find nämlich für die Randverzierung an-
einander aufgereihte Kreisabfchnitte, Flachbögen, die,
nach unten und oben gerichtet, fich gegenfeitig fchnei-
den. Diefes Flachbogenmotiv fteht auf diefen drei Glä-
fern in fchwarzen Linien entweder auf gelbem Grund
wie bei Abb. 1 und 2 oder auf mehrfarbigen Zonen-
linien wie auf Abb. 3, die um das Glas als Bordüre
herumlaufen. Meift wird dann diefes Zonenband mit
dem Flachbogenmufter von einer Zackenbordüre oben
und unten begrenzt (f. Abb. 1), feltener von einer
Schleifenbordüre (f. Abb. 2). Auf dem Glafe der Fefte
Koburg und des ftädtifchen Mufeums in Bamberg ift
das Flachbogenmotiv noch durch eingefeßte Punkte und
Linien etwas belebt. Ferner befinden fich noch zwei
Humpen, welche mit dem Ochfenkopf bemalt find und auch
■■■
Äbb. 10. Paßglas von
1722 mit den Initialen
des Markgrafen Georg
Wilhelm
in der Sammlung des Ver-
eins für oberfränk. Gefch. u.
Altertumskunde in Bagreutii
Äbb. 11. Henkelglas von 1643 1 Für die Überlaffung des Gußabdruckes bin ich Herrn
im Berliner Kunftgewerbemufeum Direktorialaffiftenten Dr. R. Schmidt zu Dank verpflichtet.
347
wortung diefer Frage lediglich auf ftilkritifche Unterfuchungen
angewiefen, da die Glasmaler im Gegenfaß zu den Fayence-
malern äußerft [eiten ihre Erzeugniffe zu fignieren pflegten.
Aber auch ohne Malermarken find wir wohl in der Lage, eine
eng gefchloffene Gruppe von Emailgläfern als oberfränkifch zu
beftimmen.
Zur Genüge gefichert find nämlich als Erzeugniffe des Fichtel-
gebirges jene bekannten Gläfer, die mit dem Fichtelberg, bzw.
dem Ochfenkopf, dem vermeintlich höchften Berg des Fichtel-
gebirges, an deffen Fuße ja die Glashütten lagen, bemalt find.
Drei derartig bemalte Gläfer find wegen ihrer ornamentalen
Motive, auf die wir zunächft unfer Augenmerk richten müffen,
von befonderer Bedeutung.
1. Ein Glas vom Jahre 1683 auf der Fefte Koburg (Äbb. I).1
2. Ein Glas vom Jahre 1700 in der ftädtifchen Sammlung in
Bamberg (Abb. 2).
3. Ein Glas im Germanifchen Mufeum (Abb. 3).
Laffen wir die typifche Bemalung mit dem Fichtelberg, die
ja auf diefen Gläfern faft immer die nämliche ift, beifeite!
Zunächft einige Worte über die Form! Das Glas in Bam-
berg und das im Germanifchen Mufeum hat eine mehr konifche
Form, das erftere aber einen breiten Fußrand, das letztere gar
keinen. Das Glas der Fefte Ko-
burg ift zylindrifch geftaltet mit
einer leichten Schwellung des Ge-
fäßkörpers nach der Mitte zu und
einem breiten Fußrand, eine etwas plumpe, aber in den
oberfränkifchen Hütten faft ftändig wiederkehrende Form.
Wichtiger find die Randbordüren diefer drei Gläfer.
Charakteriftifch find nämlich für die Randverzierung an-
einander aufgereihte Kreisabfchnitte, Flachbögen, die,
nach unten und oben gerichtet, fich gegenfeitig fchnei-
den. Diefes Flachbogenmotiv fteht auf diefen drei Glä-
fern in fchwarzen Linien entweder auf gelbem Grund
wie bei Abb. 1 und 2 oder auf mehrfarbigen Zonen-
linien wie auf Abb. 3, die um das Glas als Bordüre
herumlaufen. Meift wird dann diefes Zonenband mit
dem Flachbogenmufter von einer Zackenbordüre oben
und unten begrenzt (f. Abb. 1), feltener von einer
Schleifenbordüre (f. Abb. 2). Auf dem Glafe der Fefte
Koburg und des ftädtifchen Mufeums in Bamberg ift
das Flachbogenmotiv noch durch eingefeßte Punkte und
Linien etwas belebt. Ferner befinden fich noch zwei
Humpen, welche mit dem Ochfenkopf bemalt find und auch
■■■
Äbb. 10. Paßglas von
1722 mit den Initialen
des Markgrafen Georg
Wilhelm
in der Sammlung des Ver-
eins für oberfränk. Gefch. u.
Altertumskunde in Bagreutii
Äbb. 11. Henkelglas von 1643 1 Für die Überlaffung des Gußabdruckes bin ich Herrn
im Berliner Kunftgewerbemufeum Direktorialaffiftenten Dr. R. Schmidt zu Dank verpflichtet.
347