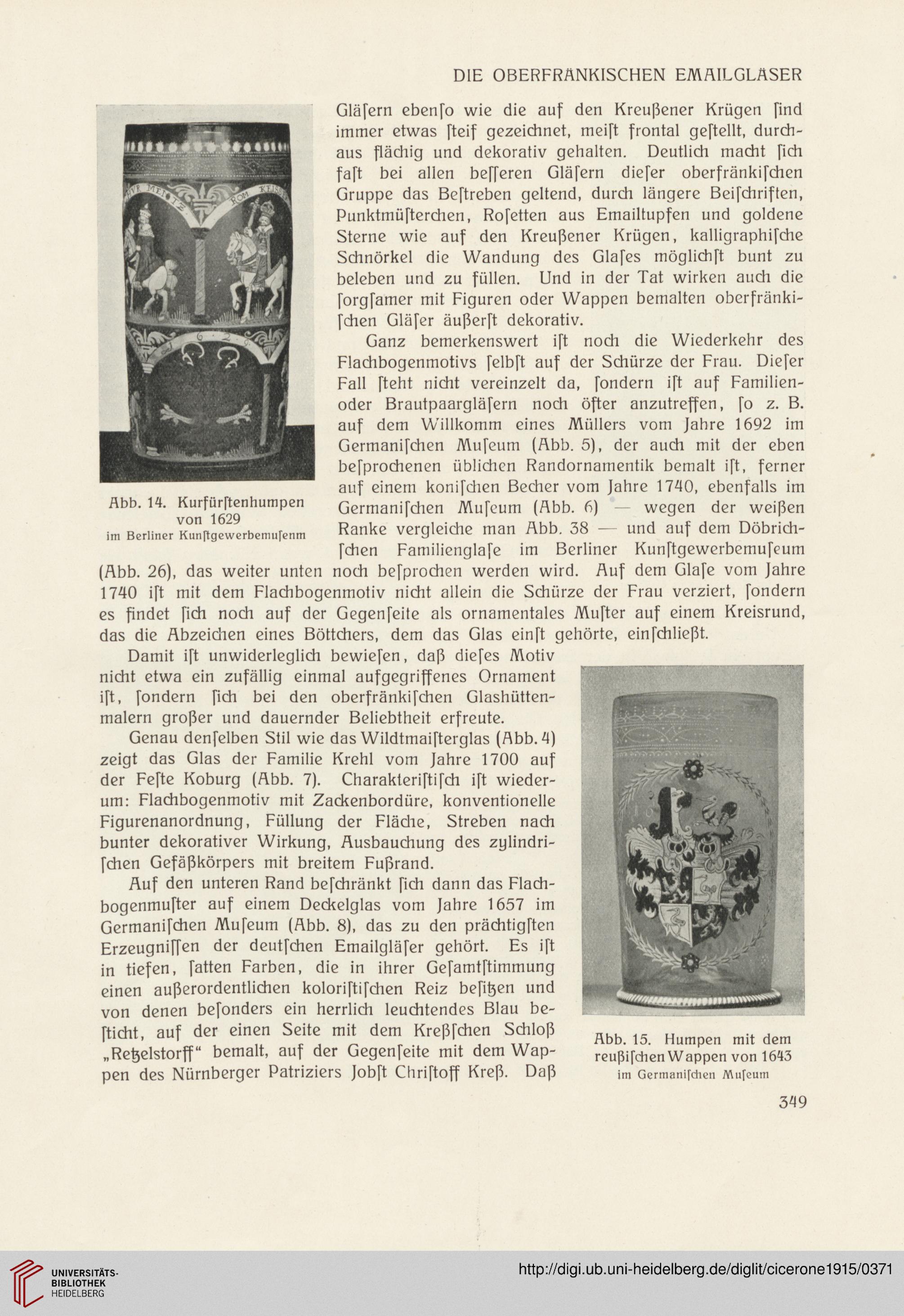Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0371
DOI Heft:
Heft 19/20
DOI Artikel:Zeh, Ernst: Die Oberfränkischen Emailgläser
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0371
DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLÄSER
Gläfern ebenfo wie die auf den Kreußener Krügen find
immer etwas fteif gezeichnet, meift frontal geftellt, durch-
aus flächig und dekorativ gehalten. Deutlich macht fich
faft bei allen befferen Gläfern diefer oberfränkifchen
Gruppe das Beftreben geltend, durch längere Beifchriften,
Punktmüfterchen, Rofetten aus Emailtupfen und goldene
Sterne wie auf den Kreußener Krügen, kalligraphifche
Schnörkel die Wandung des Glafes möglichft bunt zu
beleben und zu füllen. Und in der Tat wirken auch die
forgfamer mit Figuren oder Wappen bemalten oberfränki-
fchen Gläfer äußerft dekorativ.
Ganz bemerkenswert ift noch die Wiederkehr des
Flachbogenmotivs felbft auf der Schürze der Frau. Diefer
Fall fteht nicht vereinzelt da, fondern ift auf Familien-
oder Brautpaargläfern noch öfter anzutreffen, fo z. B.
auf dem Willkomm eines Müllers vom Jahre 1692 im
Germanifchen Mufeum (Äbb. 5), der auch mit der eben
befprochenen üblichen Randornamentik bemalt ift, ferner
auf einem konifchen Becher vom Jahre 1740, ebenfalls im
Germanifchen Mufeum (Abb. 6) — wegen der weißen
Ranke vergleiche man Abb. 38 — und auf dem Döbrich-
fchen Familienglafe im Berliner Kunftgewerbemufeum
(Abb. 26), das weiter unten noch befprochen werden wird. Auf dem Glafe vom Jahre
1740 ift mit dem Flachbogenmotiv nicht allein die Schürze der Frau verziert, fondern
es findet [ich noch auf der Gegenfeile als ornamentales Mufter auf einem Kreisrund,
das die Abzeichen eines Böttchers, dem das Glas ein ft gehörte, einfchließt.
Damit ift unwiderleglich bewiefen, daß diefes Motiv
nicht etwa ein zufällig einmal aufgegriffenes Ornament
ift, fondern fich bei den oberfränkifchen Glashütten-
malern großer und dauernder Beliebtheit erfreute.
Genau denfelben Stil wie das Wildtmaifterglas (Abb. 4)
zeigt das Glas der Familie Krehl vom Jahre 1700 auf
der Fefte Koburg (Abb. 7). Charakteriftifch ift wieder-
um: Flachbogenmotiv mit Zackenbordüre, konventionelle
Figurenanordnung, Füllung der Fläche, Streben nach
bunter dekorativer Wirkung, Ausbauchung des zylindri-
fchen Gefäßkörpers mit breitem Fußrand.
Auf den unteren Rand befchränkt fich dann das Flach-
bogenmufter auf einem Deckelglas vom Jahre 1657 im
Germanifchen Mufeum (Abb. 8), das zu den prächtigften
Erzeugniffen der deutfchen Emailgläfer gehört. Es ift
in tiefen, fatten Farben, die in ihrer Gefamtftimmung
einen außerordentlichen koloriftifchen Reiz befißen und
von denen befonders ein herrlich leuchtendes Blau be-
fticht, auf der einen Seite mit dem Kreßfchen Schloß Äbb lg H mit dem
„Retjelstorff“ bemalt, auf der Gegenfeite mit dem Wap- reußifdien Wappen von 1643
pen des Nürnberger Patriziers Jobft Chriftoff Kreß. Daß im Germanifchen Mufeum
Abb. 14. Kurfürftenhumpen
von 1629
im Berliner Kunftgewerbemufenm
349
Gläfern ebenfo wie die auf den Kreußener Krügen find
immer etwas fteif gezeichnet, meift frontal geftellt, durch-
aus flächig und dekorativ gehalten. Deutlich macht fich
faft bei allen befferen Gläfern diefer oberfränkifchen
Gruppe das Beftreben geltend, durch längere Beifchriften,
Punktmüfterchen, Rofetten aus Emailtupfen und goldene
Sterne wie auf den Kreußener Krügen, kalligraphifche
Schnörkel die Wandung des Glafes möglichft bunt zu
beleben und zu füllen. Und in der Tat wirken auch die
forgfamer mit Figuren oder Wappen bemalten oberfränki-
fchen Gläfer äußerft dekorativ.
Ganz bemerkenswert ift noch die Wiederkehr des
Flachbogenmotivs felbft auf der Schürze der Frau. Diefer
Fall fteht nicht vereinzelt da, fondern ift auf Familien-
oder Brautpaargläfern noch öfter anzutreffen, fo z. B.
auf dem Willkomm eines Müllers vom Jahre 1692 im
Germanifchen Mufeum (Äbb. 5), der auch mit der eben
befprochenen üblichen Randornamentik bemalt ift, ferner
auf einem konifchen Becher vom Jahre 1740, ebenfalls im
Germanifchen Mufeum (Abb. 6) — wegen der weißen
Ranke vergleiche man Abb. 38 — und auf dem Döbrich-
fchen Familienglafe im Berliner Kunftgewerbemufeum
(Abb. 26), das weiter unten noch befprochen werden wird. Auf dem Glafe vom Jahre
1740 ift mit dem Flachbogenmotiv nicht allein die Schürze der Frau verziert, fondern
es findet [ich noch auf der Gegenfeile als ornamentales Mufter auf einem Kreisrund,
das die Abzeichen eines Böttchers, dem das Glas ein ft gehörte, einfchließt.
Damit ift unwiderleglich bewiefen, daß diefes Motiv
nicht etwa ein zufällig einmal aufgegriffenes Ornament
ift, fondern fich bei den oberfränkifchen Glashütten-
malern großer und dauernder Beliebtheit erfreute.
Genau denfelben Stil wie das Wildtmaifterglas (Abb. 4)
zeigt das Glas der Familie Krehl vom Jahre 1700 auf
der Fefte Koburg (Abb. 7). Charakteriftifch ift wieder-
um: Flachbogenmotiv mit Zackenbordüre, konventionelle
Figurenanordnung, Füllung der Fläche, Streben nach
bunter dekorativer Wirkung, Ausbauchung des zylindri-
fchen Gefäßkörpers mit breitem Fußrand.
Auf den unteren Rand befchränkt fich dann das Flach-
bogenmufter auf einem Deckelglas vom Jahre 1657 im
Germanifchen Mufeum (Abb. 8), das zu den prächtigften
Erzeugniffen der deutfchen Emailgläfer gehört. Es ift
in tiefen, fatten Farben, die in ihrer Gefamtftimmung
einen außerordentlichen koloriftifchen Reiz befißen und
von denen befonders ein herrlich leuchtendes Blau be-
fticht, auf der einen Seite mit dem Kreßfchen Schloß Äbb lg H mit dem
„Retjelstorff“ bemalt, auf der Gegenfeite mit dem Wap- reußifdien Wappen von 1643
pen des Nürnberger Patriziers Jobft Chriftoff Kreß. Daß im Germanifchen Mufeum
Abb. 14. Kurfürftenhumpen
von 1629
im Berliner Kunftgewerbemufenm
349