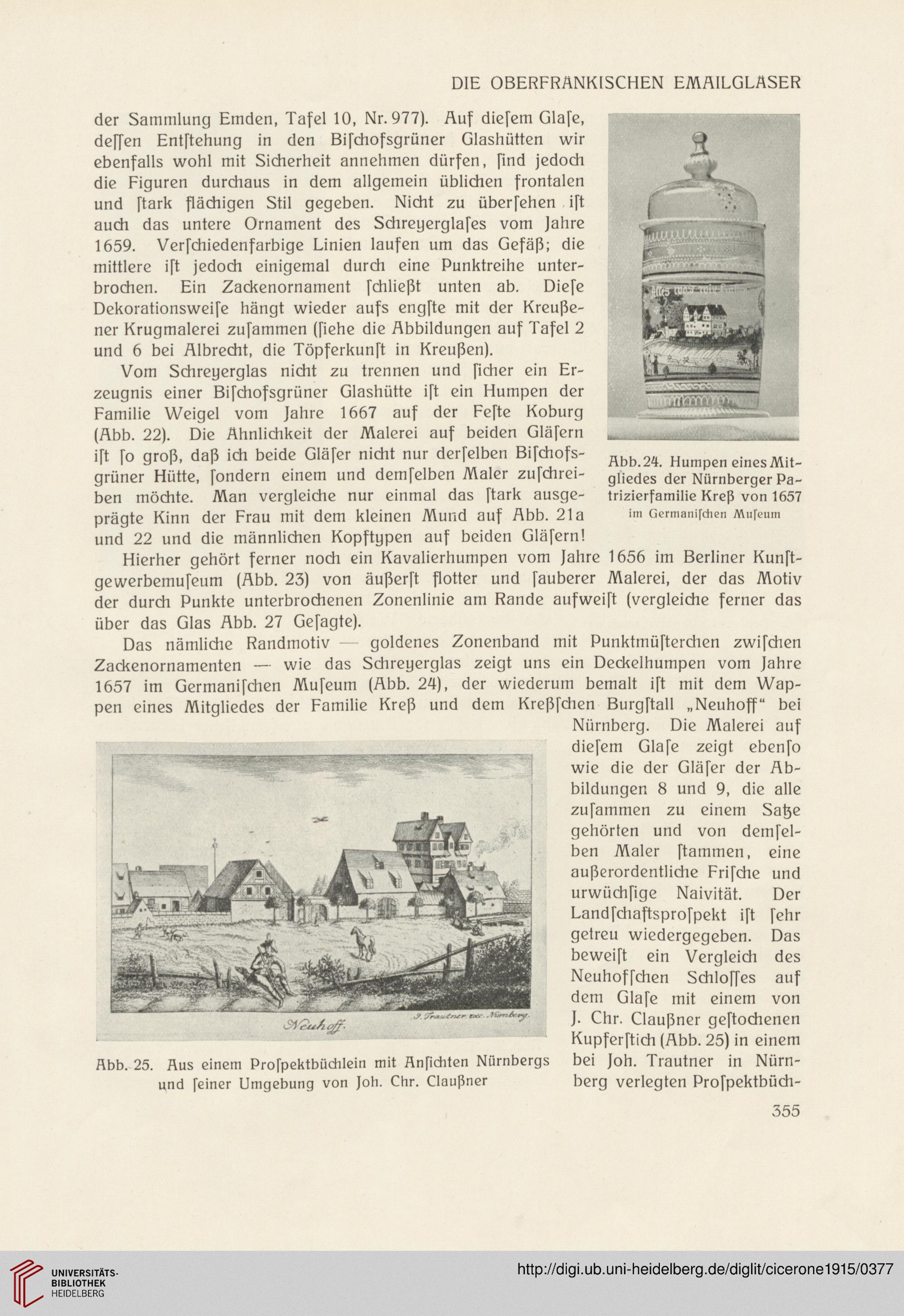Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0377
DOI Heft:
Heft 19/20
DOI Artikel:Zeh, Ernst: Die Oberfränkischen Emailgläser
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0377
DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLÄSER
der Sammlung Emden, Tafel 10, Nr. 977). Auf diefem Glafe,
de|Jen Entftehung in den Bifchofsgrüner Glashütten wir
ebenfalls wohl mit Sicherheit annehmen dürfen, find jedoch
die Figuren durchaus in dem allgemein üblichen frontalen
und ftark flächigen Stil gegeben. Nicht zu überfehen ift
auch das untere Ornament des Schreyerglafes vom Jahre
1659. Verfchiedenfarbige Linien laufen um das Gefäß; die
mittlere ift jedoch einigemal durch eine Punktreihe unter-
brochen. Ein Zackenornament fchließt unten ab. Diefe
Dekorationsweife hängt wieder aufs engfte mit der Kreuße-
ner Krugmalerei zufammen (fiehe die Abbildungen auf Tafel 2
und 6 bei Albrecht, die Töpferkunft in Kreußen).
Vom Schreyerglas nicht zu trennen und pcher ein Er-
zeugnis einer Bifchofsgrüner Glashütte ift ein Humpen der
Familie Weigel vom Jahre 1667 auf der Fefte Koburg
(Abb. 22). Die Ähnlichkeit der Malerei auf beiden Gläfern
ift fo groß, daß ich beide Gläfer nicht nur derfelben Bifchofs-
grüner Hütte, fondern einem und demfelben Maler zufchrei-
ben möchte. Man vergleiche nur einmal das ftark ausge-
prägte Kinn der Frau mit dem kleinen Mund auf Abb. 21a
und 22 und die männlichen Kopftypen auf beiden Gläfern!
Hierher gehört ferner noch ein Kavalierhumpen vom Jahre 1656 im Berliner Kunft-
gewerbemufeum (Abb. 23) von äußerft ßotter und fauberer Malerei, der das Motiv
der durch Punkte unterbrochenen Zonenlinie am Rande aufweift (vergleiche ferner das
über das Glas Abb. 27 Gefagte).
Das nämliche Randmotiv — goldenes Zonenband mit Punktmüfterchen zwifchen
Zackenornamenten — wie das Schreyerglas zeigt uns ein Deckelhumpen vom Jahre
1657 im Germanifchen Mufeum (Abb. 24), der wiederum bemalt ift mit dem Wap-
pen eines Mitgliedes der Familie Kreß und dem Kreßfdien Burgftall „Neuhoff“ bei
Nürnberg. Die Malerei auf
diefem Glafe zeigt ebenfo
wie die der Gläfer der Ab-
bildungen 8 und 9, die alle
zufammen zu einem Safee
gehörten und von demfel-
ben Maler ftammen, eine
außerordentliche Frifche und
urwüchfige Naivität. Der
Landfchaftsprofpekt ift fehr
getreu wiedergegeben. Das
beweift ein Vergleich des
Neuhoffchen Schloffes auf
dem Glafe mit einem von
J. Chr. Claußner geftochenen
Kupferftich (Abb. 25) in einem
bei Joh. Trautner in Nürn-
berg verlegten Profpektbüch-
Äbb. 25. Äus einem Profpektbüdilein mit Änfichten Nürnbergs
und feiner Umgebung von Joh. Chr. Claußner
3.
Äbb.24. Humpen eines Mit-
gliedes der Nürnberger Pa-
trizierfamilie Kreß von 1657
im Germanifchen Mufeum
355
der Sammlung Emden, Tafel 10, Nr. 977). Auf diefem Glafe,
de|Jen Entftehung in den Bifchofsgrüner Glashütten wir
ebenfalls wohl mit Sicherheit annehmen dürfen, find jedoch
die Figuren durchaus in dem allgemein üblichen frontalen
und ftark flächigen Stil gegeben. Nicht zu überfehen ift
auch das untere Ornament des Schreyerglafes vom Jahre
1659. Verfchiedenfarbige Linien laufen um das Gefäß; die
mittlere ift jedoch einigemal durch eine Punktreihe unter-
brochen. Ein Zackenornament fchließt unten ab. Diefe
Dekorationsweife hängt wieder aufs engfte mit der Kreuße-
ner Krugmalerei zufammen (fiehe die Abbildungen auf Tafel 2
und 6 bei Albrecht, die Töpferkunft in Kreußen).
Vom Schreyerglas nicht zu trennen und pcher ein Er-
zeugnis einer Bifchofsgrüner Glashütte ift ein Humpen der
Familie Weigel vom Jahre 1667 auf der Fefte Koburg
(Abb. 22). Die Ähnlichkeit der Malerei auf beiden Gläfern
ift fo groß, daß ich beide Gläfer nicht nur derfelben Bifchofs-
grüner Hütte, fondern einem und demfelben Maler zufchrei-
ben möchte. Man vergleiche nur einmal das ftark ausge-
prägte Kinn der Frau mit dem kleinen Mund auf Abb. 21a
und 22 und die männlichen Kopftypen auf beiden Gläfern!
Hierher gehört ferner noch ein Kavalierhumpen vom Jahre 1656 im Berliner Kunft-
gewerbemufeum (Abb. 23) von äußerft ßotter und fauberer Malerei, der das Motiv
der durch Punkte unterbrochenen Zonenlinie am Rande aufweift (vergleiche ferner das
über das Glas Abb. 27 Gefagte).
Das nämliche Randmotiv — goldenes Zonenband mit Punktmüfterchen zwifchen
Zackenornamenten — wie das Schreyerglas zeigt uns ein Deckelhumpen vom Jahre
1657 im Germanifchen Mufeum (Abb. 24), der wiederum bemalt ift mit dem Wap-
pen eines Mitgliedes der Familie Kreß und dem Kreßfdien Burgftall „Neuhoff“ bei
Nürnberg. Die Malerei auf
diefem Glafe zeigt ebenfo
wie die der Gläfer der Ab-
bildungen 8 und 9, die alle
zufammen zu einem Safee
gehörten und von demfel-
ben Maler ftammen, eine
außerordentliche Frifche und
urwüchfige Naivität. Der
Landfchaftsprofpekt ift fehr
getreu wiedergegeben. Das
beweift ein Vergleich des
Neuhoffchen Schloffes auf
dem Glafe mit einem von
J. Chr. Claußner geftochenen
Kupferftich (Abb. 25) in einem
bei Joh. Trautner in Nürn-
berg verlegten Profpektbüch-
Äbb. 25. Äus einem Profpektbüdilein mit Änfichten Nürnbergs
und feiner Umgebung von Joh. Chr. Claußner
3.
Äbb.24. Humpen eines Mit-
gliedes der Nürnberger Pa-
trizierfamilie Kreß von 1657
im Germanifchen Mufeum
355