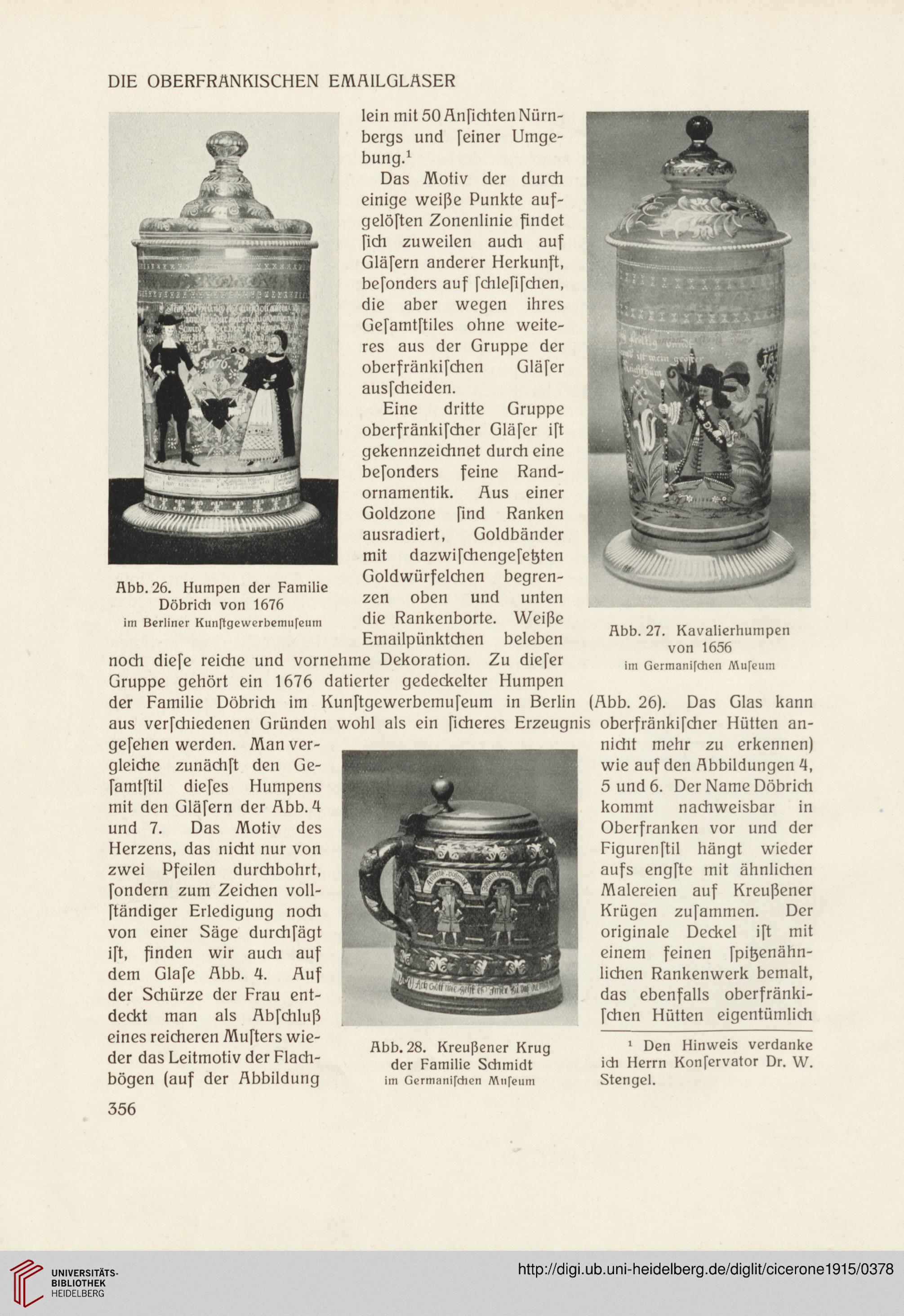Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0378
DOI Heft:
Heft 19/20
DOI Artikel:Zeh, Ernst: Die Oberfränkischen Emailgläser
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0378
DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLÄSER
lein mit 50 Anfichten Nürn-
bergs und [einer Umge-
bung.1
Das Motiv der durch
einige weiße Punkte auf-
gelöften Zonenlinie findet
[ich zuweilen auch auf
Gläfern anderer Herkunft,
befonders auf fchlefifchen,
die aber wegen ihres
Gefamtftiles ohne weite-
res aus der Gruppe der
oberfränkifchen Gläfer
ausfeheiden.
Eine dritte Gruppe
oberfränkifcher Gläfer ift
gekennzeichnet durch eine
befonders feine Rand-
ornamentik. Aus einer
Goldzone find Ranken
ausradiert, Goldbänder
mit dazwifchengefetjten
Goldwürfelchen begren-
zen oben und unten
Äbb. 27. Kavalierhumpen
von 1656
im Germanifchen Mufeum
Herzens, das nicht nur von
zwei Pfeilen durchbohrt,
fondern zum Zeichen voll-
ftändiger Erledigung noch
von einer Säge durchfägt
ift, finden wir auch auf
dem Glafe Abb. 4. Auf
der Schürze der Frau ent-
deckt man als Abfchluß
eines reicheren Mufters wie-
der das Leitmotiv der Flach-
bögen (auf der Abbildung
kommt nachweisbar in
Oberfranken vor und der
Figurenftil hängt wieder
aufs engfte mit ähnlichen
Malereien auf Kreußener
Krügen zufammen. Der
originale Deckel ift mit
einem feinen fpit^enähn-
lichen Rankenwerk bemalt,
das ebenfalls oberfränki-
fchen Hütten eigentümlich
1 Den Hinweis verdanke
idi Herrn Konfervator Dr. W.
Stengel.
Äbb. 28. Kreußener Krug
der Familie Schmidt
im Germanifchen Mufeum
Äbb. 26. Humpen der Familie
Döbrich von 1676
im Berliner Kunftgewerbemufeum die Rankenborte. Weiße
Emailpünktchen beleben
noch diefe reiche und vornehme Dekoration. Zu diefer
Gruppe gehört ein 1676 datierter gedeckelter Humpen
der Familie Döbrich im Kunftgewerbemufeum in Berlin (Abb. 26). Das Glas kann
aus verfchiedenen Gründen wohl als ein ficheres Erzeugnis oberfränkifcher Hütten an-
gefehen werden. Man ver-
gleiche zunächft den Ge-
famtftil diefes Humpens
mit den Gläfern der Abb. 4
und 7. Das Motiv des
nicht mehr zu erkennen)
wie auf den Abbildungen 4,
5 und 6. Der Name Döbrich
356
lein mit 50 Anfichten Nürn-
bergs und [einer Umge-
bung.1
Das Motiv der durch
einige weiße Punkte auf-
gelöften Zonenlinie findet
[ich zuweilen auch auf
Gläfern anderer Herkunft,
befonders auf fchlefifchen,
die aber wegen ihres
Gefamtftiles ohne weite-
res aus der Gruppe der
oberfränkifchen Gläfer
ausfeheiden.
Eine dritte Gruppe
oberfränkifcher Gläfer ift
gekennzeichnet durch eine
befonders feine Rand-
ornamentik. Aus einer
Goldzone find Ranken
ausradiert, Goldbänder
mit dazwifchengefetjten
Goldwürfelchen begren-
zen oben und unten
Äbb. 27. Kavalierhumpen
von 1656
im Germanifchen Mufeum
Herzens, das nicht nur von
zwei Pfeilen durchbohrt,
fondern zum Zeichen voll-
ftändiger Erledigung noch
von einer Säge durchfägt
ift, finden wir auch auf
dem Glafe Abb. 4. Auf
der Schürze der Frau ent-
deckt man als Abfchluß
eines reicheren Mufters wie-
der das Leitmotiv der Flach-
bögen (auf der Abbildung
kommt nachweisbar in
Oberfranken vor und der
Figurenftil hängt wieder
aufs engfte mit ähnlichen
Malereien auf Kreußener
Krügen zufammen. Der
originale Deckel ift mit
einem feinen fpit^enähn-
lichen Rankenwerk bemalt,
das ebenfalls oberfränki-
fchen Hütten eigentümlich
1 Den Hinweis verdanke
idi Herrn Konfervator Dr. W.
Stengel.
Äbb. 28. Kreußener Krug
der Familie Schmidt
im Germanifchen Mufeum
Äbb. 26. Humpen der Familie
Döbrich von 1676
im Berliner Kunftgewerbemufeum die Rankenborte. Weiße
Emailpünktchen beleben
noch diefe reiche und vornehme Dekoration. Zu diefer
Gruppe gehört ein 1676 datierter gedeckelter Humpen
der Familie Döbrich im Kunftgewerbemufeum in Berlin (Abb. 26). Das Glas kann
aus verfchiedenen Gründen wohl als ein ficheres Erzeugnis oberfränkifcher Hütten an-
gefehen werden. Man ver-
gleiche zunächft den Ge-
famtftil diefes Humpens
mit den Gläfern der Abb. 4
und 7. Das Motiv des
nicht mehr zu erkennen)
wie auf den Abbildungen 4,
5 und 6. Der Name Döbrich
356