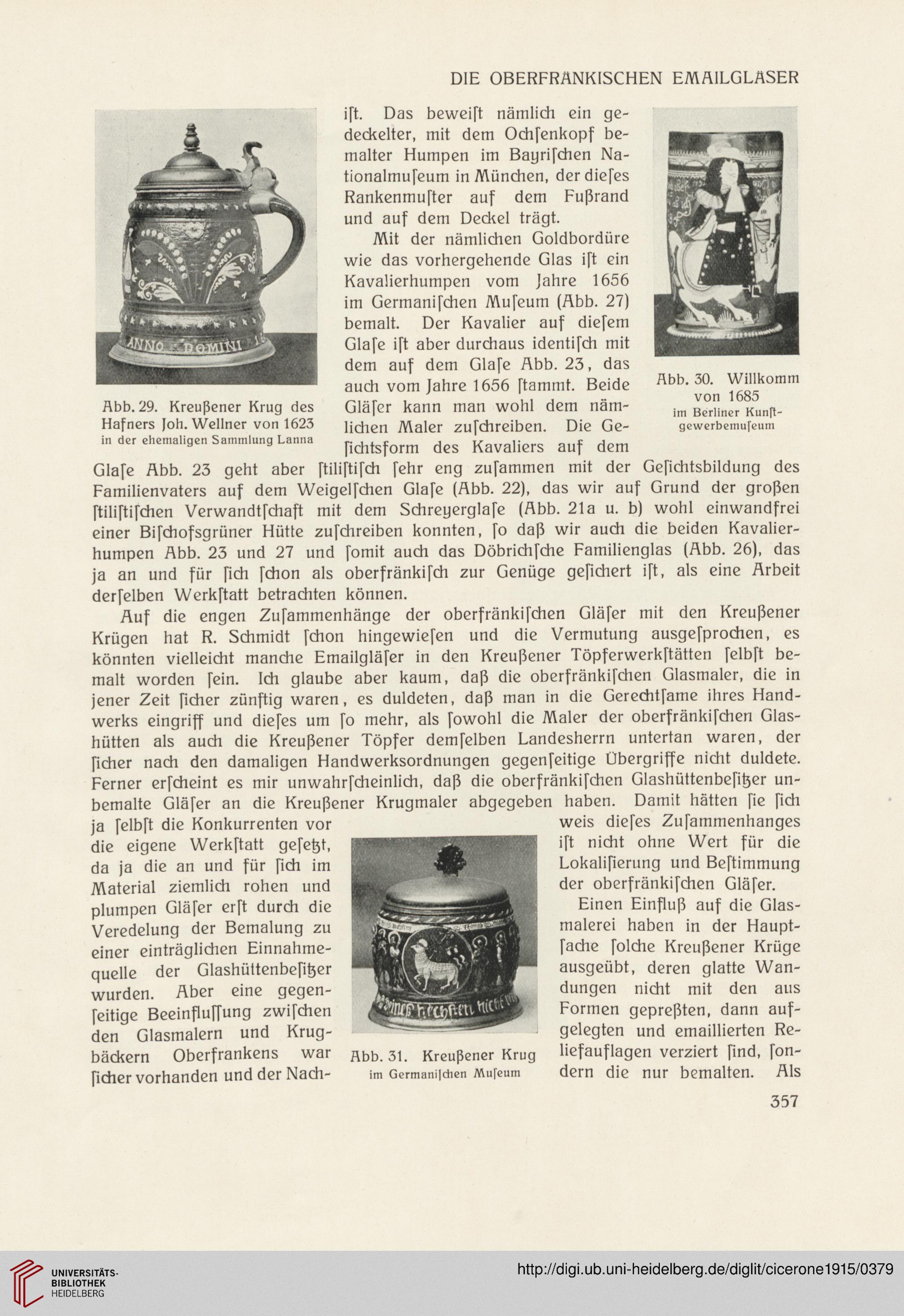DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLÄSER
ift. Das beweift nämlich ein ge-
deckelter, mit dem Ochfenkopf be-
malter Humpen im Bayrifchen Na-
tionalmufeum in München, der diefes
Rankenmufter auf dem Fußrand
und auf dem Deckel trägt.
Mit der nämlichen Goldbordüre
Äbb. 29. Kreußener Krug des
Hafners foh. Wellner von 1623
in der ehemaligen Sammlung Lanna
Äbb. 30. Willkomm
von 1685
im Berliner Kunft-
gewerbemufeum
wie das vorhergehende Glas ift ein
Kavalierhumpen vom Jahre 1656
im Germanifchen Mufeum (Äbb. 27)
bemalt. Der Kavalier auf diefem
Glafe ift aber durchaus identifdi mit
dem auf dem Glafe Abb. 23, das
auch vom Jahre 1656 ftammt. Beide
Gläfer kann man wohl dem näm-
lichen Maler zufchreiben. Die Ge-
fichtsform des Kavaliers auf dem
Glafe Abb. 23 geht aber ftiliftifch fehr eng zufammen mit der Gefichtsbildung des
Familienvaters auf dem Weigelfchen Glafe (Abb. 22), das wir auf Grund der großen
ftiliftifchen Verwandtfchaft mit dem Schreyerglafe (Abb. 21a u. b) wohl einwandfrei
einer Bifchofsgrüner Hütte zufchreiben konnten, fo daß wir auch die beiden Kavalier-
humpen Abb. 23 und 27 und fomit auch das Döbrichfche Familienglas (Äbb. 26), das
ja an und für fich fchon als oberfränkifch zur Genüge gefichert ift, als eine Arbeit
derfelben Werkftatt betrachten können.
Auf die engen Zufammenhänge der oberfränkifchen Gläfer mit den Kreußener
Krügen hat R. Schmidt fchon hingewiefen und die Vermutung ausgefprochen, es
könnten vielleicht manche Emailgläfer in den Kreußener Töpferwerkftätten felbft be-
malt worden fein. Ich glaube aber kaum, daß die oberfränkifchen Glasmaler, die in
jener Zeit ficher zünftig waren, es duldeten, daß man in die Gerechtfame ihres Hand-
werks eingriff und diefes um fo mehr, als fowohl die Maler der oberfränkifchen Glas-
hütten als auch die Kreußener Töpfer demfelben Landesherrn untertan waren, der
ficher nach den damaligen Handwerksordnungen gegenfeitige Übergriffe nicht duldete.
Ferner erfcheint es mir unwahrfcheinlich, daß die oberfränkifchen Glashüttenbefitjer un-
bemalte Gläfer an die Kreußener Krugmaler abgegeben haben. Damit hätten fie fich
[H—
ja felbft die Konkurrenten vor
die eigene Werkftatt gefetjt,
da ja die an und für fich im
Material ziemlich rohen und
plumpen Gläfer erft durch die
Veredelung der Bemalung zu
einer einträglichen Einnahme-
quelle der Glashüttenbefißer
wurden. Aber eine gegen-
feitige Beeinßuffung zwifchen
den Glasmalern und Krug-
bäckern Oberfrankens war Äbb. 31. Kreußener Krug
pdier vorhanden und der Nach- im Germani|chen Mufeum
weis diefes Zufammenhanges
ift nicht ohne Wert für die
Lokalifierung und Beftimmung
der oberfränkifchen Gläfer.
Einen Einfluß auf die Glas-
malerei haben in der Haupt-
fache folche Kreußener Krüge
ausgeübt, deren glatte Wan-
dungen nicht mit den aus
Formen gepreßten, dann auf-
gelegten und emaillierten Re-
liefauflagen verziert find, fon-
dern die nur bemalten. Als
357
ift. Das beweift nämlich ein ge-
deckelter, mit dem Ochfenkopf be-
malter Humpen im Bayrifchen Na-
tionalmufeum in München, der diefes
Rankenmufter auf dem Fußrand
und auf dem Deckel trägt.
Mit der nämlichen Goldbordüre
Äbb. 29. Kreußener Krug des
Hafners foh. Wellner von 1623
in der ehemaligen Sammlung Lanna
Äbb. 30. Willkomm
von 1685
im Berliner Kunft-
gewerbemufeum
wie das vorhergehende Glas ift ein
Kavalierhumpen vom Jahre 1656
im Germanifchen Mufeum (Äbb. 27)
bemalt. Der Kavalier auf diefem
Glafe ift aber durchaus identifdi mit
dem auf dem Glafe Abb. 23, das
auch vom Jahre 1656 ftammt. Beide
Gläfer kann man wohl dem näm-
lichen Maler zufchreiben. Die Ge-
fichtsform des Kavaliers auf dem
Glafe Abb. 23 geht aber ftiliftifch fehr eng zufammen mit der Gefichtsbildung des
Familienvaters auf dem Weigelfchen Glafe (Abb. 22), das wir auf Grund der großen
ftiliftifchen Verwandtfchaft mit dem Schreyerglafe (Abb. 21a u. b) wohl einwandfrei
einer Bifchofsgrüner Hütte zufchreiben konnten, fo daß wir auch die beiden Kavalier-
humpen Abb. 23 und 27 und fomit auch das Döbrichfche Familienglas (Äbb. 26), das
ja an und für fich fchon als oberfränkifch zur Genüge gefichert ift, als eine Arbeit
derfelben Werkftatt betrachten können.
Auf die engen Zufammenhänge der oberfränkifchen Gläfer mit den Kreußener
Krügen hat R. Schmidt fchon hingewiefen und die Vermutung ausgefprochen, es
könnten vielleicht manche Emailgläfer in den Kreußener Töpferwerkftätten felbft be-
malt worden fein. Ich glaube aber kaum, daß die oberfränkifchen Glasmaler, die in
jener Zeit ficher zünftig waren, es duldeten, daß man in die Gerechtfame ihres Hand-
werks eingriff und diefes um fo mehr, als fowohl die Maler der oberfränkifchen Glas-
hütten als auch die Kreußener Töpfer demfelben Landesherrn untertan waren, der
ficher nach den damaligen Handwerksordnungen gegenfeitige Übergriffe nicht duldete.
Ferner erfcheint es mir unwahrfcheinlich, daß die oberfränkifchen Glashüttenbefitjer un-
bemalte Gläfer an die Kreußener Krugmaler abgegeben haben. Damit hätten fie fich
[H—
ja felbft die Konkurrenten vor
die eigene Werkftatt gefetjt,
da ja die an und für fich im
Material ziemlich rohen und
plumpen Gläfer erft durch die
Veredelung der Bemalung zu
einer einträglichen Einnahme-
quelle der Glashüttenbefißer
wurden. Aber eine gegen-
feitige Beeinßuffung zwifchen
den Glasmalern und Krug-
bäckern Oberfrankens war Äbb. 31. Kreußener Krug
pdier vorhanden und der Nach- im Germani|chen Mufeum
weis diefes Zufammenhanges
ift nicht ohne Wert für die
Lokalifierung und Beftimmung
der oberfränkifchen Gläfer.
Einen Einfluß auf die Glas-
malerei haben in der Haupt-
fache folche Kreußener Krüge
ausgeübt, deren glatte Wan-
dungen nicht mit den aus
Formen gepreßten, dann auf-
gelegten und emaillierten Re-
liefauflagen verziert find, fon-
dern die nur bemalten. Als
357