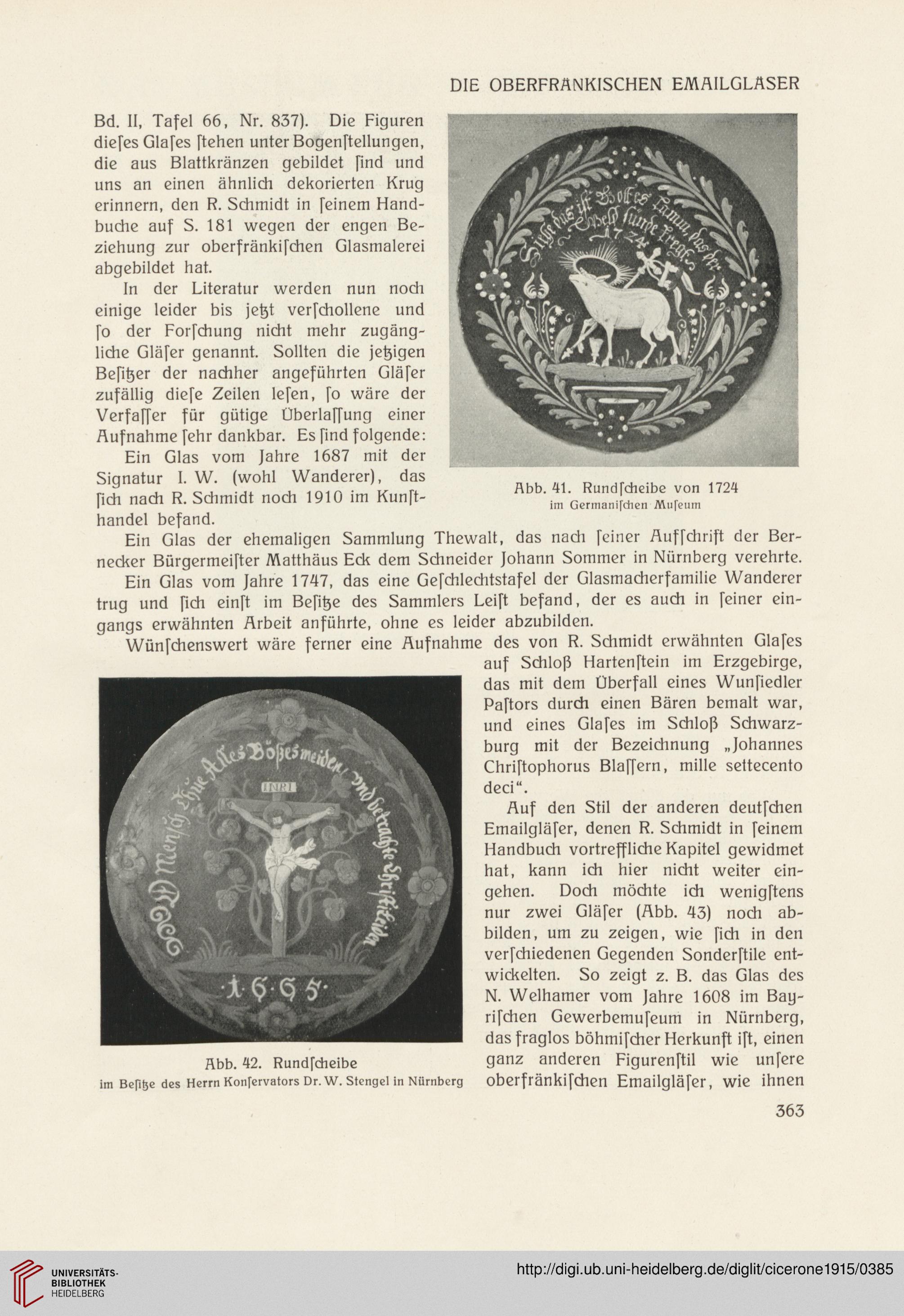Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 7.1915
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0385
DOI Heft:
Heft 19/20
DOI Artikel:Zeh, Ernst: Die Oberfränkischen Emailgläser
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26376#0385
DIE OBERFRÄNKISCHEN EMAILGLASER
Bd. II, Tafel 66, Nr. 837). Die Figuren
diefes Glafes [tehen unter Bogenftellungen,
die aus Blattkränzen gebildet find und
uns an einen ähnlich dekorierten Krug
erinnern, den R. Schmidt in feinem Hand-
buche auf S. 181 wegen der engen Be-
ziehung zur oberfränkifchen Glasmalerei
abgebildet hat.
In der Literatur werden nun noch
einige leider bis jefet verfchollene und
fo der Forfchung nicht mehr zugäng-
liche Gläfer genannt. Sollten die jefeigen
Bepfeer der nachher angeführten Gläfer
zufällig diefe Zeilen lefen, fo wäre der
Verfaffer für gütige Überlaffung einer
Aufnahme fehr dankbar. Es find folgende:
Ein Glas vom Jahre 1687 mit der
Signatur I. W. (wohl Wanderer), das
fich nach R. Schmidt noch 1910 im Kunft-
handel befand.
Ein Glas der ehemaligen Sammlung Thewalt, das nadi feiner Auffchrift der Ber-
necker Bürgermeifter Matthäus Eck dem Schneider Johann Sommer in Nürnberg verehrte.
Ein Glas vom Jahre 1747, das eine Gefchlechtstafel der Glasmacherfamilie Wanderer
trug und fich einft im Befifee des Sammlers Leift befand, der es auch in feiner ein-
gangs erwähnten Arbeit anführte, ohne es leider abzubilden.
Wünfchenswert wäre ferner eine Aufnahme des von R. Schmidt erwähnten Glafes
auf Schloß Hartenftein im Erzgebirge,
das mit dem Überfall eines Wunfiedler
Paftors durch einen Bären bemalt war,
und eines Glafes im Schloß Schwarz-
burg mit der Bezeichnung „Johannes
Chriftophorus Blaffern, mille settecento
deci“.
Auf den Stil der anderen deutfchen
Emailgläfer, denen R. Schmidt in feinem
Handbuch vortreffliche Kapitel gewidmet
hat, kann ich hier nicht weiter ein-
gehen. Doch möchte ich wenigftens
nur zwei Gläfer (Abb. 43) noch ab-
bilden, um zu zeigen, wie fich in den
verfchiedenen Gegenden Sonderftile ent-
wickelten. So zeigt z. B. das Glas des
N. Welhamer vom Jahre 1608 im Bay-
rifchen Gewerbemufeum in Nürnberg,
das fraglos böhmifcher Herkunft ift, einen
ganz anderen Figurenftil wie unfere
oberfränkifchen Emailgläfer, wie ihnen
^ mm' t
V, - ^
‘■■'■•«r
w
Äbb. 42. Rundfeheibe
im Befitje des Herrn Konfervators Dr. W. Stengel in Nürnberg
Abb. 41. Rundfcheibe von 1724
im Germanifchen Mufeum
363
Bd. II, Tafel 66, Nr. 837). Die Figuren
diefes Glafes [tehen unter Bogenftellungen,
die aus Blattkränzen gebildet find und
uns an einen ähnlich dekorierten Krug
erinnern, den R. Schmidt in feinem Hand-
buche auf S. 181 wegen der engen Be-
ziehung zur oberfränkifchen Glasmalerei
abgebildet hat.
In der Literatur werden nun noch
einige leider bis jefet verfchollene und
fo der Forfchung nicht mehr zugäng-
liche Gläfer genannt. Sollten die jefeigen
Bepfeer der nachher angeführten Gläfer
zufällig diefe Zeilen lefen, fo wäre der
Verfaffer für gütige Überlaffung einer
Aufnahme fehr dankbar. Es find folgende:
Ein Glas vom Jahre 1687 mit der
Signatur I. W. (wohl Wanderer), das
fich nach R. Schmidt noch 1910 im Kunft-
handel befand.
Ein Glas der ehemaligen Sammlung Thewalt, das nadi feiner Auffchrift der Ber-
necker Bürgermeifter Matthäus Eck dem Schneider Johann Sommer in Nürnberg verehrte.
Ein Glas vom Jahre 1747, das eine Gefchlechtstafel der Glasmacherfamilie Wanderer
trug und fich einft im Befifee des Sammlers Leift befand, der es auch in feiner ein-
gangs erwähnten Arbeit anführte, ohne es leider abzubilden.
Wünfchenswert wäre ferner eine Aufnahme des von R. Schmidt erwähnten Glafes
auf Schloß Hartenftein im Erzgebirge,
das mit dem Überfall eines Wunfiedler
Paftors durch einen Bären bemalt war,
und eines Glafes im Schloß Schwarz-
burg mit der Bezeichnung „Johannes
Chriftophorus Blaffern, mille settecento
deci“.
Auf den Stil der anderen deutfchen
Emailgläfer, denen R. Schmidt in feinem
Handbuch vortreffliche Kapitel gewidmet
hat, kann ich hier nicht weiter ein-
gehen. Doch möchte ich wenigftens
nur zwei Gläfer (Abb. 43) noch ab-
bilden, um zu zeigen, wie fich in den
verfchiedenen Gegenden Sonderftile ent-
wickelten. So zeigt z. B. das Glas des
N. Welhamer vom Jahre 1608 im Bay-
rifchen Gewerbemufeum in Nürnberg,
das fraglos böhmifcher Herkunft ift, einen
ganz anderen Figurenftil wie unfere
oberfränkifchen Emailgläfer, wie ihnen
^ mm' t
V, - ^
‘■■'■•«r
w
Äbb. 42. Rundfeheibe
im Befitje des Herrn Konfervators Dr. W. Stengel in Nürnberg
Abb. 41. Rundfcheibe von 1724
im Germanifchen Mufeum
363