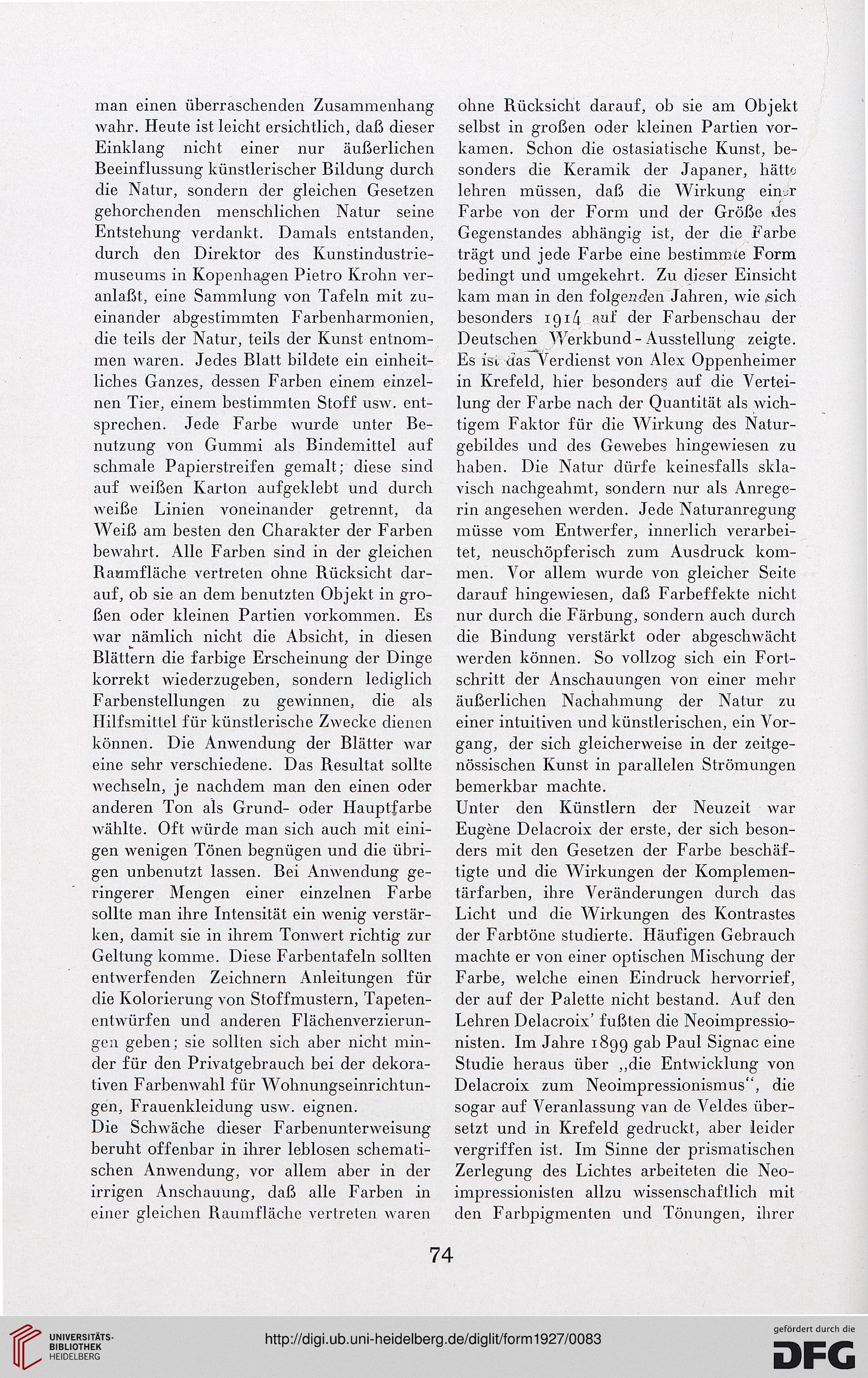man einen überraschenden Zusammenhang
wahr. Heute ist leicht ersichtlich, daß dieser
Einklang nicht einer nur äußerlichen
Beeinflussung künstlerischer Bildung durch
die Natur, sondern der gleichen Gesetzen
gehorchenden menschlichen Natur seine
Entstehung verdankt. Damals entstanden,
durch den Direktor des Kunstindustrie-
museums in Kopenhagen Pietro Krohn ver-
anlaßt, eine Sammlung von Tafeln mit zu-
einander abgestimmten Farbenharmonien,
die teils der Natur, teils der Kunst entnom-
men waren. Jedes Blatt bildete ein einheit-
liches Ganzes, dessen Farben einem einzel-
nen Tier, einem bestimmten Stoff usw. ent-
sprechen. Jede Farbe wurde unter Be-
nutzung von Gummi als Bindemittel auf
schmale Papierstreifen gemalt; diese sind
auf weißen Karton aufgeklebt und durch
weiße Linien voneinander getrennt, da
Weiß am besten den Charakter der Farben
bewahrt. Alle Farben sind in der gleichen
Baamfläche vertreten ohne Bücksicht dar-
auf, ob sie an dem benutzten Objekt in gro-
ßen oder kleinen Partien vorkommen. Es
war nämlich nicht die Absicht, in diesen
Blättern die farbige Erscheinung der Dinge
korrekt wiederzugeben, sondern lediglich
Farbenstellungen zu gewinnen, die als
Hilfsmittel für künstlerische Zwecke dienen
können. Die Anwendung der Blätter war
eine sehr verschiedene. Das Besultat sollte
wechseln, je nachdem man den einen oder
anderen Ton als Grund- oder Hauptfarbe
wählte. Oft würde man sich auch mit eini-
gen wenigen Tönen begnügen und die übri-
gen unbenutzt lassen. Bei Anwendung ge-
ringerer Mengen einer einzelnen Farbe
sollte man ihre Intensität ein wenig verstär-
ken, damit sie in ihrem Tonwert richtig zur
Geltung komme. Diese Farbentafeln sollten
entwerfenden Zeichnern Anleitungen für
die Kolorierung von Stoffmustern, Tapeten-
entwürfen und anderen Flächenverzierun-
gen geben; sie sollten sich aber nicht min-
der für den Privatgebrauch bei der dekora-
tiven Farbenwahl für Wohnungseinrichtun-
gen, Frauenkleidung usw. eignen.
Die Schwäche dieser Farbenunterweisung
beruht offenbar in ihrer leblosen schemati-
schen Anwendung, vor allem aber in der
irrigen Anschauung, daß alle Farben in
einer gleichen Baumfläche vertreten waren
ohne Bücksicht darauf, ob sie am Objekt
selbst in großen oder kleinen Partien vor-
kamen. Schon die ostasiatische Kunst, be-
sonders die Keramik der Japaner, hätte
lehren müssen, daß die Wirkung einjr
Farbe von der Form und der Größe des
Gegenstandes abhängig ist, der die Farbe
trägt und jede Farbe eine bestimmte Form
bedingt und umgekehrt. Zu dieser Einsicht
kam man in den folgenden Jahren, wie sich
besonders igi4 auf der Farbenschau der
Deutschen Werkbund-Ausstellung zeigte.
Es isi das Verdienst von Alex Oppenheimer
in Krefeld, hier besonders auf die Vertei-
lung der Farbe nach der Quantität als wich-
tigem Faktor für die Wirkung des Natur-
gebildes und des Gewebes hingewiesen zu
haben. Die Natur dürfe keinesfalls skla-
visch nachgeahmt, sondern nur als Anrege-
rin angesehen werden. Jede Naturanregung
müsse vom Entwerfer, innerlich verarbei-
tet, neuschöpferisch zum Ausdruck kom-
men. Vor allem wurde von gleicher Seite
darauf hingewiesen, daß Farbeffekte nicht
nur durch die Färbung, sondern auch durch
die Bindung verstärkt oder abgeschwächt
werden können. So vollzog sich ein Fort-
schritt der Anschauungen von einer mehr
äußerlichen Nachahmung der Natur zu
einer intuitiven und künstlerischen, ein Vor-
gang, der sich gleicherweise in der zeitge-
nössischen Kunst in parallelen Strömungen
bemerkbar machte.
Unter den Künstlern der Neuzeit war
Eugene Delacroix der erste, der sich beson-
ders mit den Gesetzen der Farbe beschäf-
tigte und die Wirkungen der Komplemen-
tärfarben, ihre Veränderungen durch das
Licht und die Wirkungen des Kontrastes
der Farbtöne studierte. Häufigen Gebrauch
machte er von einer optischen Mischung der
Farbe, welche einen Eindruck hervorrief,
der auf der Palette nicht bestand. Auf den
Lehren Delacroix' fußten die Neoimpressio-
nisten. Im Jahre 1899 gab Paul Signac eine
Studie heraus über „die Entwicklung von
Delacroix zum Neoimpressionismus", die
sogar auf Veranlassung van de Veldes über-
setzt und in Krefeld gedruckt, aber leider
vergriffen ist. Im Sinne der prismatischen
Zerlegung des Lichtes arbeiteten die Neo-
impressionislen allzu wissenschaftlich mit
den Farbpigmenten und Tönungen, ihrer
74
wahr. Heute ist leicht ersichtlich, daß dieser
Einklang nicht einer nur äußerlichen
Beeinflussung künstlerischer Bildung durch
die Natur, sondern der gleichen Gesetzen
gehorchenden menschlichen Natur seine
Entstehung verdankt. Damals entstanden,
durch den Direktor des Kunstindustrie-
museums in Kopenhagen Pietro Krohn ver-
anlaßt, eine Sammlung von Tafeln mit zu-
einander abgestimmten Farbenharmonien,
die teils der Natur, teils der Kunst entnom-
men waren. Jedes Blatt bildete ein einheit-
liches Ganzes, dessen Farben einem einzel-
nen Tier, einem bestimmten Stoff usw. ent-
sprechen. Jede Farbe wurde unter Be-
nutzung von Gummi als Bindemittel auf
schmale Papierstreifen gemalt; diese sind
auf weißen Karton aufgeklebt und durch
weiße Linien voneinander getrennt, da
Weiß am besten den Charakter der Farben
bewahrt. Alle Farben sind in der gleichen
Baamfläche vertreten ohne Bücksicht dar-
auf, ob sie an dem benutzten Objekt in gro-
ßen oder kleinen Partien vorkommen. Es
war nämlich nicht die Absicht, in diesen
Blättern die farbige Erscheinung der Dinge
korrekt wiederzugeben, sondern lediglich
Farbenstellungen zu gewinnen, die als
Hilfsmittel für künstlerische Zwecke dienen
können. Die Anwendung der Blätter war
eine sehr verschiedene. Das Besultat sollte
wechseln, je nachdem man den einen oder
anderen Ton als Grund- oder Hauptfarbe
wählte. Oft würde man sich auch mit eini-
gen wenigen Tönen begnügen und die übri-
gen unbenutzt lassen. Bei Anwendung ge-
ringerer Mengen einer einzelnen Farbe
sollte man ihre Intensität ein wenig verstär-
ken, damit sie in ihrem Tonwert richtig zur
Geltung komme. Diese Farbentafeln sollten
entwerfenden Zeichnern Anleitungen für
die Kolorierung von Stoffmustern, Tapeten-
entwürfen und anderen Flächenverzierun-
gen geben; sie sollten sich aber nicht min-
der für den Privatgebrauch bei der dekora-
tiven Farbenwahl für Wohnungseinrichtun-
gen, Frauenkleidung usw. eignen.
Die Schwäche dieser Farbenunterweisung
beruht offenbar in ihrer leblosen schemati-
schen Anwendung, vor allem aber in der
irrigen Anschauung, daß alle Farben in
einer gleichen Baumfläche vertreten waren
ohne Bücksicht darauf, ob sie am Objekt
selbst in großen oder kleinen Partien vor-
kamen. Schon die ostasiatische Kunst, be-
sonders die Keramik der Japaner, hätte
lehren müssen, daß die Wirkung einjr
Farbe von der Form und der Größe des
Gegenstandes abhängig ist, der die Farbe
trägt und jede Farbe eine bestimmte Form
bedingt und umgekehrt. Zu dieser Einsicht
kam man in den folgenden Jahren, wie sich
besonders igi4 auf der Farbenschau der
Deutschen Werkbund-Ausstellung zeigte.
Es isi das Verdienst von Alex Oppenheimer
in Krefeld, hier besonders auf die Vertei-
lung der Farbe nach der Quantität als wich-
tigem Faktor für die Wirkung des Natur-
gebildes und des Gewebes hingewiesen zu
haben. Die Natur dürfe keinesfalls skla-
visch nachgeahmt, sondern nur als Anrege-
rin angesehen werden. Jede Naturanregung
müsse vom Entwerfer, innerlich verarbei-
tet, neuschöpferisch zum Ausdruck kom-
men. Vor allem wurde von gleicher Seite
darauf hingewiesen, daß Farbeffekte nicht
nur durch die Färbung, sondern auch durch
die Bindung verstärkt oder abgeschwächt
werden können. So vollzog sich ein Fort-
schritt der Anschauungen von einer mehr
äußerlichen Nachahmung der Natur zu
einer intuitiven und künstlerischen, ein Vor-
gang, der sich gleicherweise in der zeitge-
nössischen Kunst in parallelen Strömungen
bemerkbar machte.
Unter den Künstlern der Neuzeit war
Eugene Delacroix der erste, der sich beson-
ders mit den Gesetzen der Farbe beschäf-
tigte und die Wirkungen der Komplemen-
tärfarben, ihre Veränderungen durch das
Licht und die Wirkungen des Kontrastes
der Farbtöne studierte. Häufigen Gebrauch
machte er von einer optischen Mischung der
Farbe, welche einen Eindruck hervorrief,
der auf der Palette nicht bestand. Auf den
Lehren Delacroix' fußten die Neoimpressio-
nisten. Im Jahre 1899 gab Paul Signac eine
Studie heraus über „die Entwicklung von
Delacroix zum Neoimpressionismus", die
sogar auf Veranlassung van de Veldes über-
setzt und in Krefeld gedruckt, aber leider
vergriffen ist. Im Sinne der prismatischen
Zerlegung des Lichtes arbeiteten die Neo-
impressionislen allzu wissenschaftlich mit
den Farbpigmenten und Tönungen, ihrer
74