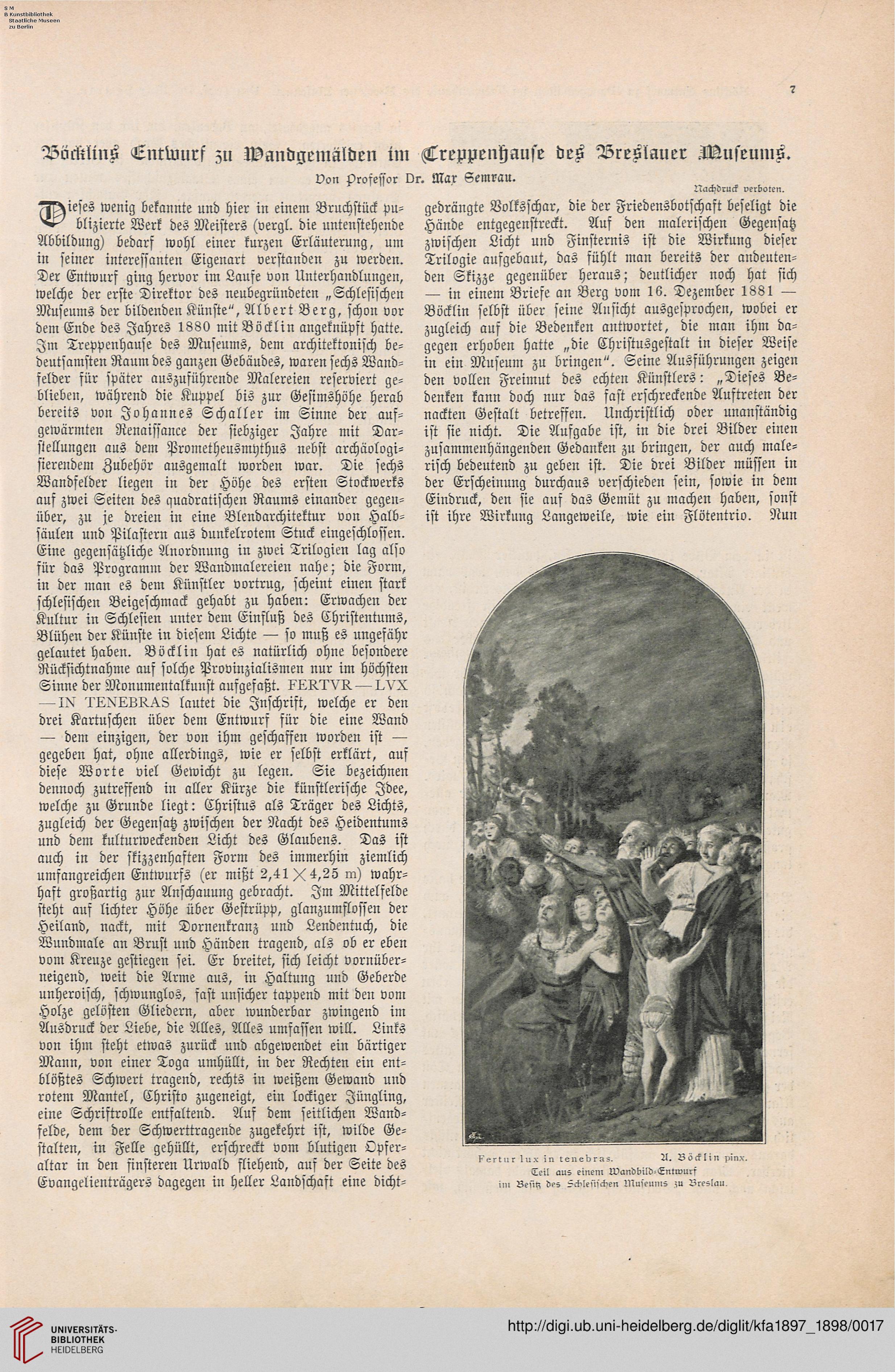Bürkliiis Lmwurf zu Wandgemälden im ^lreppenhanse de^ Breslauer Museums.
von Professor Or. Mar Semrau. ck b '
^^ieses wenig bekannte und hier in einem Bruchstück pu-
blizierte Werk des Meisters (vergl. die untenstehende
Abbildung) bedarf Wohl einer kurzen Erläuterung, um
in seiner interessanten Eigenart verstanden zu werden.
Der Entwurf ging hervor im Lause von Unterhandlungen,
welche der erste Direktor des neubegründetcn „Schlesischen
Museums der bildenden Künste", Albert Berg, schon vor
dem Ende des Jahres 1880 mit Böcklin angeknüpft hatte.
Im Treppenhause des Museums, dem architektonisch be-
deutsamsten Raum des ganzen Gebäudes, waren sechs Wand-
felder für später auszuführende Malereien reserviert ge-
blieben, während die Kuppel bis zur Gesimshöhe herab
bereits von Johannes Schalter im Sinne der auf-
gewärmten Renaissance der siebziger Jahre mit Dar-
stellungen aus dem Prometheusmythus nebst archäologi-
sierendem Zubehör ausgemalt worden war. Die sechs
Wandfelder liegen in der Höhe des ersten Stockwerks
auf zwei Seiten des quadratischen Raums einander gegen-
über, zu je dreien in eine Blendarchitektur von Halb-
säulen und Pilastern aus dunkelrotem Stuck eingeschlossen.
Eine gegensätzliche Anordnung in zwei Trilogien lag also
für das Programm der Wandmalereien nahe; die Form,
in der man es dem Künstler vortrug, scheint einen stark
schlesischen Beigeschmack gehabt zu haben: Erwachen der
Kultur in Schlesien unter dem Einfluß des Christentums,
Blühen der Künste in diesem Lichte — so muß es ungefähr
gelautet haben. Böcklin hat es natürlich ohne besondere
Rücksichtnahme auf solche Provinzialismen nur im höchsten
Sinne der Monumentalkunst aufgefaßt. HU'I'VK—UVX
-IX 'l'UXLVKXL lautet die Inschrift, welche er den
drei Kartuschen über dem Entwurf für die eine Wand
— dem einzigen, der von ihm geschaffen worden ist —
gegeben hat, ohne allerdings, wie er selbst erklärt, auf
diese Worte viel Gewicht zu legen. Sie bezeichnen
dennoch zutreffend in aller Kürze die künstlerische Idee,
welche zu Grunde liegt: Christus als Träger des Lichts,
zugleich der Gegensatz zwischen der Nacht des Heidentums
und dem kulturweckenden Licht des Glaubens. Das ist
auch in der skizzenhaften Form des immerhin ziemlich
umfangreichen Entwurfs (er mißt 2,41X4,25 m) wahr-
haft großartig zur Anschauung gebracht. Im Mittelfelde
steht auf lichter Höhe über Gestrüpp, glanzumflossen der
Heiland, nackt, mit Dornenkranz und Lendentuch, die
Wundmale an Brust und Händen tragend, als ob er eben
vom Kreuze gestiegen sei. Er breitet, sich leicht vornüber-
neigend, weit die Arme aus, in Haltung und Geberde
unheroisch, schwunglos, fast unsicher tappend mit den voni
Holze gelösten Gliedern, aber wunderbar zwingend im
Ausdruck der Liebe, die Alles, Alles umfassen will. Links
von ihm steht etwas zurück und abgewendet ein bärtiger
Mann, von einer Toga umhüllt, in der Rechten ein ent-
blößtes Schwert tragend, rechts in weißem Gewand und
rotem Mantel, Christo zugeneigt, ein lockiger Jüngling,
eine Schriftrolle entfaltend. Auf dem seitlichen Wand-
felde, dem der Schwerttragende zugekehrt ist, wilde Ge-
stalten, in Felle gehüllt, erschreckt vom blutigen Opfer-
altar in den finsteren Urwald fliehend, auf der Seite des
Evangelienträgers dagegen in Heller Landschaft eine dicht-
gedrängte Volksschar, die der Friedensbotschaft beseligt die
Hände entgegenstreckt. Auf den malerischen Gegensatz
zwischen Licht und Finsternis ist die Wirkung dieser
Trilogie aufgebaut, das fühlt man bereits der andeuten-
den Skizze gegenüber heraus; deutlicher noch hat sich
— in einem Briefe an Berg vom 16. Dezember 1881 —
Böcklin selbst über seine Ansicht ausgesprochen, wobei er
zugleich auf die Bedenken antwortet, die man ihm da-
gegen erhoben hatte „die Christusgestalt in dieser Weise
in ein Museum zu bringen". Seine Ausführungen zeigen
den vollen Freimut des echten Künstlers: „Dieses Be-
denken kann doch nur das fast erschreckende Auftreten der
nackten Gestalt betreffen. Unchristlich oder unanständig
ist sie nicht. Die Aufgabe ist, in die drei Bilder einen
zusammenhängenden Gedanken zu bringen, der auch male-
risch bedeutend zu geben ist. Die drei Bilder müssen in
der Erscheinung durchaus verschieden sein, sowie in dem
Eindruck, den sie auf das Gemüt zu machen haben, sonst
ist ihre Wirkung Langeweile, wie ein Flötentrio. Nun
von Professor Or. Mar Semrau. ck b '
^^ieses wenig bekannte und hier in einem Bruchstück pu-
blizierte Werk des Meisters (vergl. die untenstehende
Abbildung) bedarf Wohl einer kurzen Erläuterung, um
in seiner interessanten Eigenart verstanden zu werden.
Der Entwurf ging hervor im Lause von Unterhandlungen,
welche der erste Direktor des neubegründetcn „Schlesischen
Museums der bildenden Künste", Albert Berg, schon vor
dem Ende des Jahres 1880 mit Böcklin angeknüpft hatte.
Im Treppenhause des Museums, dem architektonisch be-
deutsamsten Raum des ganzen Gebäudes, waren sechs Wand-
felder für später auszuführende Malereien reserviert ge-
blieben, während die Kuppel bis zur Gesimshöhe herab
bereits von Johannes Schalter im Sinne der auf-
gewärmten Renaissance der siebziger Jahre mit Dar-
stellungen aus dem Prometheusmythus nebst archäologi-
sierendem Zubehör ausgemalt worden war. Die sechs
Wandfelder liegen in der Höhe des ersten Stockwerks
auf zwei Seiten des quadratischen Raums einander gegen-
über, zu je dreien in eine Blendarchitektur von Halb-
säulen und Pilastern aus dunkelrotem Stuck eingeschlossen.
Eine gegensätzliche Anordnung in zwei Trilogien lag also
für das Programm der Wandmalereien nahe; die Form,
in der man es dem Künstler vortrug, scheint einen stark
schlesischen Beigeschmack gehabt zu haben: Erwachen der
Kultur in Schlesien unter dem Einfluß des Christentums,
Blühen der Künste in diesem Lichte — so muß es ungefähr
gelautet haben. Böcklin hat es natürlich ohne besondere
Rücksichtnahme auf solche Provinzialismen nur im höchsten
Sinne der Monumentalkunst aufgefaßt. HU'I'VK—UVX
-IX 'l'UXLVKXL lautet die Inschrift, welche er den
drei Kartuschen über dem Entwurf für die eine Wand
— dem einzigen, der von ihm geschaffen worden ist —
gegeben hat, ohne allerdings, wie er selbst erklärt, auf
diese Worte viel Gewicht zu legen. Sie bezeichnen
dennoch zutreffend in aller Kürze die künstlerische Idee,
welche zu Grunde liegt: Christus als Träger des Lichts,
zugleich der Gegensatz zwischen der Nacht des Heidentums
und dem kulturweckenden Licht des Glaubens. Das ist
auch in der skizzenhaften Form des immerhin ziemlich
umfangreichen Entwurfs (er mißt 2,41X4,25 m) wahr-
haft großartig zur Anschauung gebracht. Im Mittelfelde
steht auf lichter Höhe über Gestrüpp, glanzumflossen der
Heiland, nackt, mit Dornenkranz und Lendentuch, die
Wundmale an Brust und Händen tragend, als ob er eben
vom Kreuze gestiegen sei. Er breitet, sich leicht vornüber-
neigend, weit die Arme aus, in Haltung und Geberde
unheroisch, schwunglos, fast unsicher tappend mit den voni
Holze gelösten Gliedern, aber wunderbar zwingend im
Ausdruck der Liebe, die Alles, Alles umfassen will. Links
von ihm steht etwas zurück und abgewendet ein bärtiger
Mann, von einer Toga umhüllt, in der Rechten ein ent-
blößtes Schwert tragend, rechts in weißem Gewand und
rotem Mantel, Christo zugeneigt, ein lockiger Jüngling,
eine Schriftrolle entfaltend. Auf dem seitlichen Wand-
felde, dem der Schwerttragende zugekehrt ist, wilde Ge-
stalten, in Felle gehüllt, erschreckt vom blutigen Opfer-
altar in den finsteren Urwald fliehend, auf der Seite des
Evangelienträgers dagegen in Heller Landschaft eine dicht-
gedrängte Volksschar, die der Friedensbotschaft beseligt die
Hände entgegenstreckt. Auf den malerischen Gegensatz
zwischen Licht und Finsternis ist die Wirkung dieser
Trilogie aufgebaut, das fühlt man bereits der andeuten-
den Skizze gegenüber heraus; deutlicher noch hat sich
— in einem Briefe an Berg vom 16. Dezember 1881 —
Böcklin selbst über seine Ansicht ausgesprochen, wobei er
zugleich auf die Bedenken antwortet, die man ihm da-
gegen erhoben hatte „die Christusgestalt in dieser Weise
in ein Museum zu bringen". Seine Ausführungen zeigen
den vollen Freimut des echten Künstlers: „Dieses Be-
denken kann doch nur das fast erschreckende Auftreten der
nackten Gestalt betreffen. Unchristlich oder unanständig
ist sie nicht. Die Aufgabe ist, in die drei Bilder einen
zusammenhängenden Gedanken zu bringen, der auch male-
risch bedeutend zu geben ist. Die drei Bilder müssen in
der Erscheinung durchaus verschieden sein, sowie in dem
Eindruck, den sie auf das Gemüt zu machen haben, sonst
ist ihre Wirkung Langeweile, wie ein Flötentrio. Nun