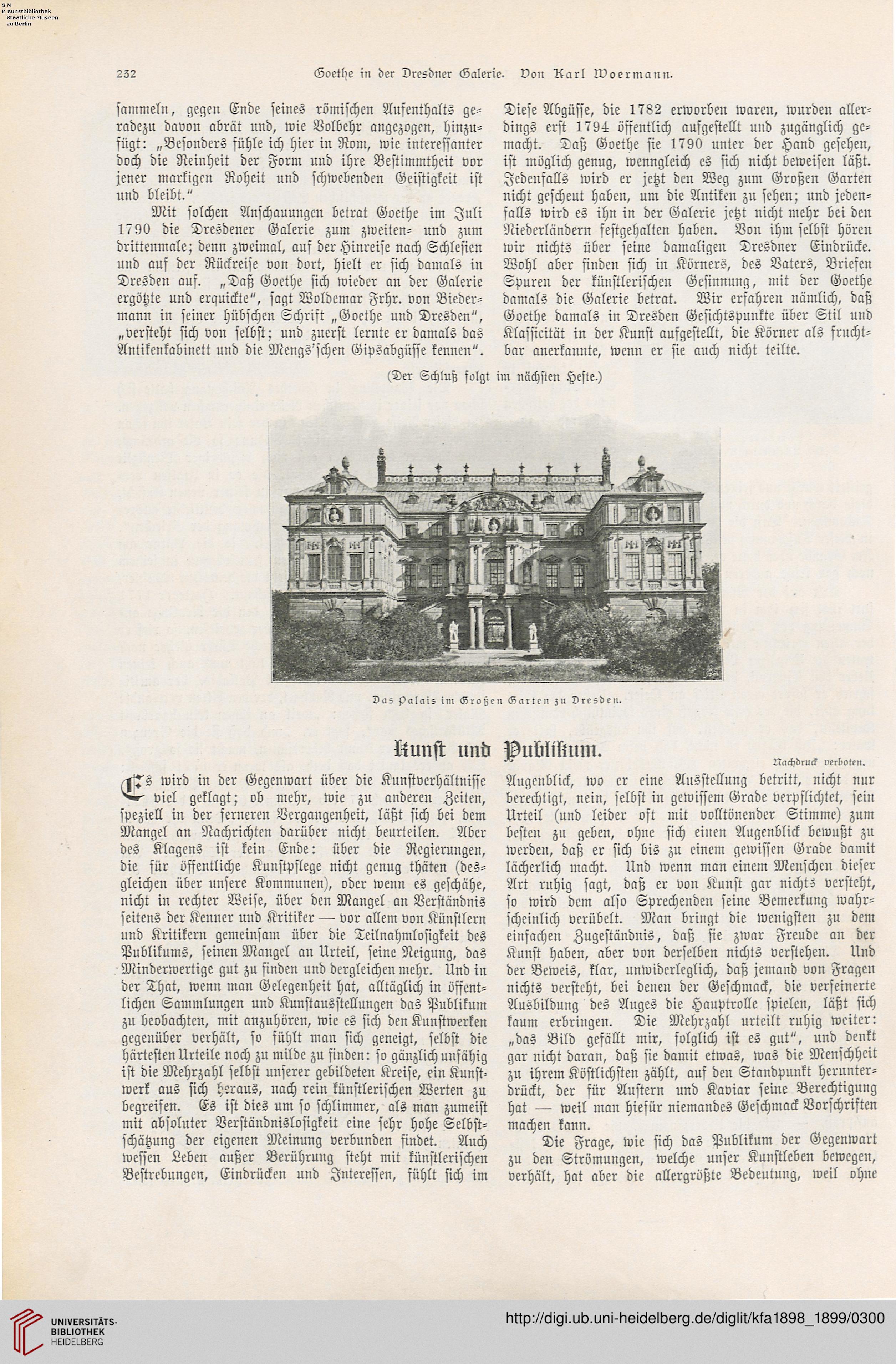232
Goethe in der Dresdner Galerie. Don Karl Moermann-
sammeln, gegen Ende seines römischen Aufenthalts ge-
radezu davon abrät und, wie Volbehr angezogen, hinzu-
fügt: „Besonders fühle ich hier in Rom, wie interessanter
doch die Reinheit der Form und ihre Bestimmtheit vor
jener markigen Roheit und schwebenden Geistigkeit ist
und bleibt."
Mit solchen Anschauungen betrat Goethe im Juli
1790 die Dresdener Galerie zum zweiten- und zum
drittenmale; denn zweimal, auf der Hinreise nach Schlesien
und auf der Rückreise von dort, hielt er sich damals in
Dresden auf. „Daß Goethe sich wieder an der Galerie
ergötzte und erquickte", sagt Woldemar Frhr. von Bieder-
mann in seiner hübschen Schrift „Goethe und Dresden",
„versteht sich von selbst; und zuerst lernte er damals das
Antikenkabinett und die Mengs'schen Gipsabgüsse kennen".
Diese Abgüsse, die 1782 erworben waren, wurden aller-
dings erst 1794 öffentlich aufgestellt und zugänglich ge-
macht. Daß Goethe sie 1790 unter der Hand gesehen,
ist möglich genug, wenngleich es sich nicht beweisen läßt.
Jedenfalls wird er jetzt den Weg zum Großen Garten
nicht gescheut haben, um die Antiken zu sehen; und jeden-
falls wird es ihn in der Galerie jetzt nicht mehr bei den
Niederländern festgehalten haben. Von ihm selbst hören
wir nichts über seine damaligen Dresdner Eindrücke.
Wohl aber finden sich in Körners, des Vaters, Briefen
Spuren der künstlerischen Gesinnung, mit der Goethe
damals die Galerie betrat. Wir erfahren nämlich, daß
Goethe damals in Dresden Gesichtspunkte über Stil und
Klassicität in der Kunst aufgestellt, die Körner als frucht-
bar anerkannte, wenn er sie auch nicht teilte.
(Der Schluß folgt im nächsten Hefte.)
Dunst und Publikum.
/Tl^s wird in der Gegenwart über die Kunstverhältnisse
viel geklagt; ob mehr, wie zu anderen Zeiten,
speziell in der ferneren Vergangenheit, läßt sich bei dem
Mangel an Nachrichten darüber nicht beurteilen. Aber
des Klagens ist kein Ende: über die Regierungen,
die für öffentliche Kunstpflege nicht genug thäten (des-
gleichen über unsere Kommunen), oder wenn es geschähe,
nicht in rechter Weise, über den Mangel an Verständnis
seitens der Kenner und Kritiker — vor allem von Künstlern
und Kritikern gemeinsam über die Teilnahmlosigkeit des
Publikums, seinen Mangel an Urteil, seine Neigung, das
Minderwertige gut zu finden und dergleichen mehr. Und in
der That, wenn man Gelegenheit hat, alltäglich in öffent-
lichen Sammlungen und Kunstausstellungen das Publikum
zu beobachten, mit anzuhören, wie es sich den Kunstwerken
gegenüber verhält, so fühlt man sich geneigt, selbst die
härtesten Urteile noch zu milde zu finden: so gänzlich unfähig
ist die Mehrzahl selbst unserer gebildeten Kreise, ein Kunst-
werk aus sich heraus, nach rein künstlerischen Werten zu
begreifen. Es ist dies um so schlimmer, als man zumeist
mit absoluter Verständnislosigkeit eine sehr hohe Selbst-
schätzung der eigenen Meinung verbunden findet. Auch
wessen Leben außer Berührung steht mit künstlerischen
Bestrebungen, Eindrücken und Interessen, fühlt sich im
Augenblick, wo er eine Ausstellung betritt, nicht nur
berechtigt, nein, selbst in gewissem Grade verpflichtet, sein
Urteil (und leider oft mit volltönender Stimme) zum
besten zu geben, ohne sich einen Augenblick bewußt zu
werden, daß er sich bis zu einem gewissen Grade damit
lächerlich macht. Und wenn man einem Menschen dieser
Art ruhig sagt, daß er von Kunst gar nichts versteht,
so wird dem also Sprechenden seine Bemerkung wahr-
scheinlich verübelt. Man bringt die wenigsten zu dem
einfachen Zugeständnis, daß sie zwar Freude an der
Kunst haben, aber von derselben nichts verstehen. Und
der Beweis, klar, unwiderleglich, daß jemand von Fragen
nichts versteht, bei denen der Geschmack, die verfeinerte
Ausbildung des Auges die Hauptrolle spielen, läßt sich
kaum erbringen. Die Mehrzahl urteilt ruhig weiter:
„das Bild gefällt mir, folglich ist es gut", und denkt
gar nicht daran, daß sie damit etwas, was die Menschheit
zu ihrem Köstlichsten zählt, auf den Standpunkt herunter-
drückt, der für Austern und Kaviar seine Berechtigung
hat — weil man hiesür niemandes Geschmack Vorschriften
machen kann.
Die Frage, wie sich das Publikum der Gegenwart
zu den Strömungen, welche unser Kunstleben bewegen,
verhält, hat aber die allergrößte Bedeutung, weil ohne
Goethe in der Dresdner Galerie. Don Karl Moermann-
sammeln, gegen Ende seines römischen Aufenthalts ge-
radezu davon abrät und, wie Volbehr angezogen, hinzu-
fügt: „Besonders fühle ich hier in Rom, wie interessanter
doch die Reinheit der Form und ihre Bestimmtheit vor
jener markigen Roheit und schwebenden Geistigkeit ist
und bleibt."
Mit solchen Anschauungen betrat Goethe im Juli
1790 die Dresdener Galerie zum zweiten- und zum
drittenmale; denn zweimal, auf der Hinreise nach Schlesien
und auf der Rückreise von dort, hielt er sich damals in
Dresden auf. „Daß Goethe sich wieder an der Galerie
ergötzte und erquickte", sagt Woldemar Frhr. von Bieder-
mann in seiner hübschen Schrift „Goethe und Dresden",
„versteht sich von selbst; und zuerst lernte er damals das
Antikenkabinett und die Mengs'schen Gipsabgüsse kennen".
Diese Abgüsse, die 1782 erworben waren, wurden aller-
dings erst 1794 öffentlich aufgestellt und zugänglich ge-
macht. Daß Goethe sie 1790 unter der Hand gesehen,
ist möglich genug, wenngleich es sich nicht beweisen läßt.
Jedenfalls wird er jetzt den Weg zum Großen Garten
nicht gescheut haben, um die Antiken zu sehen; und jeden-
falls wird es ihn in der Galerie jetzt nicht mehr bei den
Niederländern festgehalten haben. Von ihm selbst hören
wir nichts über seine damaligen Dresdner Eindrücke.
Wohl aber finden sich in Körners, des Vaters, Briefen
Spuren der künstlerischen Gesinnung, mit der Goethe
damals die Galerie betrat. Wir erfahren nämlich, daß
Goethe damals in Dresden Gesichtspunkte über Stil und
Klassicität in der Kunst aufgestellt, die Körner als frucht-
bar anerkannte, wenn er sie auch nicht teilte.
(Der Schluß folgt im nächsten Hefte.)
Dunst und Publikum.
/Tl^s wird in der Gegenwart über die Kunstverhältnisse
viel geklagt; ob mehr, wie zu anderen Zeiten,
speziell in der ferneren Vergangenheit, läßt sich bei dem
Mangel an Nachrichten darüber nicht beurteilen. Aber
des Klagens ist kein Ende: über die Regierungen,
die für öffentliche Kunstpflege nicht genug thäten (des-
gleichen über unsere Kommunen), oder wenn es geschähe,
nicht in rechter Weise, über den Mangel an Verständnis
seitens der Kenner und Kritiker — vor allem von Künstlern
und Kritikern gemeinsam über die Teilnahmlosigkeit des
Publikums, seinen Mangel an Urteil, seine Neigung, das
Minderwertige gut zu finden und dergleichen mehr. Und in
der That, wenn man Gelegenheit hat, alltäglich in öffent-
lichen Sammlungen und Kunstausstellungen das Publikum
zu beobachten, mit anzuhören, wie es sich den Kunstwerken
gegenüber verhält, so fühlt man sich geneigt, selbst die
härtesten Urteile noch zu milde zu finden: so gänzlich unfähig
ist die Mehrzahl selbst unserer gebildeten Kreise, ein Kunst-
werk aus sich heraus, nach rein künstlerischen Werten zu
begreifen. Es ist dies um so schlimmer, als man zumeist
mit absoluter Verständnislosigkeit eine sehr hohe Selbst-
schätzung der eigenen Meinung verbunden findet. Auch
wessen Leben außer Berührung steht mit künstlerischen
Bestrebungen, Eindrücken und Interessen, fühlt sich im
Augenblick, wo er eine Ausstellung betritt, nicht nur
berechtigt, nein, selbst in gewissem Grade verpflichtet, sein
Urteil (und leider oft mit volltönender Stimme) zum
besten zu geben, ohne sich einen Augenblick bewußt zu
werden, daß er sich bis zu einem gewissen Grade damit
lächerlich macht. Und wenn man einem Menschen dieser
Art ruhig sagt, daß er von Kunst gar nichts versteht,
so wird dem also Sprechenden seine Bemerkung wahr-
scheinlich verübelt. Man bringt die wenigsten zu dem
einfachen Zugeständnis, daß sie zwar Freude an der
Kunst haben, aber von derselben nichts verstehen. Und
der Beweis, klar, unwiderleglich, daß jemand von Fragen
nichts versteht, bei denen der Geschmack, die verfeinerte
Ausbildung des Auges die Hauptrolle spielen, läßt sich
kaum erbringen. Die Mehrzahl urteilt ruhig weiter:
„das Bild gefällt mir, folglich ist es gut", und denkt
gar nicht daran, daß sie damit etwas, was die Menschheit
zu ihrem Köstlichsten zählt, auf den Standpunkt herunter-
drückt, der für Austern und Kaviar seine Berechtigung
hat — weil man hiesür niemandes Geschmack Vorschriften
machen kann.
Die Frage, wie sich das Publikum der Gegenwart
zu den Strömungen, welche unser Kunstleben bewegen,
verhält, hat aber die allergrößte Bedeutung, weil ohne