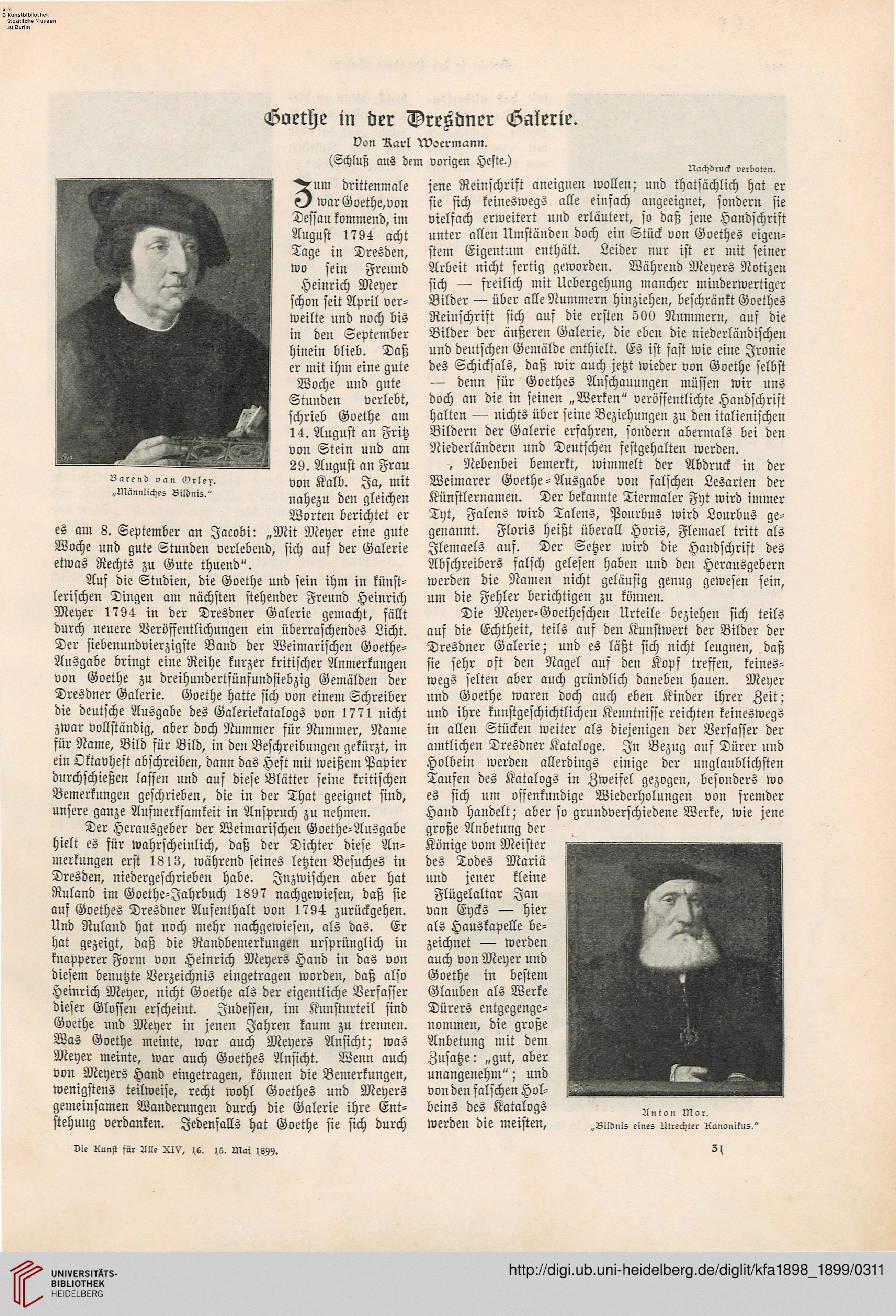Goethe in der Dresdner Galerie.
von Rarl wscvmcrnn.
(Schluß aus dem vorigen Hefte.)
^um drittenmale
O war Goethe,von
Dessau kommend, im
August 1794 acht
Tage in Dresden,
wo sein Freund
Heinrich Meyer
schon seit April ver-
weilte und noch bis
in den September
hinein blieb. Daß
er mit ihm eine gute
Woche und gute
Stunden verlebt,
schrieb Goethe am
14. August an Fritz
von Stein und am
29. August an Frau
von Kalb. Ja, mit
nahezu den gleichen
Worten berichtet er
es am 8. September an Jacobi: „Mit Meyer eine gute
Woche und gute Stunden verlebend, sich auf der Galerie
etwas Rechts zu Gute thuend".
Auf die Studien, die Goethe und sein ihm in künst-
lerischen Dingen am nächsten stehender Freund Heinrich
Meyer 1794 in der Dresdner Galerie gemacht, fällt
durch neuere Veröffentlichungen ein überraschendes Licht.
Der siebenundvierzigste Band der Weimarischen Goethe-
Ausgabe bringt eine Reihe kurzer kritischer Anmerkungen
von Goethe zu dreihundertfünfundsiebzig Gemälden der
Dresdner Galerie. Goethe hatte sich von einem Schreiber
die deutsche Ausgabe des Galeriekatalogs von 1771 nicht
zwar vollständig, aber doch Nummer für Nummer, Name
für Name, Bild für Bild, in den Beschreibungen gekürzt, in
ein Oktavheft abschreiben, dann das Heft mit weißem Papier
durchschießen lassen und auf diese Blätter seine kritischen
Bemerkungen geschrieben, die in der That geeignet sind,
unsere ganze Aufmerksamkeir in Anspruch zu nehmen.
Der Herausgeber der Weimarischen Goethe-Ausgabe
hielt es für wahrscheinlich, daß der Dichter diese An-
merkungen erst 1813, während seines letzten Besuches in
Dresden, niedergeschrieben habe. Inzwischen aber hat
Ruland im Goethe-Jahrbuch 1897 nachgewiesen, daß sie
auf Goethes Dresdner Aufenthalt von 1794 zurückgehen.
Und Ruland hat noch mehr nachgewiesen, als das. Er
hat gezeigt, daß die Randbemerkungen ursprünglich in
knapperer Form von Heinrich Meyers Hand in das von
diesem benutzte Verzeichnis eingetragen worden, daß also
Heinrich Meyer, nicht Goethe als der eigentliche Verfasser
dieser Glossen erscheint. Indessen, im Kunsturteil sind
Goethe und Meyer in jenen Jahren kaum zu trennen.
Was Goethe meinte, war auch Meyers Ansicht; was
Meyer meinte, war auch Goethes Ansicht. Wenn auch
von Meyers Hand eingetragen, können die Bemerkungen,
wenigstens teilweise, recht wohl Goethes und Meyers
gemeinsamen Wanderungen durch die Galerie ihre Ent-
stehung verdanken. Jedenfalls hat Goethe sie sich durch
jene Reinschrift aneignen wollen; und thatsächlich hat er
sie sich keineswegs alle einfach angeeignet, sondern sie
vielfach erweitert und erläutert, so daß jene Handschrift
unter allen Umständen doch ein Stück von Goethes eigen-
stem Eigentum enthält. Leider nur ist er mit seiner
Arbeit nicht fertig geworden. Während Meyers Notizen
sich — freilich mit Uebergehung mancher minderwertiger
Bilder — über alle Nummern hinziehen, beschränkt Goethes
Reinschrift sich aus die ersten 500 Nummern, auf die
Bilder der äußeren Galerie, die eben die niederländischen
und deutschen Gemälde enthielt. Es ist fast wie eine Ironie
des Schicksals, daß wir auch jetzt wieder von Goethe selbst
— denn für Goethes Anschauungen müssen wir uns
doch an die in seinen „Werken" veröffentlichte Handschrift
halten — nichts über seine Beziehungen zu den italienischen
Bildern der Galerie erfahren, sondern abermals bei den
Niederländern und Deutschen festgehalten werden.
, Nebenbei bemerkt, wimmelt der Abdruck in der
Weimarer Goethe-Ausgabe von falschen Lesarten der
Künstlernamen. Der bekannte Tiermaler Fyt wird immer
Tyt, Falens wird Talens, Pourbus wird Lourbus ge-
genannt. Floris heißt überall Horis, Flemael tritt als
Jlemaels auf. Der Setzer wird die Handschrift des
Abschreibers falsch gelesen haben und den Herausgebern
werden die Namen nicht geläufig genug gewesen sein,
um die Fehler berichtigen zu können.
Die Meyer-Goetheschen Urteile beziehen sich teils
auf die Echtheit, teils auf den Kunstwert der Bilder der
Dresdner Galerie; und es läßt sich nicht leugnen, daß
sie sehr oft den Nagel auf den Kopf treffen, keines-
wegs selten aber auch gründlich daneben hauen. Meyer
und Goethe waren doch auch eben Kinder ihrer Zeit;
und ihre kunstgeschichtlichen Kenntnisse reichten keineswegs
in allen Stücken weiter als diejenigen der Verfasser der
amtlichen Dresdner Kataloge. In Bezug auf Dürer und
Holbein werden allerdings einige der unglaublichsten
Taufen des Katalogs in Zweifel gezogen, besonders wo
es sich um offenkundige Wiederholungen von fremder
Hand handelt; aber so grundverschiedene Werke, wie jene
große Anbetung der
Könige vom Meister
des Todes Mariä
und jener kleine
Flügelaltar Jan
van Eycks — hier
als Hauskapelle be-
zeichnet — werden
auch von Meyer und
Goethe in bestem
Glauben als Werke
Dürers entgegenge-
nommen, die große
Anbetung mit dem
Zusatze: „gut, aber
unangenehm"; und
von den falschen Hol-
beins des Katalogs
Werden die Meisten, „Bildnis eines Utrechter Kanonikus."
-l
Die Kunst für Alle XIV, I«. IS. Mai ISA?.
von Rarl wscvmcrnn.
(Schluß aus dem vorigen Hefte.)
^um drittenmale
O war Goethe,von
Dessau kommend, im
August 1794 acht
Tage in Dresden,
wo sein Freund
Heinrich Meyer
schon seit April ver-
weilte und noch bis
in den September
hinein blieb. Daß
er mit ihm eine gute
Woche und gute
Stunden verlebt,
schrieb Goethe am
14. August an Fritz
von Stein und am
29. August an Frau
von Kalb. Ja, mit
nahezu den gleichen
Worten berichtet er
es am 8. September an Jacobi: „Mit Meyer eine gute
Woche und gute Stunden verlebend, sich auf der Galerie
etwas Rechts zu Gute thuend".
Auf die Studien, die Goethe und sein ihm in künst-
lerischen Dingen am nächsten stehender Freund Heinrich
Meyer 1794 in der Dresdner Galerie gemacht, fällt
durch neuere Veröffentlichungen ein überraschendes Licht.
Der siebenundvierzigste Band der Weimarischen Goethe-
Ausgabe bringt eine Reihe kurzer kritischer Anmerkungen
von Goethe zu dreihundertfünfundsiebzig Gemälden der
Dresdner Galerie. Goethe hatte sich von einem Schreiber
die deutsche Ausgabe des Galeriekatalogs von 1771 nicht
zwar vollständig, aber doch Nummer für Nummer, Name
für Name, Bild für Bild, in den Beschreibungen gekürzt, in
ein Oktavheft abschreiben, dann das Heft mit weißem Papier
durchschießen lassen und auf diese Blätter seine kritischen
Bemerkungen geschrieben, die in der That geeignet sind,
unsere ganze Aufmerksamkeir in Anspruch zu nehmen.
Der Herausgeber der Weimarischen Goethe-Ausgabe
hielt es für wahrscheinlich, daß der Dichter diese An-
merkungen erst 1813, während seines letzten Besuches in
Dresden, niedergeschrieben habe. Inzwischen aber hat
Ruland im Goethe-Jahrbuch 1897 nachgewiesen, daß sie
auf Goethes Dresdner Aufenthalt von 1794 zurückgehen.
Und Ruland hat noch mehr nachgewiesen, als das. Er
hat gezeigt, daß die Randbemerkungen ursprünglich in
knapperer Form von Heinrich Meyers Hand in das von
diesem benutzte Verzeichnis eingetragen worden, daß also
Heinrich Meyer, nicht Goethe als der eigentliche Verfasser
dieser Glossen erscheint. Indessen, im Kunsturteil sind
Goethe und Meyer in jenen Jahren kaum zu trennen.
Was Goethe meinte, war auch Meyers Ansicht; was
Meyer meinte, war auch Goethes Ansicht. Wenn auch
von Meyers Hand eingetragen, können die Bemerkungen,
wenigstens teilweise, recht wohl Goethes und Meyers
gemeinsamen Wanderungen durch die Galerie ihre Ent-
stehung verdanken. Jedenfalls hat Goethe sie sich durch
jene Reinschrift aneignen wollen; und thatsächlich hat er
sie sich keineswegs alle einfach angeeignet, sondern sie
vielfach erweitert und erläutert, so daß jene Handschrift
unter allen Umständen doch ein Stück von Goethes eigen-
stem Eigentum enthält. Leider nur ist er mit seiner
Arbeit nicht fertig geworden. Während Meyers Notizen
sich — freilich mit Uebergehung mancher minderwertiger
Bilder — über alle Nummern hinziehen, beschränkt Goethes
Reinschrift sich aus die ersten 500 Nummern, auf die
Bilder der äußeren Galerie, die eben die niederländischen
und deutschen Gemälde enthielt. Es ist fast wie eine Ironie
des Schicksals, daß wir auch jetzt wieder von Goethe selbst
— denn für Goethes Anschauungen müssen wir uns
doch an die in seinen „Werken" veröffentlichte Handschrift
halten — nichts über seine Beziehungen zu den italienischen
Bildern der Galerie erfahren, sondern abermals bei den
Niederländern und Deutschen festgehalten werden.
, Nebenbei bemerkt, wimmelt der Abdruck in der
Weimarer Goethe-Ausgabe von falschen Lesarten der
Künstlernamen. Der bekannte Tiermaler Fyt wird immer
Tyt, Falens wird Talens, Pourbus wird Lourbus ge-
genannt. Floris heißt überall Horis, Flemael tritt als
Jlemaels auf. Der Setzer wird die Handschrift des
Abschreibers falsch gelesen haben und den Herausgebern
werden die Namen nicht geläufig genug gewesen sein,
um die Fehler berichtigen zu können.
Die Meyer-Goetheschen Urteile beziehen sich teils
auf die Echtheit, teils auf den Kunstwert der Bilder der
Dresdner Galerie; und es läßt sich nicht leugnen, daß
sie sehr oft den Nagel auf den Kopf treffen, keines-
wegs selten aber auch gründlich daneben hauen. Meyer
und Goethe waren doch auch eben Kinder ihrer Zeit;
und ihre kunstgeschichtlichen Kenntnisse reichten keineswegs
in allen Stücken weiter als diejenigen der Verfasser der
amtlichen Dresdner Kataloge. In Bezug auf Dürer und
Holbein werden allerdings einige der unglaublichsten
Taufen des Katalogs in Zweifel gezogen, besonders wo
es sich um offenkundige Wiederholungen von fremder
Hand handelt; aber so grundverschiedene Werke, wie jene
große Anbetung der
Könige vom Meister
des Todes Mariä
und jener kleine
Flügelaltar Jan
van Eycks — hier
als Hauskapelle be-
zeichnet — werden
auch von Meyer und
Goethe in bestem
Glauben als Werke
Dürers entgegenge-
nommen, die große
Anbetung mit dem
Zusatze: „gut, aber
unangenehm"; und
von den falschen Hol-
beins des Katalogs
Werden die Meisten, „Bildnis eines Utrechter Kanonikus."
-l
Die Kunst für Alle XIV, I«. IS. Mai ISA?.