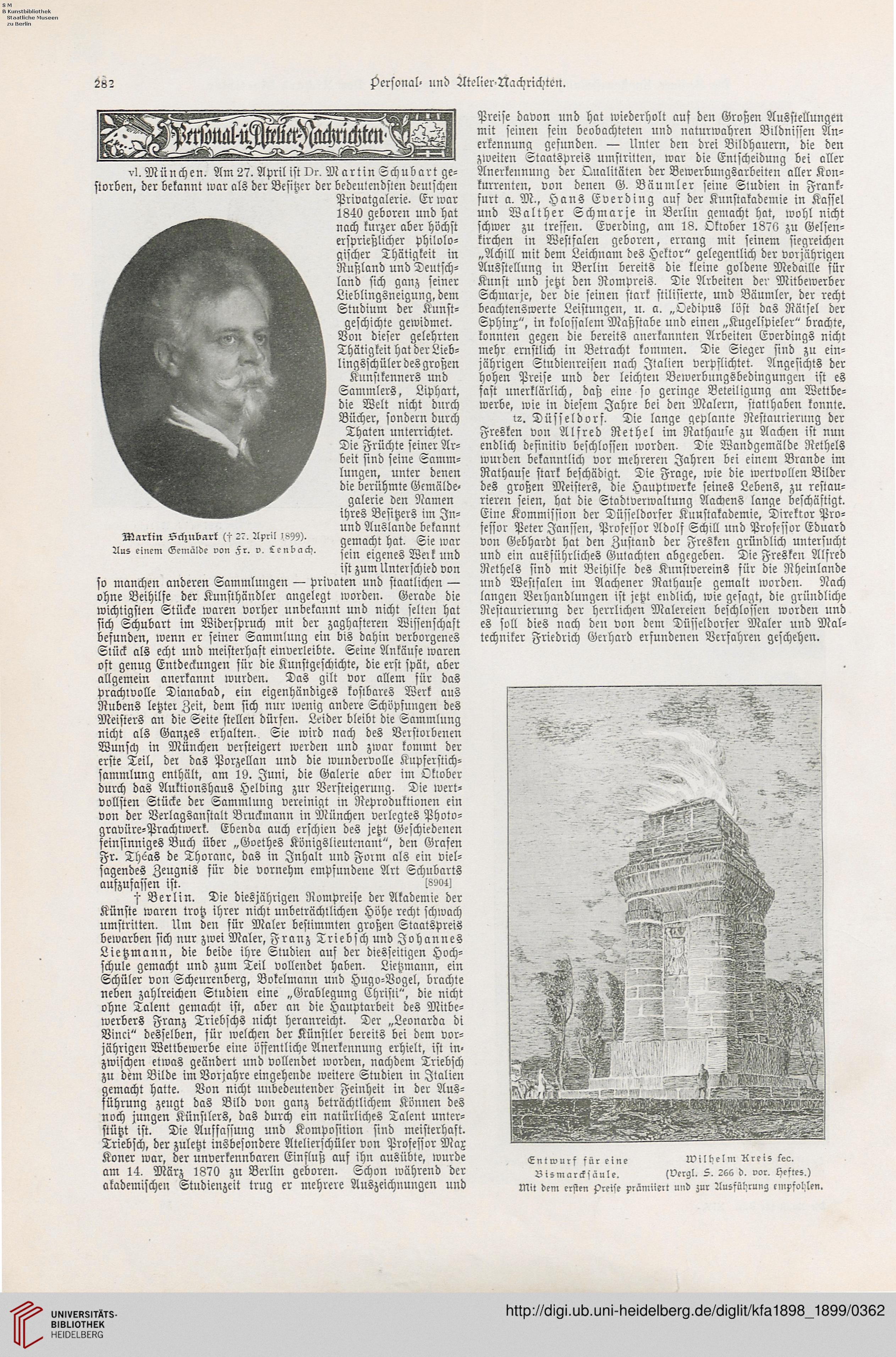L82
Personal- und Atelier-Nachrichten.
vl. München. Am 27. April ist vr. M artin Schubart ge-
storben, der bekannt war als der Besitzer der bedeutendsten deutschen
Privatgalerie. Er war
1840 geboren und hat
nach kurzer aber höchst
ersprießlicher philolo-
gischer Thätigkeit in
Rußland und Deutsch-
land sich ganz seiner
Lieblingsneigung, dem
Studium der Kunst-
geschichte gewidmet.
Von dieser gelehrten
Thätigkeit hat der Lieb-
lingsschüler des großen
Kunstkenners und
Sammlers, Liphart,
die Welt nicht durch
Bücher, sondern durch
Thaten unterrichtet.
Die Früchte seiner Ar-
beit sind seine Samm-
lungen, unter denen
die berühmte Gemälde-
galerie den Namen
ihres Besitzers im Jn-
und Auslande bekannt
Martin Schub-rk <f -7. AprU -SW. gemacht hat. Sie war
Aus einem Gemälde ->°n Zr. Lenbach. sein eigenes Welk und
ist zum Unterschied von
so manchen anderen Sammlungen — privaten und staatlichen —
ohne Beihilfe der Kunsthändler angelegt worden. Gerade die
wichtigsten Stücke waren vorher unbekannt und nicht selten hat
sich Schubart im Widerspruch mit der zaghafteren Wissenschaft
befunden, wenn er seiner Sammlung ein bis dahin verborgenes
Stück als echt und meisterhaft einverleibte. Seine Ankäufe waren
oft genug Entdeckungen für die Kunstgeschichte, die erst spät, aber
allgemein anerkannt wurden. Das gilt vor allem für das
prachtvolle Dianabad, ein eigenhändiges kostbares Werk aus
Rubens letzter Zeit, dem sich nur wenig andere Schöpfungen des
Meisters an die Seite stellen dürfen. Leider bleibt die Sammlung
nicht als Ganzes erhalten. Sie wird nach des Verstorbenen
Wunsch in München versteigert werden und zwar kommt der
erste Teil, der das Porzellan und die wundervolle Kupferstich-
sammlung enthält, am 19. Juni, die Galerie aber im Oktober
durch das Auktionshaus Helbing zur Versteigerung. Die wert-
vollsten Stücke der Sammlung vereinigt in Reproduktionen ein
von der Verlagsanstalt Bruckmann in München verlegtes Photo-
gravüre-Prachtwerk. Ebenda auch erschien des jetzt Geschiedenen
feinsinniges Buch über „Goethes Königslieutenant", den Grafen
Fr. Theas de Thoranc, das in Inhalt und Form als ein viel-
sagendes Zeugnis für die vornehm empfundene Art Schubarts
auszufassen ist. l^Zo«!
f Berlin. Die diesjährigen Rompreise der Akademie der
Künste waren trotz ihrer nicht unbeträchtlichen Höhe recht schwach
umstritten. Um den für Maler bestimmten großen Staatspreis
bewarben sich nur zwei Maler, Franz Triebsch und Johannes
Lietzmann, die beide ihre Studien auf der diesseitigen Hoch-
schule gemacht und zum Teil vollendet haben. Lietzmann, ein
Schüler von Scheurenberg, Bokelmann und Hugo-Vogel, brachte
neben zahlreichen Studien eine „Grablegung Christi", die nicht
ohne Talent gemacht ist, aber an die Hauptarbeit des Mitbe-
werbers Franz Triebschs nicht heranreicht. Der „Leonarda di
Vinci" desselben, für welchen der Künstler bereits bei dem vor-
jährigen Wettbewerbe eine öffentliche Anerkennung erhielt, ist in-
zwischen etwas geändert und vollendet worden, nachdem Triebsch
zu dem Bilde im Vorjahre eingehende weitere Studien in Italien
gemacht hatte. Von nicht unbedeutender Feinheit in der Aus-
führung zeugt das Bild von ganz beträchtlichem Können des
noch jungen Künstlers, das durch ein natürliches Talent unter-
stützt ist. Die Auffassung und Komposition sind meisterhaft.
Triebsch, der zuletzt insbesondere Atelierschüler von Professor Max
Koner war, der unverkennbaren Einfluß auf ihn ausübte, wurde
am 14. März 1870 zu Berlin geboren. Schon während der
akademischen Studienzeit trug er mehrere Auszeichnungen und
Preise davon und hat wiederholt aus den Großen Ausstellungen
mit seinen fein beobachteten und naturwahren Bildnissen An-
erkennung gefunden. — Unter den drei Bildhauern, die den
zweiten Staatspreis umstritten, war die Entscheidung bei aller
Anerkennung der Qualitäten der Bewerbungsarbeiten aller Kon-
kurrenten, von denen G. Bäumler seine Studien in Frank-
furt a. M., Hans Everding auf der Kunstakademie in Kassel
und Walther Schmarje in Berlin gemacht hat, wohl nicht
schwer zu treffen. Everding, am 18. Oktober 1876 zu Gelsen-
kirchen in Westfalen geboren, errang mit seinem siegreichen
„Achill mit dem Leichnam des Hektar" gelegentlich der vorjährigen
Ausstellung in Berlin bereits die kleine goldene Medaille für
Kunst und jetzt den Rompreis. Die Arbeiten der Mitbewerber
Schmarje, der die seinen stark stilisierte, und Bäumler, der recht
beachtenswerte Leistungen, u. a. „Oedipus löst das Rätsel der
Sphinx", in kolossalem Maßstabe und einen „Kugelspieler" brachte,
konnten gegen die bereits anerkannten Arbeiten Everdings nicht
mehr ernstlich in Betracht kommen. Die Sieger sind zu ein-
jährigen Studienreisen nach Italien verpflichtet. Angesichts der
hohen Preise und der leichten Bewerbungsbedingungen ist es
fast unerklärlich, daß eine so geringe Beteiligung am Wettbe-
werbe, wie in diesem Jahre bei den Malern, statthaben konnte.
tr. Düsseldorf. Die lange geplante Restaurierung der
Fresken von Alfred Rethel im Rathau-e zu Aachen ist nun
endlich definitiv beschlossen worden. Die Wandgemälde Rethels
wurden bekanntlich vor mehreren Jahren bei einem Brande im
Rathause stark beschädigt. Die Frage, wie die wertvollen Bilder
des großen Meisters, die Hauptwerke seines Lebens, zu restau-
rieren seien, hat die Stadtverwaltung Aachens lange beschäftigt.
Eine Kommission der Düsseldorfer Kunstakademie, Direktor Pro-
fessor Peter Janssen, Professor Adolf Schill und Professor Eduard
von Gebhardt hat den Zustand der Fresken gründlich untersucht
und ein ausführliches Gutachten abgegeben. Die Fresken Alfred
Rethels sind mit Beihilfe des Knnstvereins für die Rheinlande
und Westfalen im Aachener Rathause gemalt worden. Nach
langen Verhandlungen ist jetzt endlich, wie gesagt, die gründliche
Restaurierung der herrlichen Malereien beschlossen worden und
es soll dies nach den von dem Düsseldorfer Maler und Mal-
techniker Friedrich Gerhard erfundenen Verfahren geschehen.
Entwurf für eine UlithetmAreis lec.
Bismarcksäule. >vergl. S. 2SS d. vor. Heftes.)
Mit dem ersten Preise prämiiert und zur Ausführung empfohlen.
Personal- und Atelier-Nachrichten.
vl. München. Am 27. April ist vr. M artin Schubart ge-
storben, der bekannt war als der Besitzer der bedeutendsten deutschen
Privatgalerie. Er war
1840 geboren und hat
nach kurzer aber höchst
ersprießlicher philolo-
gischer Thätigkeit in
Rußland und Deutsch-
land sich ganz seiner
Lieblingsneigung, dem
Studium der Kunst-
geschichte gewidmet.
Von dieser gelehrten
Thätigkeit hat der Lieb-
lingsschüler des großen
Kunstkenners und
Sammlers, Liphart,
die Welt nicht durch
Bücher, sondern durch
Thaten unterrichtet.
Die Früchte seiner Ar-
beit sind seine Samm-
lungen, unter denen
die berühmte Gemälde-
galerie den Namen
ihres Besitzers im Jn-
und Auslande bekannt
Martin Schub-rk <f -7. AprU -SW. gemacht hat. Sie war
Aus einem Gemälde ->°n Zr. Lenbach. sein eigenes Welk und
ist zum Unterschied von
so manchen anderen Sammlungen — privaten und staatlichen —
ohne Beihilfe der Kunsthändler angelegt worden. Gerade die
wichtigsten Stücke waren vorher unbekannt und nicht selten hat
sich Schubart im Widerspruch mit der zaghafteren Wissenschaft
befunden, wenn er seiner Sammlung ein bis dahin verborgenes
Stück als echt und meisterhaft einverleibte. Seine Ankäufe waren
oft genug Entdeckungen für die Kunstgeschichte, die erst spät, aber
allgemein anerkannt wurden. Das gilt vor allem für das
prachtvolle Dianabad, ein eigenhändiges kostbares Werk aus
Rubens letzter Zeit, dem sich nur wenig andere Schöpfungen des
Meisters an die Seite stellen dürfen. Leider bleibt die Sammlung
nicht als Ganzes erhalten. Sie wird nach des Verstorbenen
Wunsch in München versteigert werden und zwar kommt der
erste Teil, der das Porzellan und die wundervolle Kupferstich-
sammlung enthält, am 19. Juni, die Galerie aber im Oktober
durch das Auktionshaus Helbing zur Versteigerung. Die wert-
vollsten Stücke der Sammlung vereinigt in Reproduktionen ein
von der Verlagsanstalt Bruckmann in München verlegtes Photo-
gravüre-Prachtwerk. Ebenda auch erschien des jetzt Geschiedenen
feinsinniges Buch über „Goethes Königslieutenant", den Grafen
Fr. Theas de Thoranc, das in Inhalt und Form als ein viel-
sagendes Zeugnis für die vornehm empfundene Art Schubarts
auszufassen ist. l^Zo«!
f Berlin. Die diesjährigen Rompreise der Akademie der
Künste waren trotz ihrer nicht unbeträchtlichen Höhe recht schwach
umstritten. Um den für Maler bestimmten großen Staatspreis
bewarben sich nur zwei Maler, Franz Triebsch und Johannes
Lietzmann, die beide ihre Studien auf der diesseitigen Hoch-
schule gemacht und zum Teil vollendet haben. Lietzmann, ein
Schüler von Scheurenberg, Bokelmann und Hugo-Vogel, brachte
neben zahlreichen Studien eine „Grablegung Christi", die nicht
ohne Talent gemacht ist, aber an die Hauptarbeit des Mitbe-
werbers Franz Triebschs nicht heranreicht. Der „Leonarda di
Vinci" desselben, für welchen der Künstler bereits bei dem vor-
jährigen Wettbewerbe eine öffentliche Anerkennung erhielt, ist in-
zwischen etwas geändert und vollendet worden, nachdem Triebsch
zu dem Bilde im Vorjahre eingehende weitere Studien in Italien
gemacht hatte. Von nicht unbedeutender Feinheit in der Aus-
führung zeugt das Bild von ganz beträchtlichem Können des
noch jungen Künstlers, das durch ein natürliches Talent unter-
stützt ist. Die Auffassung und Komposition sind meisterhaft.
Triebsch, der zuletzt insbesondere Atelierschüler von Professor Max
Koner war, der unverkennbaren Einfluß auf ihn ausübte, wurde
am 14. März 1870 zu Berlin geboren. Schon während der
akademischen Studienzeit trug er mehrere Auszeichnungen und
Preise davon und hat wiederholt aus den Großen Ausstellungen
mit seinen fein beobachteten und naturwahren Bildnissen An-
erkennung gefunden. — Unter den drei Bildhauern, die den
zweiten Staatspreis umstritten, war die Entscheidung bei aller
Anerkennung der Qualitäten der Bewerbungsarbeiten aller Kon-
kurrenten, von denen G. Bäumler seine Studien in Frank-
furt a. M., Hans Everding auf der Kunstakademie in Kassel
und Walther Schmarje in Berlin gemacht hat, wohl nicht
schwer zu treffen. Everding, am 18. Oktober 1876 zu Gelsen-
kirchen in Westfalen geboren, errang mit seinem siegreichen
„Achill mit dem Leichnam des Hektar" gelegentlich der vorjährigen
Ausstellung in Berlin bereits die kleine goldene Medaille für
Kunst und jetzt den Rompreis. Die Arbeiten der Mitbewerber
Schmarje, der die seinen stark stilisierte, und Bäumler, der recht
beachtenswerte Leistungen, u. a. „Oedipus löst das Rätsel der
Sphinx", in kolossalem Maßstabe und einen „Kugelspieler" brachte,
konnten gegen die bereits anerkannten Arbeiten Everdings nicht
mehr ernstlich in Betracht kommen. Die Sieger sind zu ein-
jährigen Studienreisen nach Italien verpflichtet. Angesichts der
hohen Preise und der leichten Bewerbungsbedingungen ist es
fast unerklärlich, daß eine so geringe Beteiligung am Wettbe-
werbe, wie in diesem Jahre bei den Malern, statthaben konnte.
tr. Düsseldorf. Die lange geplante Restaurierung der
Fresken von Alfred Rethel im Rathau-e zu Aachen ist nun
endlich definitiv beschlossen worden. Die Wandgemälde Rethels
wurden bekanntlich vor mehreren Jahren bei einem Brande im
Rathause stark beschädigt. Die Frage, wie die wertvollen Bilder
des großen Meisters, die Hauptwerke seines Lebens, zu restau-
rieren seien, hat die Stadtverwaltung Aachens lange beschäftigt.
Eine Kommission der Düsseldorfer Kunstakademie, Direktor Pro-
fessor Peter Janssen, Professor Adolf Schill und Professor Eduard
von Gebhardt hat den Zustand der Fresken gründlich untersucht
und ein ausführliches Gutachten abgegeben. Die Fresken Alfred
Rethels sind mit Beihilfe des Knnstvereins für die Rheinlande
und Westfalen im Aachener Rathause gemalt worden. Nach
langen Verhandlungen ist jetzt endlich, wie gesagt, die gründliche
Restaurierung der herrlichen Malereien beschlossen worden und
es soll dies nach den von dem Düsseldorfer Maler und Mal-
techniker Friedrich Gerhard erfundenen Verfahren geschehen.
Entwurf für eine UlithetmAreis lec.
Bismarcksäule. >vergl. S. 2SS d. vor. Heftes.)
Mit dem ersten Preise prämiiert und zur Ausführung empfohlen.