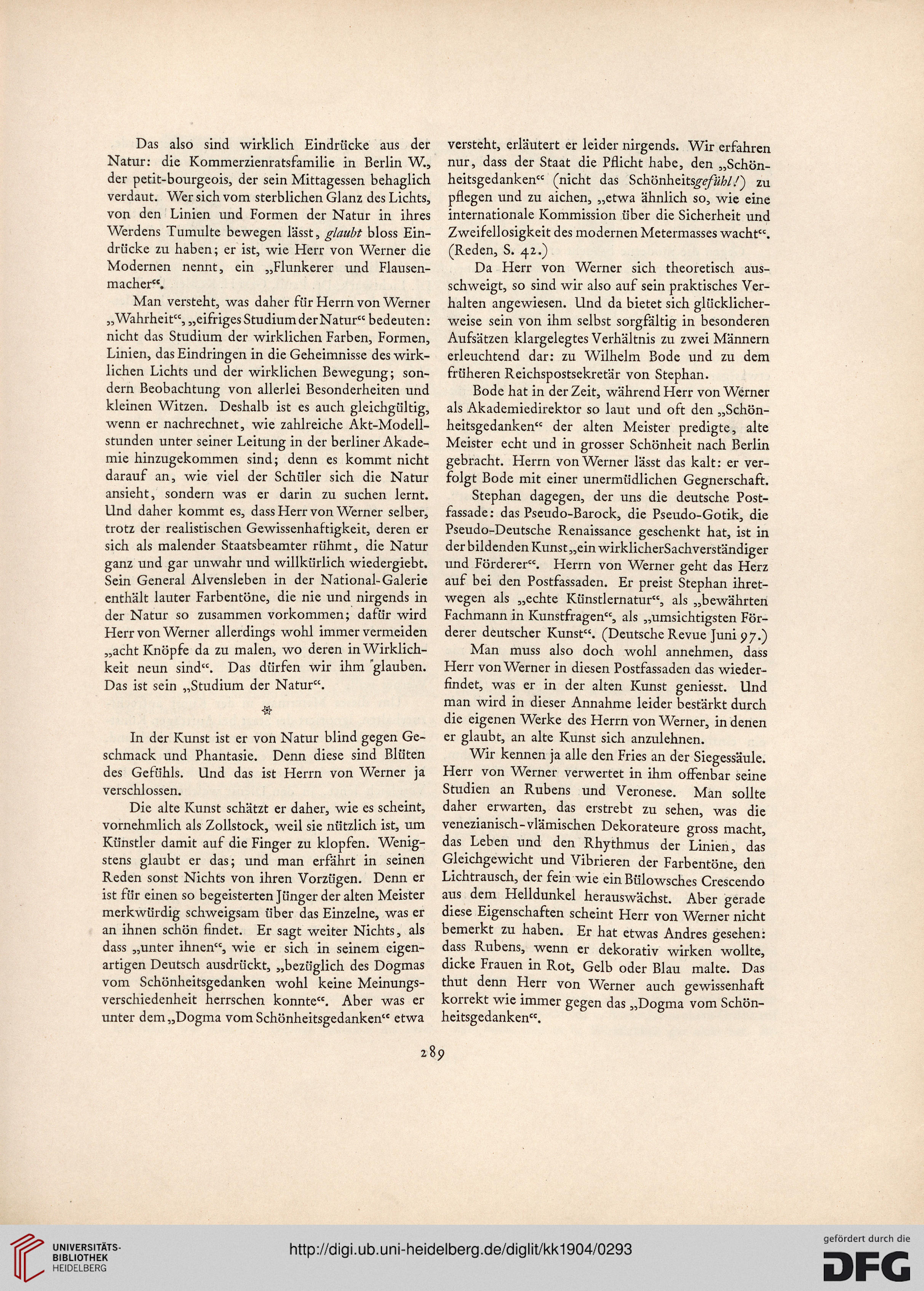Das also sind wirklich Eindrücke aus der
Natur: die Kommerzienratsfamilie in Berlin W,
der petit-bourgeois, der sein Mittagessen behaglich
verdaut. Wer sich vom sterblichen Glanz des Lichts,
von den Linien und Formen der Natur in ihres
Werdens Tumulte bewegen lässt, glaubt bloss Ein-
drücke zu haben; er ist, wie Herr von Werner die
Modernen nennt, ein „Flunkerer und Flausen-
macher".
Man versteht, was daher für Herrn von Werner
„Wahrheit", „eifriges Studium derNatur" bedeuten:
nicht das Studium der wirklichen Farben, Formen,
Linien, das Eindringen in die Geheimnisse des wirk-
lichen Lichts und der wirklichen Bewegung; son-
dern Beobachtung von allerlei Besonderheiten und
kleinen Witzen. Deshalb ist es auch gleichgültig,
wenn er nachrechnet, wie zahlreiche Akt-Modell-
stunden unter seiner Leitung in der berliner Akade-
mie hinzugekommen sind; denn es kommt nicht
darauf an, wie viel der Schüler sich die Natur
ansieht, sondern was er darin zu suchen lernt.
Und daher kommt es, dass Herr von Werner selber,
trotz der realistischen Gewissenhaftigkeit, deren er
sich als malender Staatsbeamter rühmt, die Natur
ganz und gar unwahr und willkürlich wiedergiebt.
Sein General Alvensleben in der National-Galerie
enthält lauter Farbentöne, die nie und nirgends in
der Natur so zusammen vorkommen; dafür wird
Herr von Werner allerdings wohl immer vermeiden
„acht Knöpfe da zu malen, wo deren in Wirklich-
keit neun sind". Das dürfen wir ihm glauben.
Das ist sein „Studium der Natur".
In der Kunst ist er von Natur blind gegen Ge-
schmack und Phantasie. Denn diese sind Blüten
des Gefühls. Und das ist Herrn von Werner ja
verschlossen.
Die alte Kunst schätzt er daher, wie es scheint,
vornehmlich als Zollstock, weil sie nützlich ist, um
Künstler damit auf die Finger zu klopfen. Wenig-
stens glaubt er das; und man erfährt in seinen
Reden sonst Nichts von ihren Vorzügen. Denn er
ist für einen so begeisterten Jünger der alten Meister
merkwürdig schweigsam über das Einzelne, was er
an ihnen schön findet. Er sagt weiter Nichts, als
dass „unter ihnen", wie er sich in seinem eigen-
artigen Deutsch ausdrückt, „bezüglich des Dogmas
vom Schönheitsgedanken wohl keine Meinungs-
verschiedenheit herrschen konnte". Aber was er
unter dem „Dogma vom Schönheitsgedanken" etwa
versteht, erläutert er leider nirgends. Wir erfahren
nur, dass der Staat die Pflicht habe, den „Schön-
heitsgedanken" (nicht das Schönheitsg?/«j&//) zu
pflegen und zu aichen, „etwa ähnlich so, wie eine
internationale Kommission über die Sicherheit und
Zweifellosigkeit des modernen Metermasses wacht".
(Reden, S. 42.)
Da Herr von Werner sich theoretisch aus-
schweigt, so sind wir also auf sein praktisches Ver-
halten angewiesen. Und da bietet sich glücklicher-
weise sein von ihm selbst sorgfältig in besonderen
Aufsätzen klargelegtes Verhältnis zu zwei Männern
erleuchtend dar: zu Wilhelm Bode und zu dem
früheren Reichspostsekretär von Stephan.
Bode hat in der Zeit, während Herr von Werner
als Akademiedirektor so laut und oft den „Schön-
heitsgedanken" der alten Meister predigte, alte
Meister echt und in grosser Schönheit nach Berlin
gebracht. Herrn von Werner lässt das kalt: er ver-
folgt Bode mit einer unermüdlichen Gegnerschaft.
Stephan dagegen, der uns die deutsche Post-
fassade: das Pseudo-Barock, die Pseudo-Gotik, die
Pseudo-Deutsche Renaissance geschenkt hat, ist in
der bildenden Kunst „ein wirklicherSachverständiger
und Förderer". Herrn von Werner geht das Herz
auf bei den Postfassaden. Er preist Stephan ihret-
wegen als „echte Künstlernatur", als „bewährten
Fachmann in Kunstfragen", als „umsichtigsten För-
derer deutscher Kunst". (Deutsche Revue Juni 97.)
Man muss also doch wohl annehmen, dass
Herr von Werner in diesen Postfassaden das wieder-
findet, was er in der alten Kunst geniesst. Und
man wird in dieser Annahme leider bestärkt durch
die eigenen Werke des Herrn von Werner, in denen
er glaubt, an alte Kunst sich anzulehnen.
Wir kennen ja alle den Fries an der Siegessäule.
Herr von Werner verwertet in ihm offenbar seine
Studien an Rubens und Veronese. Man sollte
daher erwarten, das erstrebt zu sehen, was die
venezianisch-vlämischen Dekorateure gross macht,
das Leben und den Rhythmus der Linien, das
Gleichgewicht und Vibrieren der Farbentöne, den
Lichtrausch, der fein wie ein Bülowsches Crescendo
aus dem Helldunkel herauswächst. Aber gerade
diese Eigenschaften scheint Herr von Werner nicht
bemerkt zu haben. Er hat etwas Andres gesehen:
dass Rubens, wenn er dekorativ wirken wollte,
dicke Frauen in Rot, Gelb oder Blau malte. Das
thut denn Herr von Werner auch gewissenhaft
korrekt wie immer gegen das „Dogma vom Schön-
heitsgedanken".
280
Natur: die Kommerzienratsfamilie in Berlin W,
der petit-bourgeois, der sein Mittagessen behaglich
verdaut. Wer sich vom sterblichen Glanz des Lichts,
von den Linien und Formen der Natur in ihres
Werdens Tumulte bewegen lässt, glaubt bloss Ein-
drücke zu haben; er ist, wie Herr von Werner die
Modernen nennt, ein „Flunkerer und Flausen-
macher".
Man versteht, was daher für Herrn von Werner
„Wahrheit", „eifriges Studium derNatur" bedeuten:
nicht das Studium der wirklichen Farben, Formen,
Linien, das Eindringen in die Geheimnisse des wirk-
lichen Lichts und der wirklichen Bewegung; son-
dern Beobachtung von allerlei Besonderheiten und
kleinen Witzen. Deshalb ist es auch gleichgültig,
wenn er nachrechnet, wie zahlreiche Akt-Modell-
stunden unter seiner Leitung in der berliner Akade-
mie hinzugekommen sind; denn es kommt nicht
darauf an, wie viel der Schüler sich die Natur
ansieht, sondern was er darin zu suchen lernt.
Und daher kommt es, dass Herr von Werner selber,
trotz der realistischen Gewissenhaftigkeit, deren er
sich als malender Staatsbeamter rühmt, die Natur
ganz und gar unwahr und willkürlich wiedergiebt.
Sein General Alvensleben in der National-Galerie
enthält lauter Farbentöne, die nie und nirgends in
der Natur so zusammen vorkommen; dafür wird
Herr von Werner allerdings wohl immer vermeiden
„acht Knöpfe da zu malen, wo deren in Wirklich-
keit neun sind". Das dürfen wir ihm glauben.
Das ist sein „Studium der Natur".
In der Kunst ist er von Natur blind gegen Ge-
schmack und Phantasie. Denn diese sind Blüten
des Gefühls. Und das ist Herrn von Werner ja
verschlossen.
Die alte Kunst schätzt er daher, wie es scheint,
vornehmlich als Zollstock, weil sie nützlich ist, um
Künstler damit auf die Finger zu klopfen. Wenig-
stens glaubt er das; und man erfährt in seinen
Reden sonst Nichts von ihren Vorzügen. Denn er
ist für einen so begeisterten Jünger der alten Meister
merkwürdig schweigsam über das Einzelne, was er
an ihnen schön findet. Er sagt weiter Nichts, als
dass „unter ihnen", wie er sich in seinem eigen-
artigen Deutsch ausdrückt, „bezüglich des Dogmas
vom Schönheitsgedanken wohl keine Meinungs-
verschiedenheit herrschen konnte". Aber was er
unter dem „Dogma vom Schönheitsgedanken" etwa
versteht, erläutert er leider nirgends. Wir erfahren
nur, dass der Staat die Pflicht habe, den „Schön-
heitsgedanken" (nicht das Schönheitsg?/«j&//) zu
pflegen und zu aichen, „etwa ähnlich so, wie eine
internationale Kommission über die Sicherheit und
Zweifellosigkeit des modernen Metermasses wacht".
(Reden, S. 42.)
Da Herr von Werner sich theoretisch aus-
schweigt, so sind wir also auf sein praktisches Ver-
halten angewiesen. Und da bietet sich glücklicher-
weise sein von ihm selbst sorgfältig in besonderen
Aufsätzen klargelegtes Verhältnis zu zwei Männern
erleuchtend dar: zu Wilhelm Bode und zu dem
früheren Reichspostsekretär von Stephan.
Bode hat in der Zeit, während Herr von Werner
als Akademiedirektor so laut und oft den „Schön-
heitsgedanken" der alten Meister predigte, alte
Meister echt und in grosser Schönheit nach Berlin
gebracht. Herrn von Werner lässt das kalt: er ver-
folgt Bode mit einer unermüdlichen Gegnerschaft.
Stephan dagegen, der uns die deutsche Post-
fassade: das Pseudo-Barock, die Pseudo-Gotik, die
Pseudo-Deutsche Renaissance geschenkt hat, ist in
der bildenden Kunst „ein wirklicherSachverständiger
und Förderer". Herrn von Werner geht das Herz
auf bei den Postfassaden. Er preist Stephan ihret-
wegen als „echte Künstlernatur", als „bewährten
Fachmann in Kunstfragen", als „umsichtigsten För-
derer deutscher Kunst". (Deutsche Revue Juni 97.)
Man muss also doch wohl annehmen, dass
Herr von Werner in diesen Postfassaden das wieder-
findet, was er in der alten Kunst geniesst. Und
man wird in dieser Annahme leider bestärkt durch
die eigenen Werke des Herrn von Werner, in denen
er glaubt, an alte Kunst sich anzulehnen.
Wir kennen ja alle den Fries an der Siegessäule.
Herr von Werner verwertet in ihm offenbar seine
Studien an Rubens und Veronese. Man sollte
daher erwarten, das erstrebt zu sehen, was die
venezianisch-vlämischen Dekorateure gross macht,
das Leben und den Rhythmus der Linien, das
Gleichgewicht und Vibrieren der Farbentöne, den
Lichtrausch, der fein wie ein Bülowsches Crescendo
aus dem Helldunkel herauswächst. Aber gerade
diese Eigenschaften scheint Herr von Werner nicht
bemerkt zu haben. Er hat etwas Andres gesehen:
dass Rubens, wenn er dekorativ wirken wollte,
dicke Frauen in Rot, Gelb oder Blau malte. Das
thut denn Herr von Werner auch gewissenhaft
korrekt wie immer gegen das „Dogma vom Schön-
heitsgedanken".
280