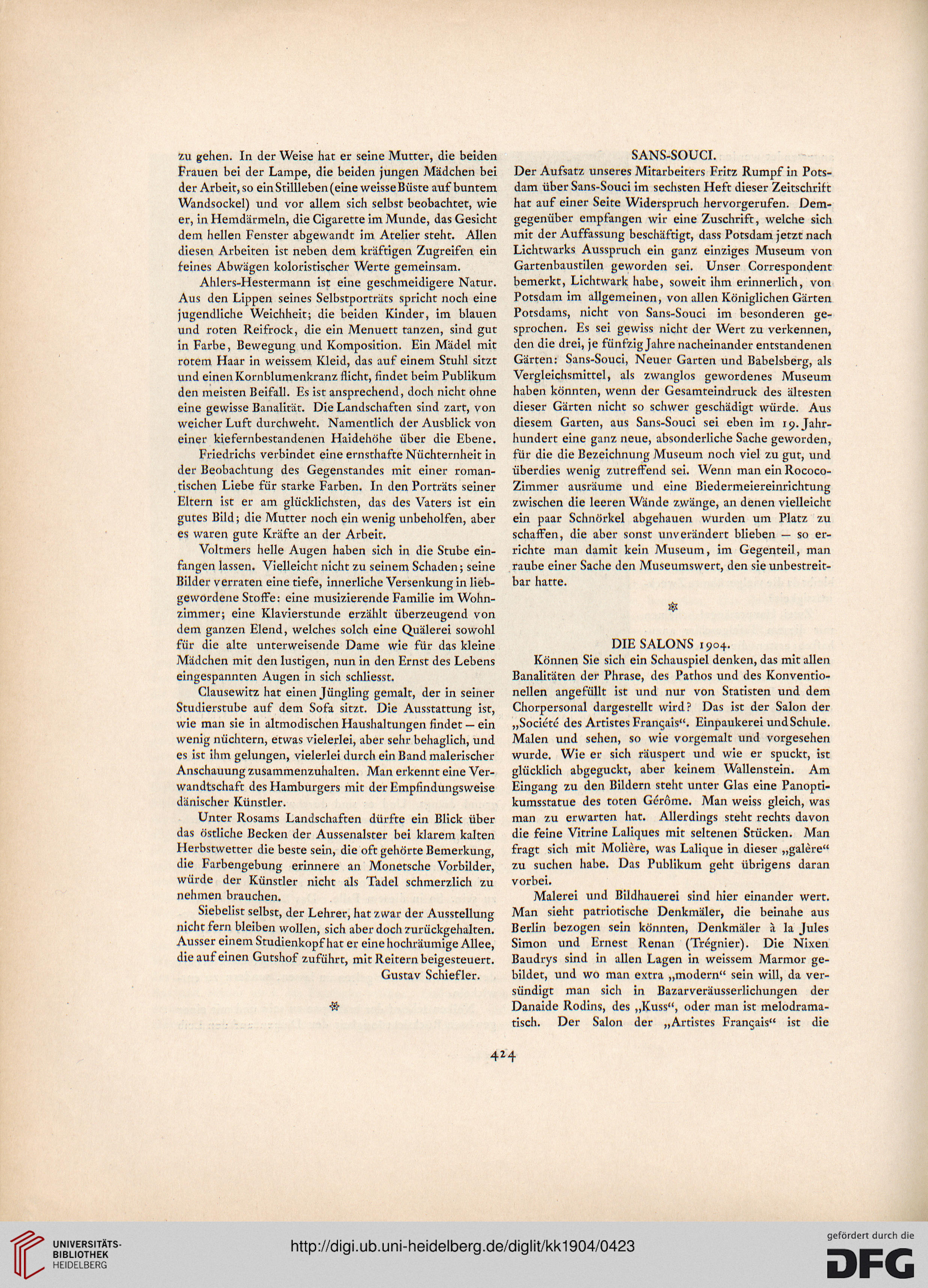zu gehen. In der Weise hat er seine Mutter, die beiden
Frauen bei der Lampe, die beiden jungen Mädchen bei
der Arbeit, so ein Stillleben (eine weisse Büste auf buntem
Wandsockel) und vor allem sich selbst beobachtet, wie
er, in Hemdärmeln, die Cigarette im Munde, das Gesicht
dem hellen Fenster abgewandt im Atelier steht. Allen
diesen Arbeiten ist neben dem kräftigen Zugreifen ein
feines Abwägen koloristischer Werte gemeinsam.
Ahlers-Hestermann ist eine geschmeidigere Natur.
Aus den Lippen seines Selbstporträts spricht noch eine
jugendliche Weichheit; die beiden Kinder, im blauen
und roten Reifrock, die ein Menuett tanzen, sind gut
in Farbe, Bewegung und Komposition. Ein Mädel mit
rotem Haar in weissem Kleid, das auf einem Stuhl sitzt
und einen Kornblumenkranz flicht, findet beim Publikum
den meisten Beifall. Es ist ansprechend, doch nicht ohne
eine gewisse Banalität. Die Landschaften sind zart, von
weicher Luft durchweht. Namentlich der Ausblick von
einer kiefernbestandenen Haidehöhe über die Ebene.
Friedrichs verbindet eine ernsthafte Nüchternheit in
der Beobachtung des Gegenstandes mit einer roman-
, tischen Liebe für starke Farben. In den Porträts seiner
Eltern ist er am glücklichsten, das des Vaters ist ein
gutes Bild; die Mutter noch ein wenig unbeholfen, aber
es waren gute Kräfte an der Arbeit.
Voltmers helle Augen haben sich in die Stube ein-
fangen lassen. Vielleicht nicht zu seinem Schaden; seine
Bilder verraten eine tiefe, innerliche Versenkung in lieb-
gewordene Stoffe: eine musizierende Familie im Wohn-
zimmer; eine Klavierstunde erzählt überzeugend von
dem ganzen Elend, welches solch eine Quälerei sowohl
für die alte unterweisende Dame wie für das kleine
Mädchen mit den lustigen, nun in den Ernst des Lebens
eingespannten Augen in sich schliesst.
Clausewitz hat einen Jüngling gemalt, der in seiner
Studierstube auf dem Sofa sitzt. Die Ausstattung ist,
wie man sie in altmodischen Haushaltungen findet — ein
wenig nüchtern, etwas vielerlei, aber sehr behaglich, und
es ist ihm gelungen, vielerlei durch ein Band malerischer
Anschauung zusammenzuhalten. Man erkennt eine Ver-
wandtschaft des Hamburgers mit der Empfindungsweise
dänischer Künstler.
Unter Rosams Landschaften dürfte ein Blick über
das östliche Becken der Aussenalster bei klarem kalten
Herbstwetter die beste sein, die oft gehörte Bemerkung,
die Farbengebung erinnere an Monetsche Vorbilder,
würde der Künstler nicht als Tadel schmerzlich zu
nehmen brauchen.
Siebelist selbst, der Lehrer, hat zwar der Ausstellung
nicht fern bleiben wollen, sich aber doch zurückgehalten.
Ausser einem Studienkopf hat er eine hochräumige Allee,
die auf einen Gutshof zuführt, mit Reitern beigesteuert.
Gustav Schiefler.
SANS-SOUCI.
Der Aufsatz unseres Mitarbeiters Fritz Rumpf in Pots-
dam über Sans-Souci im sechsten Heft dieser Zeitschrift
hat auf einer Seite Widerspruch hervorgerufen. Dem-
gegenüber empfangen wir eine Zuschrift, welche sich
mit der Auffassung beschäftigt, dass Potsdam jetzt nach
Lichtwarks Ausspruch ein ganz einziges Museum von
Gartenbaustilen geworden sei. Unser Correspondent
bemerkt, Lichtwark habe, soweit ihm erinnerlich, von
Potsdam im allgemeinen, von allen Königlichen Gärten
Potsdams, nicht von Sans-Souci im besonderen ge-
sprochen. Es sei gewiss nicht der Wert zu verkennen,
den die drei, je fünfzig Jahre nacheinander entstandenen
Gärten: Sans-Souci, Neuer Garten und Babelsberg, als
Vergleichsmittel, als zwanglos gewordenes Museum
haben könnten, wenn der Gesamteindruck des ältesten
dieser Gärten nicht so schwer geschädigt würde. Aus
diesem Garten, aus Sans-Souci sei eben im 19. Jahr-
hundert eine ganz neue, absonderliche Sache geworden,
für die die Bezeichnung Museum noch viel zu gut, und
überdies wenig zutreffend sei. Wenn man ein Rococo-
Zimmer ausräume und eine Biedermeiereinrichtung
zwischen die leeren Wände zwänge, an denen vielleicht
ein paar Schnörkel abgehauen wurden um Platz zu
schaffen, die aber sonst unverändert blieben — so er-
richte man damit kein Museum, im Gegenteil, man
raube einer Sache den Museumswert, den sie unbestreit-
bar hatte.
DIE SALONS 1904.
Können Sie sich ein Schauspiel denken, das mit allen
Banalitäten der Phrase, des Pathos und des Konventio-
nellen angefüllt ist und nur von Statisten und dem
Chorpersonal dargestellt wird? Das ist der Salon der
„Societe des Artistes Frangais". Einpaukerei und Schule.
Malen und sehen, so wie vorgemalt und vorgesehen
wurde. Wie er sich räuspert und wie er spuckt, ist
glücklich abgeguckt, aber keinem Wallenstein. Am
Eingang zu den Bildern steht unter Glas eine Panopti-
kumsstatue des toten Gerome. Man weiss gleich, was
man zu erwarten hat. Allerdings steht rechts davon
die feine Vitrine Laliques mit seltenen Stücken. Man
fragt sich mit Moliere, was Lalique in dieser „galere"
zu suchen habe. Das Publikum geht übrigens daran
vorbei.
Malerei und Bildhauerei sind hier einander wert.
Man sieht patriotische Denkmäler, die beinahe aus
Berlin bezogen sein könnten, Denkmäler ä la Jules
Simon und Ernest Renan (Tregnier). Die Nixen
Baudrys sind in allen Lagen in weissem Marmor ge-
bildet, und wo man extra „modern" sein will, da ver-
sündigt man sich in Bazarveräusserlichungen der
Danaide Rodins, des „Kuss", oder man ist melodrama-
tisch. Der Salon der „Artistes Frangais" ist die
4*4
Frauen bei der Lampe, die beiden jungen Mädchen bei
der Arbeit, so ein Stillleben (eine weisse Büste auf buntem
Wandsockel) und vor allem sich selbst beobachtet, wie
er, in Hemdärmeln, die Cigarette im Munde, das Gesicht
dem hellen Fenster abgewandt im Atelier steht. Allen
diesen Arbeiten ist neben dem kräftigen Zugreifen ein
feines Abwägen koloristischer Werte gemeinsam.
Ahlers-Hestermann ist eine geschmeidigere Natur.
Aus den Lippen seines Selbstporträts spricht noch eine
jugendliche Weichheit; die beiden Kinder, im blauen
und roten Reifrock, die ein Menuett tanzen, sind gut
in Farbe, Bewegung und Komposition. Ein Mädel mit
rotem Haar in weissem Kleid, das auf einem Stuhl sitzt
und einen Kornblumenkranz flicht, findet beim Publikum
den meisten Beifall. Es ist ansprechend, doch nicht ohne
eine gewisse Banalität. Die Landschaften sind zart, von
weicher Luft durchweht. Namentlich der Ausblick von
einer kiefernbestandenen Haidehöhe über die Ebene.
Friedrichs verbindet eine ernsthafte Nüchternheit in
der Beobachtung des Gegenstandes mit einer roman-
, tischen Liebe für starke Farben. In den Porträts seiner
Eltern ist er am glücklichsten, das des Vaters ist ein
gutes Bild; die Mutter noch ein wenig unbeholfen, aber
es waren gute Kräfte an der Arbeit.
Voltmers helle Augen haben sich in die Stube ein-
fangen lassen. Vielleicht nicht zu seinem Schaden; seine
Bilder verraten eine tiefe, innerliche Versenkung in lieb-
gewordene Stoffe: eine musizierende Familie im Wohn-
zimmer; eine Klavierstunde erzählt überzeugend von
dem ganzen Elend, welches solch eine Quälerei sowohl
für die alte unterweisende Dame wie für das kleine
Mädchen mit den lustigen, nun in den Ernst des Lebens
eingespannten Augen in sich schliesst.
Clausewitz hat einen Jüngling gemalt, der in seiner
Studierstube auf dem Sofa sitzt. Die Ausstattung ist,
wie man sie in altmodischen Haushaltungen findet — ein
wenig nüchtern, etwas vielerlei, aber sehr behaglich, und
es ist ihm gelungen, vielerlei durch ein Band malerischer
Anschauung zusammenzuhalten. Man erkennt eine Ver-
wandtschaft des Hamburgers mit der Empfindungsweise
dänischer Künstler.
Unter Rosams Landschaften dürfte ein Blick über
das östliche Becken der Aussenalster bei klarem kalten
Herbstwetter die beste sein, die oft gehörte Bemerkung,
die Farbengebung erinnere an Monetsche Vorbilder,
würde der Künstler nicht als Tadel schmerzlich zu
nehmen brauchen.
Siebelist selbst, der Lehrer, hat zwar der Ausstellung
nicht fern bleiben wollen, sich aber doch zurückgehalten.
Ausser einem Studienkopf hat er eine hochräumige Allee,
die auf einen Gutshof zuführt, mit Reitern beigesteuert.
Gustav Schiefler.
SANS-SOUCI.
Der Aufsatz unseres Mitarbeiters Fritz Rumpf in Pots-
dam über Sans-Souci im sechsten Heft dieser Zeitschrift
hat auf einer Seite Widerspruch hervorgerufen. Dem-
gegenüber empfangen wir eine Zuschrift, welche sich
mit der Auffassung beschäftigt, dass Potsdam jetzt nach
Lichtwarks Ausspruch ein ganz einziges Museum von
Gartenbaustilen geworden sei. Unser Correspondent
bemerkt, Lichtwark habe, soweit ihm erinnerlich, von
Potsdam im allgemeinen, von allen Königlichen Gärten
Potsdams, nicht von Sans-Souci im besonderen ge-
sprochen. Es sei gewiss nicht der Wert zu verkennen,
den die drei, je fünfzig Jahre nacheinander entstandenen
Gärten: Sans-Souci, Neuer Garten und Babelsberg, als
Vergleichsmittel, als zwanglos gewordenes Museum
haben könnten, wenn der Gesamteindruck des ältesten
dieser Gärten nicht so schwer geschädigt würde. Aus
diesem Garten, aus Sans-Souci sei eben im 19. Jahr-
hundert eine ganz neue, absonderliche Sache geworden,
für die die Bezeichnung Museum noch viel zu gut, und
überdies wenig zutreffend sei. Wenn man ein Rococo-
Zimmer ausräume und eine Biedermeiereinrichtung
zwischen die leeren Wände zwänge, an denen vielleicht
ein paar Schnörkel abgehauen wurden um Platz zu
schaffen, die aber sonst unverändert blieben — so er-
richte man damit kein Museum, im Gegenteil, man
raube einer Sache den Museumswert, den sie unbestreit-
bar hatte.
DIE SALONS 1904.
Können Sie sich ein Schauspiel denken, das mit allen
Banalitäten der Phrase, des Pathos und des Konventio-
nellen angefüllt ist und nur von Statisten und dem
Chorpersonal dargestellt wird? Das ist der Salon der
„Societe des Artistes Frangais". Einpaukerei und Schule.
Malen und sehen, so wie vorgemalt und vorgesehen
wurde. Wie er sich räuspert und wie er spuckt, ist
glücklich abgeguckt, aber keinem Wallenstein. Am
Eingang zu den Bildern steht unter Glas eine Panopti-
kumsstatue des toten Gerome. Man weiss gleich, was
man zu erwarten hat. Allerdings steht rechts davon
die feine Vitrine Laliques mit seltenen Stücken. Man
fragt sich mit Moliere, was Lalique in dieser „galere"
zu suchen habe. Das Publikum geht übrigens daran
vorbei.
Malerei und Bildhauerei sind hier einander wert.
Man sieht patriotische Denkmäler, die beinahe aus
Berlin bezogen sein könnten, Denkmäler ä la Jules
Simon und Ernest Renan (Tregnier). Die Nixen
Baudrys sind in allen Lagen in weissem Marmor ge-
bildet, und wo man extra „modern" sein will, da ver-
sündigt man sich in Bazarveräusserlichungen der
Danaide Rodins, des „Kuss", oder man ist melodrama-
tisch. Der Salon der „Artistes Frangais" ist die
4*4