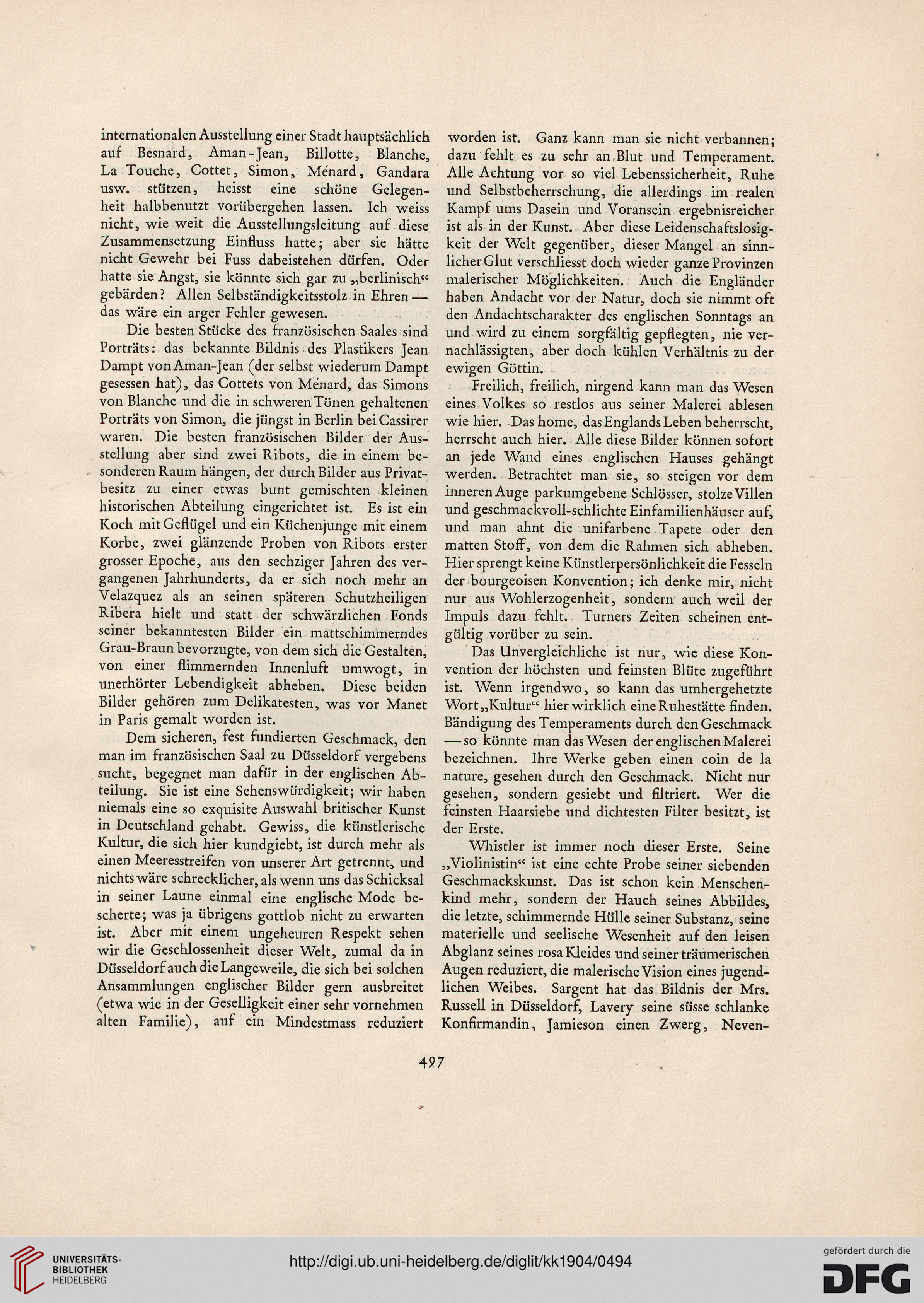internationalen Ausstellung einer Stadt hauptsächlich
auf Besnard, Aman-Jean, Billotte, Blanche,
La Touche, Cottet, Simon, Me'nard, Gandara
usw. stützen, heisst eine schöne Gelegen-
heit halbbenutzt vorübergehen lassen. Ich weiss
nicht, wie weit die Ausstellungsleitung auf diese
Zusammensetzung Einfluss hatte; aber sie hätte
nicht Gewehr bei Fuss dabeistehen dürfen. Oder
hatte sie Angst, sie könnte sich gar zu „berlinisch"
gebärden? Allen Selbständigkeitsstolz in Ehren —
das wäre ein arger Fehler gewesen.
Die besten Stücke des französischen Saales sind
Porträts: das bekannte Bildnis des Plastikers Jean
Dampt von Aman-Jean (der selbst wiederum Dampt
gesessen hat), das Cottets von Me'nard, das Simons
von Blanche und die in schweren Tönen gehaltenen
Porträts von Simon, die jüngst in Berlin beiCassirer
waren. Die besten französischen Bilder der Aus-
stellung aber sind zwei Ribots, die in einem be-
sonderen Raum hängen, der durch Bilder aus Privat-
besitz zu einer etwas bunt gemischten kleinen
historischen Abteilung eingerichtet ist. Es ist ein
Koch mit Geflügel und ein Küchenjunge mit einem
Korbe, zwei glänzende Proben von Ribots erster
grosser Epoche, aus den sechziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts, da er sich noch mehr an
Velazquez als an seinen späteren Schutzheiligen
Ribera hielt und statt der schwärzlichen Fonds
seiner bekanntesten Bilder ein mattschimmerndes
Grau-Braun bevorzugte, von dem sich die Gestalten,
von einer flimmernden Innenluft umwogt, in
unerhörter Lebendigkeit abheben. Diese beiden
Bilder gehören zum Delikatesten, was vor Manet
in Paris gemalt worden ist.
Dem sicheren, fest fundierten Geschmack, den
man im französischen Saal zu Düsseldorf vergebens
sucht, begegnet man dafür in der englischen Ab-
teilung. Sie ist eine Sehenswürdigkeit; wir haben
niemals eine so exquisite Auswahl britischer Kunst
in Deutschland gehabt. Gewiss, die künstlerische
Kultur, die sich hier kundgiebt, ist durch mehr als
einen Meeresstreifen von unserer Art getrennt, und
nichts wäre schrecklicher, als wenn uns das Schicksal
in seiner Laune einmal eine englische Mode be-
scherte; was ja übrigens gottlob nicht zu erwarten
ist. Aber mit einem ungeheuren Respekt sehen
wir die Geschlossenheit dieser Welt, zumal da in
Düsseldorf auch die Langeweile, die sich bei solchen
Ansammlungen englischer Bilder gern ausbreitet
(etwa wie in der Geselligkeit einer sehr vornehmen
alten Familie), auf ein Mindestmass reduziert
worden ist. Ganz kann man sie nicht verbannen;
dazu fehlt es zu sehr an Blut und Temperament.
Alle Achtung vor so viel Lebenssicherheit, Ruhe
und Selbstbeherrschung, die allerdings im realen
Kampf ums Dasein und Voransein ergebnisreicher
ist als in der Kunst. Aber diese Leidenschaftslosig-
keit der Welt gegenüber, dieser Mangel an sinn-
licher Glut verschliesst doch wieder ganze Provinzen
malerischer Möglichkeiten. Auch die Engländer
haben Andacht vor der Natur, doch sie nimmt oft
den Andachtscharakter des englischen Sonntags an
und wird zu einem sorgfältig gepflegten, nie ver-
nachlässigten, aber doch kühlen Verhältnis zu der
ewigen Göttin.
Freilich, freilich, nirgend kann man das Wesen
eines Volkes so restlos aus seiner Malerei ablesen
wie hier. Dashome, das Englands Leben beherrscht,
herrscht auch hier. Alle diese Bilder können sofort
an jede Wand eines englischen Hauses gehängt
werden. Betrachtet man sie, so steigen vor dem
inneren Auge parkumgebene Schlösser, stolze Villen
und geschmackvoll-schlichte Einfamilienhäuser auf,
und man ahnt die unifarbene Tapete oder den
matten Stoff, von dem die Rahmen sich abheben.
Hier sprengt keine Künstlerpersönlichkeit die Fesseln
der bourgeoisen Konvention; ich denke mir, nicht
nur aus Wohlerzogenheit, sondern auch weil der
Impuls dazu fehlt. Turners Zeiten scheinen ent-
gültig vorüber zu sein.
Das Unvergleichliche ist nur, wie diese Kon-
vention der höchsten und feinsten Blüte zugeführt
ist. Wenn irgendwo, so kann das umhergehetzte
Wort„Kultur" hier wirklich eine Ruhestätte finden.
Bändigung des Temperaments durch den Geschmack
— so könnte man das Wesen der englischen Malerei
bezeichnen. Ihre Werke geben einen coin de la
nature, gesehen durch den Geschmack. Nicht nur
gesehen, sondern gesiebt und filtriert. Wer die
feinsten Haarsiebe und dichtesten Filter besitzt, ist
der Erste.
Whistler ist immer noch dieser Erste. Seine
„Violinistin" ist eine echte Probe seiner siebenden
Geschmackskunst. Das ist schon kein Menschen-
kind mehr, sondern der Hauch seines Abbildes,
die letzte, schimmernde Hülle seiner Substanz, seine
materielle und seelische Wesenheit auf den leisen
Abglanz seines rosa Kleides und seiner träumerischen
Augen reduziert, die malerische Vision eines jugend-
lichen Weibes. Sargent hat das Bildnis der Mrs.
Russell in Düsseldorf, Lavery seine süsse schlanke
Konfirmandin, Jamieson einen Zwerg, Neven-
497
auf Besnard, Aman-Jean, Billotte, Blanche,
La Touche, Cottet, Simon, Me'nard, Gandara
usw. stützen, heisst eine schöne Gelegen-
heit halbbenutzt vorübergehen lassen. Ich weiss
nicht, wie weit die Ausstellungsleitung auf diese
Zusammensetzung Einfluss hatte; aber sie hätte
nicht Gewehr bei Fuss dabeistehen dürfen. Oder
hatte sie Angst, sie könnte sich gar zu „berlinisch"
gebärden? Allen Selbständigkeitsstolz in Ehren —
das wäre ein arger Fehler gewesen.
Die besten Stücke des französischen Saales sind
Porträts: das bekannte Bildnis des Plastikers Jean
Dampt von Aman-Jean (der selbst wiederum Dampt
gesessen hat), das Cottets von Me'nard, das Simons
von Blanche und die in schweren Tönen gehaltenen
Porträts von Simon, die jüngst in Berlin beiCassirer
waren. Die besten französischen Bilder der Aus-
stellung aber sind zwei Ribots, die in einem be-
sonderen Raum hängen, der durch Bilder aus Privat-
besitz zu einer etwas bunt gemischten kleinen
historischen Abteilung eingerichtet ist. Es ist ein
Koch mit Geflügel und ein Küchenjunge mit einem
Korbe, zwei glänzende Proben von Ribots erster
grosser Epoche, aus den sechziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts, da er sich noch mehr an
Velazquez als an seinen späteren Schutzheiligen
Ribera hielt und statt der schwärzlichen Fonds
seiner bekanntesten Bilder ein mattschimmerndes
Grau-Braun bevorzugte, von dem sich die Gestalten,
von einer flimmernden Innenluft umwogt, in
unerhörter Lebendigkeit abheben. Diese beiden
Bilder gehören zum Delikatesten, was vor Manet
in Paris gemalt worden ist.
Dem sicheren, fest fundierten Geschmack, den
man im französischen Saal zu Düsseldorf vergebens
sucht, begegnet man dafür in der englischen Ab-
teilung. Sie ist eine Sehenswürdigkeit; wir haben
niemals eine so exquisite Auswahl britischer Kunst
in Deutschland gehabt. Gewiss, die künstlerische
Kultur, die sich hier kundgiebt, ist durch mehr als
einen Meeresstreifen von unserer Art getrennt, und
nichts wäre schrecklicher, als wenn uns das Schicksal
in seiner Laune einmal eine englische Mode be-
scherte; was ja übrigens gottlob nicht zu erwarten
ist. Aber mit einem ungeheuren Respekt sehen
wir die Geschlossenheit dieser Welt, zumal da in
Düsseldorf auch die Langeweile, die sich bei solchen
Ansammlungen englischer Bilder gern ausbreitet
(etwa wie in der Geselligkeit einer sehr vornehmen
alten Familie), auf ein Mindestmass reduziert
worden ist. Ganz kann man sie nicht verbannen;
dazu fehlt es zu sehr an Blut und Temperament.
Alle Achtung vor so viel Lebenssicherheit, Ruhe
und Selbstbeherrschung, die allerdings im realen
Kampf ums Dasein und Voransein ergebnisreicher
ist als in der Kunst. Aber diese Leidenschaftslosig-
keit der Welt gegenüber, dieser Mangel an sinn-
licher Glut verschliesst doch wieder ganze Provinzen
malerischer Möglichkeiten. Auch die Engländer
haben Andacht vor der Natur, doch sie nimmt oft
den Andachtscharakter des englischen Sonntags an
und wird zu einem sorgfältig gepflegten, nie ver-
nachlässigten, aber doch kühlen Verhältnis zu der
ewigen Göttin.
Freilich, freilich, nirgend kann man das Wesen
eines Volkes so restlos aus seiner Malerei ablesen
wie hier. Dashome, das Englands Leben beherrscht,
herrscht auch hier. Alle diese Bilder können sofort
an jede Wand eines englischen Hauses gehängt
werden. Betrachtet man sie, so steigen vor dem
inneren Auge parkumgebene Schlösser, stolze Villen
und geschmackvoll-schlichte Einfamilienhäuser auf,
und man ahnt die unifarbene Tapete oder den
matten Stoff, von dem die Rahmen sich abheben.
Hier sprengt keine Künstlerpersönlichkeit die Fesseln
der bourgeoisen Konvention; ich denke mir, nicht
nur aus Wohlerzogenheit, sondern auch weil der
Impuls dazu fehlt. Turners Zeiten scheinen ent-
gültig vorüber zu sein.
Das Unvergleichliche ist nur, wie diese Kon-
vention der höchsten und feinsten Blüte zugeführt
ist. Wenn irgendwo, so kann das umhergehetzte
Wort„Kultur" hier wirklich eine Ruhestätte finden.
Bändigung des Temperaments durch den Geschmack
— so könnte man das Wesen der englischen Malerei
bezeichnen. Ihre Werke geben einen coin de la
nature, gesehen durch den Geschmack. Nicht nur
gesehen, sondern gesiebt und filtriert. Wer die
feinsten Haarsiebe und dichtesten Filter besitzt, ist
der Erste.
Whistler ist immer noch dieser Erste. Seine
„Violinistin" ist eine echte Probe seiner siebenden
Geschmackskunst. Das ist schon kein Menschen-
kind mehr, sondern der Hauch seines Abbildes,
die letzte, schimmernde Hülle seiner Substanz, seine
materielle und seelische Wesenheit auf den leisen
Abglanz seines rosa Kleides und seiner träumerischen
Augen reduziert, die malerische Vision eines jugend-
lichen Weibes. Sargent hat das Bildnis der Mrs.
Russell in Düsseldorf, Lavery seine süsse schlanke
Konfirmandin, Jamieson einen Zwerg, Neven-
497