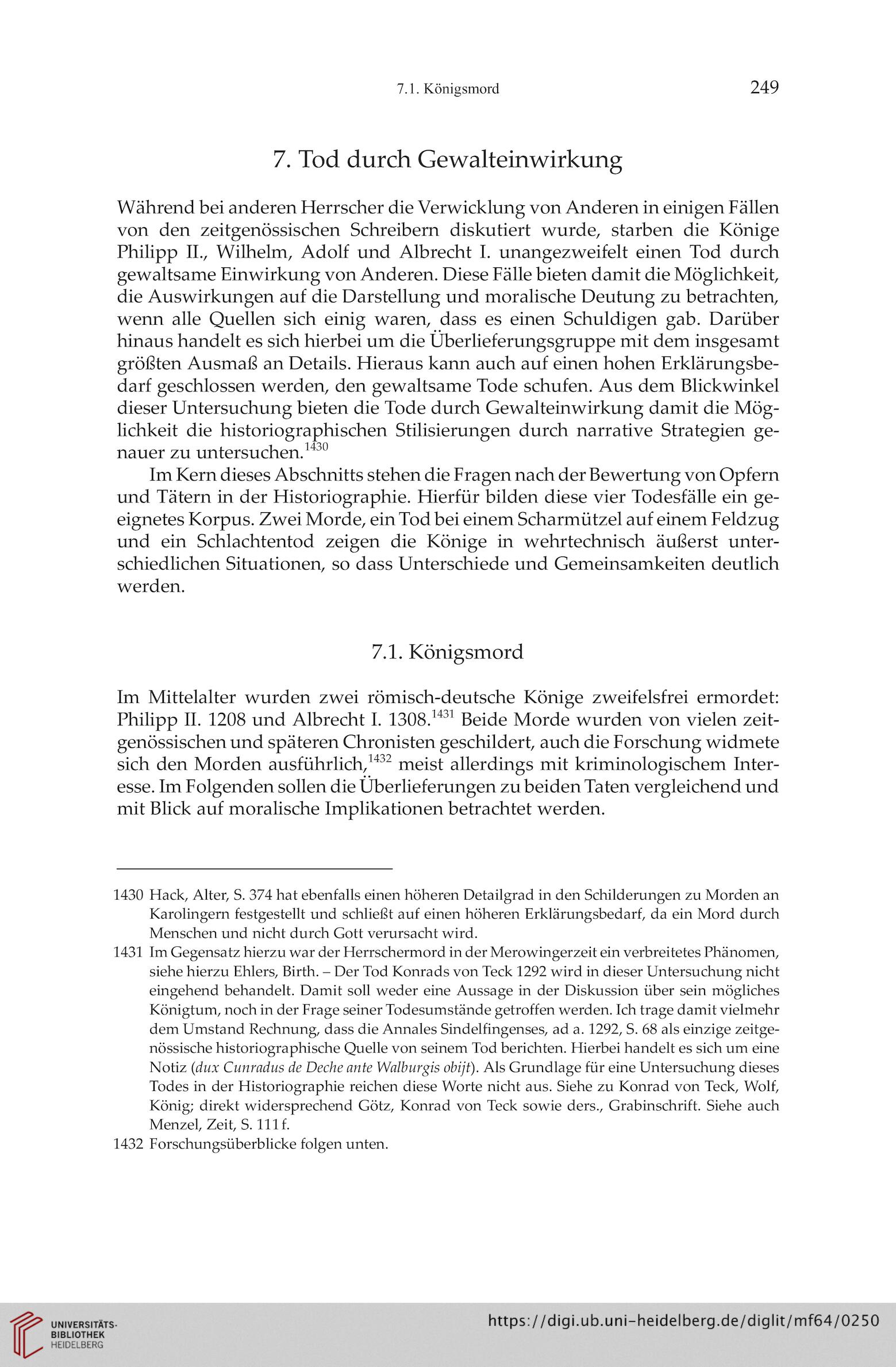7.1. Königsmord
249
7. Tod durch Gewalteinwirkung
Während bei anderen Herrscher die Verwicklung von Anderen in einigen Fällen
von den zeitgenössischen Schreibern diskutiert wurde, starben die Könige
Philipp II., Wilhelm, Adolf und Albrecht I. unangezweifelt einen Tod durch
gewaltsame Einwirkung von Anderen. Diese Fälle bieten damit die Möglichkeit,
die Auswirkungen auf die Darstellung und moralische Deutung zu betrachten,
wenn alle Quellen sich einig waren, dass es einen Schuldigen gab. Darüber
hinaus handelt es sich hierbei um die Überlieferungsgruppe mit dem insgesamt
größten Ausmaß an Details. Hieraus kann auch auf einen hohen Erklärungsbe-
darf geschlossen werden, den gewaltsame Tode schufen. Aus dem Blickwinkel
dieser Untersuchung bieten die Tode durch Gewalteinwirkung damit die Mög-
lichkeit die historiographischen Stilisierungen durch narrative Strategien ge-
nauer zu untersuchen.1430
Im Kern dieses Abschnitts stehen die Fragen nach der Bewertung von Opfern
und Tätern in der Historiographie. Hierfür bilden diese vier Todesfälle ein ge-
eignetes Korpus. Zwei Morde, ein Tod bei einem Scharmützel auf einem Feldzug
und ein Schlachtentod zeigen die Könige in wehrtechnisch äußerst unter-
schiedlichen Situationen, so dass Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich
werden.
7.1. Königsmord
Im Mittelalter wurden zwei römisch-deutsche Könige zweifelsfrei ermordet:
Philipp II. 1208 und Albrecht I. 1308.1431 Beide Morde wurden von vielen zeit-
genössischen und späteren Chronisten geschildert, auch die Forschung widmete
sich den Morden ausführlich,1432 meist allerdings mit kriminologischem Inter-
esse. Im Folgenden sollen die Überlieferungen zu beiden Taten vergleichend und
mit Blick auf moralische Implikationen betrachtet werden.
1430 Hack, Alter, S. 374 hat ebenfalls einen höheren Detailgrad in den Schilderungen zu Morden an
Karolingern festgestellt und schließt auf einen höheren Erklärungsbedarf, da ein Mord durch
Menschen und nicht durch Gott verursacht wird.
1431 Im Gegensatz hierzu war der Herrschermord in der Merowingerzeit ein verbreitetes Phänomen,
siehe hierzu Ehlers, Birth. - Der Tod Konrads von Teck 1292 wird in dieser Untersuchung nicht
eingehend behandelt. Damit soll weder eine Aussage in der Diskussion über sein mögliches
Königtum, noch in der Frage seiner Todesumstände getroffen werden. Ich trage damit vielmehr
dem Umstand Rechnung, dass die Annales Sindelfingenses, ad a. 1292, S. 68 als einzige zeitge-
nössische historiographische Quelle von seinem Tod berichten. Hierbei handelt es sich um eine
Notiz (dux Cunradus de Deche ante Walburgis obijt). Als Grundlage für eine Untersuchung dieses
Todes in der Historiographie reichen diese Worte nicht aus. Siehe zu Konrad von Teck, Wolf,
König; direkt widersprechend Götz, Konrad von Teck sowie ders., Grabinschrift. Siehe auch
Menzel, Zeit, S. Ulf.
1432 Forschungsüberblicke folgen unten.
249
7. Tod durch Gewalteinwirkung
Während bei anderen Herrscher die Verwicklung von Anderen in einigen Fällen
von den zeitgenössischen Schreibern diskutiert wurde, starben die Könige
Philipp II., Wilhelm, Adolf und Albrecht I. unangezweifelt einen Tod durch
gewaltsame Einwirkung von Anderen. Diese Fälle bieten damit die Möglichkeit,
die Auswirkungen auf die Darstellung und moralische Deutung zu betrachten,
wenn alle Quellen sich einig waren, dass es einen Schuldigen gab. Darüber
hinaus handelt es sich hierbei um die Überlieferungsgruppe mit dem insgesamt
größten Ausmaß an Details. Hieraus kann auch auf einen hohen Erklärungsbe-
darf geschlossen werden, den gewaltsame Tode schufen. Aus dem Blickwinkel
dieser Untersuchung bieten die Tode durch Gewalteinwirkung damit die Mög-
lichkeit die historiographischen Stilisierungen durch narrative Strategien ge-
nauer zu untersuchen.1430
Im Kern dieses Abschnitts stehen die Fragen nach der Bewertung von Opfern
und Tätern in der Historiographie. Hierfür bilden diese vier Todesfälle ein ge-
eignetes Korpus. Zwei Morde, ein Tod bei einem Scharmützel auf einem Feldzug
und ein Schlachtentod zeigen die Könige in wehrtechnisch äußerst unter-
schiedlichen Situationen, so dass Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich
werden.
7.1. Königsmord
Im Mittelalter wurden zwei römisch-deutsche Könige zweifelsfrei ermordet:
Philipp II. 1208 und Albrecht I. 1308.1431 Beide Morde wurden von vielen zeit-
genössischen und späteren Chronisten geschildert, auch die Forschung widmete
sich den Morden ausführlich,1432 meist allerdings mit kriminologischem Inter-
esse. Im Folgenden sollen die Überlieferungen zu beiden Taten vergleichend und
mit Blick auf moralische Implikationen betrachtet werden.
1430 Hack, Alter, S. 374 hat ebenfalls einen höheren Detailgrad in den Schilderungen zu Morden an
Karolingern festgestellt und schließt auf einen höheren Erklärungsbedarf, da ein Mord durch
Menschen und nicht durch Gott verursacht wird.
1431 Im Gegensatz hierzu war der Herrschermord in der Merowingerzeit ein verbreitetes Phänomen,
siehe hierzu Ehlers, Birth. - Der Tod Konrads von Teck 1292 wird in dieser Untersuchung nicht
eingehend behandelt. Damit soll weder eine Aussage in der Diskussion über sein mögliches
Königtum, noch in der Frage seiner Todesumstände getroffen werden. Ich trage damit vielmehr
dem Umstand Rechnung, dass die Annales Sindelfingenses, ad a. 1292, S. 68 als einzige zeitge-
nössische historiographische Quelle von seinem Tod berichten. Hierbei handelt es sich um eine
Notiz (dux Cunradus de Deche ante Walburgis obijt). Als Grundlage für eine Untersuchung dieses
Todes in der Historiographie reichen diese Worte nicht aus. Siehe zu Konrad von Teck, Wolf,
König; direkt widersprechend Götz, Konrad von Teck sowie ders., Grabinschrift. Siehe auch
Menzel, Zeit, S. Ulf.
1432 Forschungsüberblicke folgen unten.