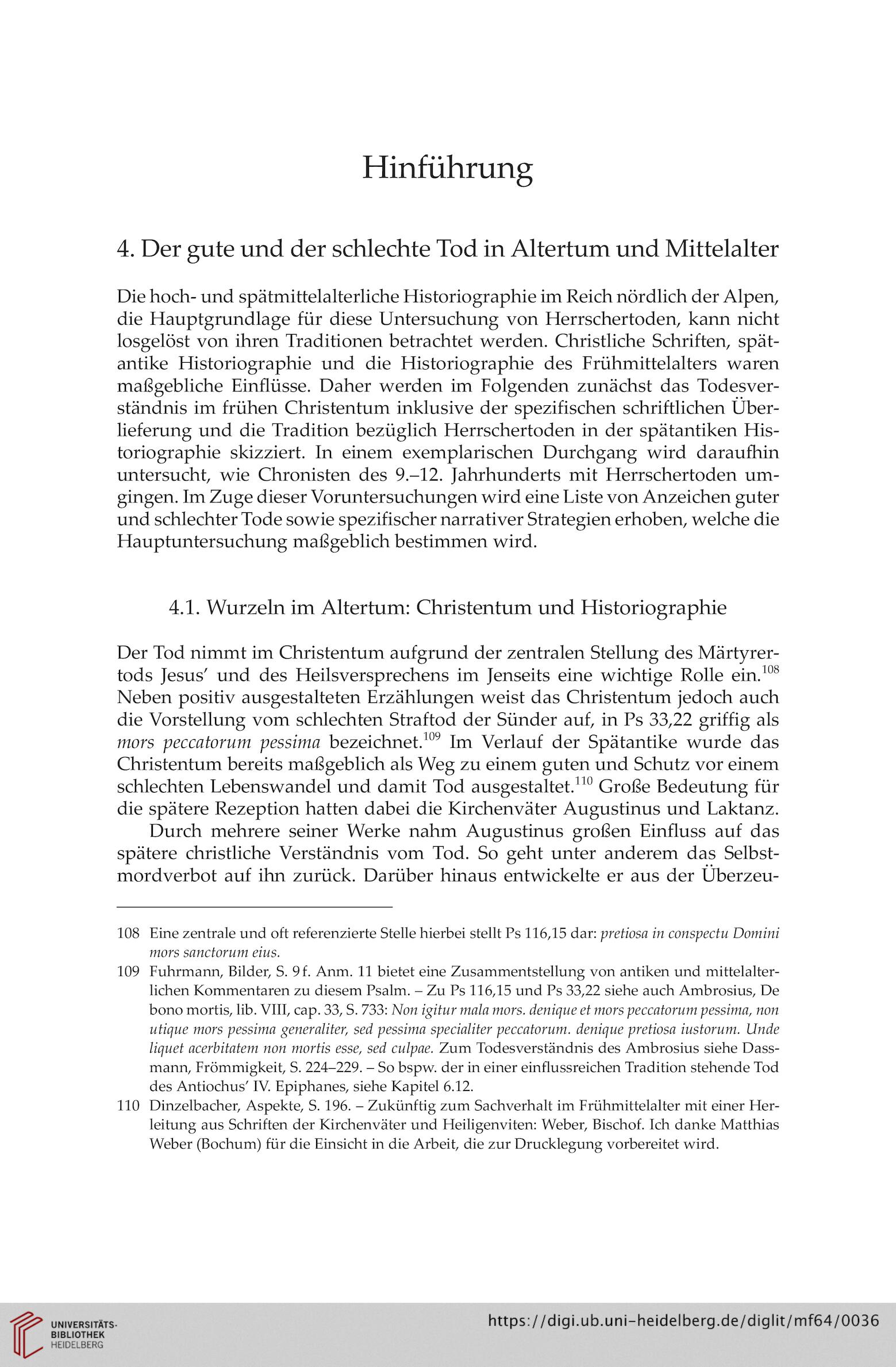Hinführung
4. Der gute und der schlechte Tod in Altertum und Mittelalter
Die hoch- und spätmittelalterliche Historiographie im Reich nördlich der Alpen,
die Hauptgrundlage für diese Untersuchung von Herrschertoden, kann nicht
losgelöst von ihren Traditionen betrachtet werden. Christliche Schriften, spät-
antike Historiographie und die Historiographie des Frühmittelalters waren
maßgebliche Einflüsse. Daher werden im Folgenden zunächst das Todesver-
ständnis im frühen Christentum inklusive der spezifischen schriftlichen Über-
lieferung und die Tradition bezüglich Herrschertoden in der spätantiken His-
toriographie skizziert. In einem exemplarischen Durchgang wird daraufhin
untersucht, wie Chronisten des 9.-12. Jahrhunderts mit Herrschertoden um-
gingen. Im Zuge dieser Voruntersuchungen wird eine Liste von Anzeichen guter
und schlechter Tode sowie spezifischer narrativer Strategien erhoben, welche die
Hauptuntersuchung maßgeblich bestimmen wird.
4.1. Wurzeln im Altertum: Christentum und Historiographie
Der Tod nimmt im Christentum aufgrund der zentralen Stellung des Märtyrer-
tods Jesus' und des Heilsversprechens im Jenseits eine wichtige Rolle ein.108
Neben positiv ausgestalteten Erzählungen weist das Christentum jedoch auch
die Vorstellung vom schlechten Straftod der Sünder auf, in Ps 33,22 griffig als
mors peccatorum pessima bezeichnet.109 Im Verlauf der Spätantike wurde das
Christentum bereits maßgeblich als Weg zu einem guten und Schutz vor einem
schlechten Lebenswandel und damit Tod ausgestaltet.110 Große Bedeutung für
die spätere Rezeption hatten dabei die Kirchenväter Augustinus und Laktanz.
Durch mehrere seiner Werke nahm Augustinus großen Einfluss auf das
spätere christliche Verständnis vom Tod. So geht unter anderem das Selbst-
mordverbot auf ihn zurück. Darüber hinaus entwickelte er aus der Überzeu-
108 Eine zentrale und oft referenzierte Stelle hierbei stellt Ps 116,15 dar: pretiosa in conspectu Domini
mors sanctorum eins.
109 Fuhrmann, Bilder, S. 9f. Anm. 11 bietet eine Zusammentstellung von antiken und mittelalter-
lichen Kommentaren zu diesem Psalm. - Zu Ps 116,15 und Ps 33,22 siehe auch Ambrosius, De
bono mortis, lib. VIII, cap. 33, S. 733: Non igitur mala mors, denique et mors peccatorum pessima, non
utique mors pessima generaliter, sed pessima specialiter peccatorum. denique pretiosa iustorum. Unde
liquet acerbitatem non mortis esse, sed culpae. Zum Todesverständnis des Ambrosius siehe Dass-
mann, Frömmigkeit, S. 224-229. - So bspw. der in einer einflussreichen Tradition stehende Tod
des Antiochus' IV. Epiphanes, siehe Kapitel 6.12.
110 Dinzelbacher, Aspekte, S. 196. - Zukünftig zum Sachverhalt im Frühmittelalter mit einer Her-
leitung aus Schriften der Kirchenväter und Heiligenviten: Weber, Bischof. Ich danke Matthias
Weber (Bochum) für die Einsicht in die Arbeit, die zur Drucklegung vorbereitet wird.
4. Der gute und der schlechte Tod in Altertum und Mittelalter
Die hoch- und spätmittelalterliche Historiographie im Reich nördlich der Alpen,
die Hauptgrundlage für diese Untersuchung von Herrschertoden, kann nicht
losgelöst von ihren Traditionen betrachtet werden. Christliche Schriften, spät-
antike Historiographie und die Historiographie des Frühmittelalters waren
maßgebliche Einflüsse. Daher werden im Folgenden zunächst das Todesver-
ständnis im frühen Christentum inklusive der spezifischen schriftlichen Über-
lieferung und die Tradition bezüglich Herrschertoden in der spätantiken His-
toriographie skizziert. In einem exemplarischen Durchgang wird daraufhin
untersucht, wie Chronisten des 9.-12. Jahrhunderts mit Herrschertoden um-
gingen. Im Zuge dieser Voruntersuchungen wird eine Liste von Anzeichen guter
und schlechter Tode sowie spezifischer narrativer Strategien erhoben, welche die
Hauptuntersuchung maßgeblich bestimmen wird.
4.1. Wurzeln im Altertum: Christentum und Historiographie
Der Tod nimmt im Christentum aufgrund der zentralen Stellung des Märtyrer-
tods Jesus' und des Heilsversprechens im Jenseits eine wichtige Rolle ein.108
Neben positiv ausgestalteten Erzählungen weist das Christentum jedoch auch
die Vorstellung vom schlechten Straftod der Sünder auf, in Ps 33,22 griffig als
mors peccatorum pessima bezeichnet.109 Im Verlauf der Spätantike wurde das
Christentum bereits maßgeblich als Weg zu einem guten und Schutz vor einem
schlechten Lebenswandel und damit Tod ausgestaltet.110 Große Bedeutung für
die spätere Rezeption hatten dabei die Kirchenväter Augustinus und Laktanz.
Durch mehrere seiner Werke nahm Augustinus großen Einfluss auf das
spätere christliche Verständnis vom Tod. So geht unter anderem das Selbst-
mordverbot auf ihn zurück. Darüber hinaus entwickelte er aus der Überzeu-
108 Eine zentrale und oft referenzierte Stelle hierbei stellt Ps 116,15 dar: pretiosa in conspectu Domini
mors sanctorum eins.
109 Fuhrmann, Bilder, S. 9f. Anm. 11 bietet eine Zusammentstellung von antiken und mittelalter-
lichen Kommentaren zu diesem Psalm. - Zu Ps 116,15 und Ps 33,22 siehe auch Ambrosius, De
bono mortis, lib. VIII, cap. 33, S. 733: Non igitur mala mors, denique et mors peccatorum pessima, non
utique mors pessima generaliter, sed pessima specialiter peccatorum. denique pretiosa iustorum. Unde
liquet acerbitatem non mortis esse, sed culpae. Zum Todesverständnis des Ambrosius siehe Dass-
mann, Frömmigkeit, S. 224-229. - So bspw. der in einer einflussreichen Tradition stehende Tod
des Antiochus' IV. Epiphanes, siehe Kapitel 6.12.
110 Dinzelbacher, Aspekte, S. 196. - Zukünftig zum Sachverhalt im Frühmittelalter mit einer Her-
leitung aus Schriften der Kirchenväter und Heiligenviten: Weber, Bischof. Ich danke Matthias
Weber (Bochum) für die Einsicht in die Arbeit, die zur Drucklegung vorbereitet wird.