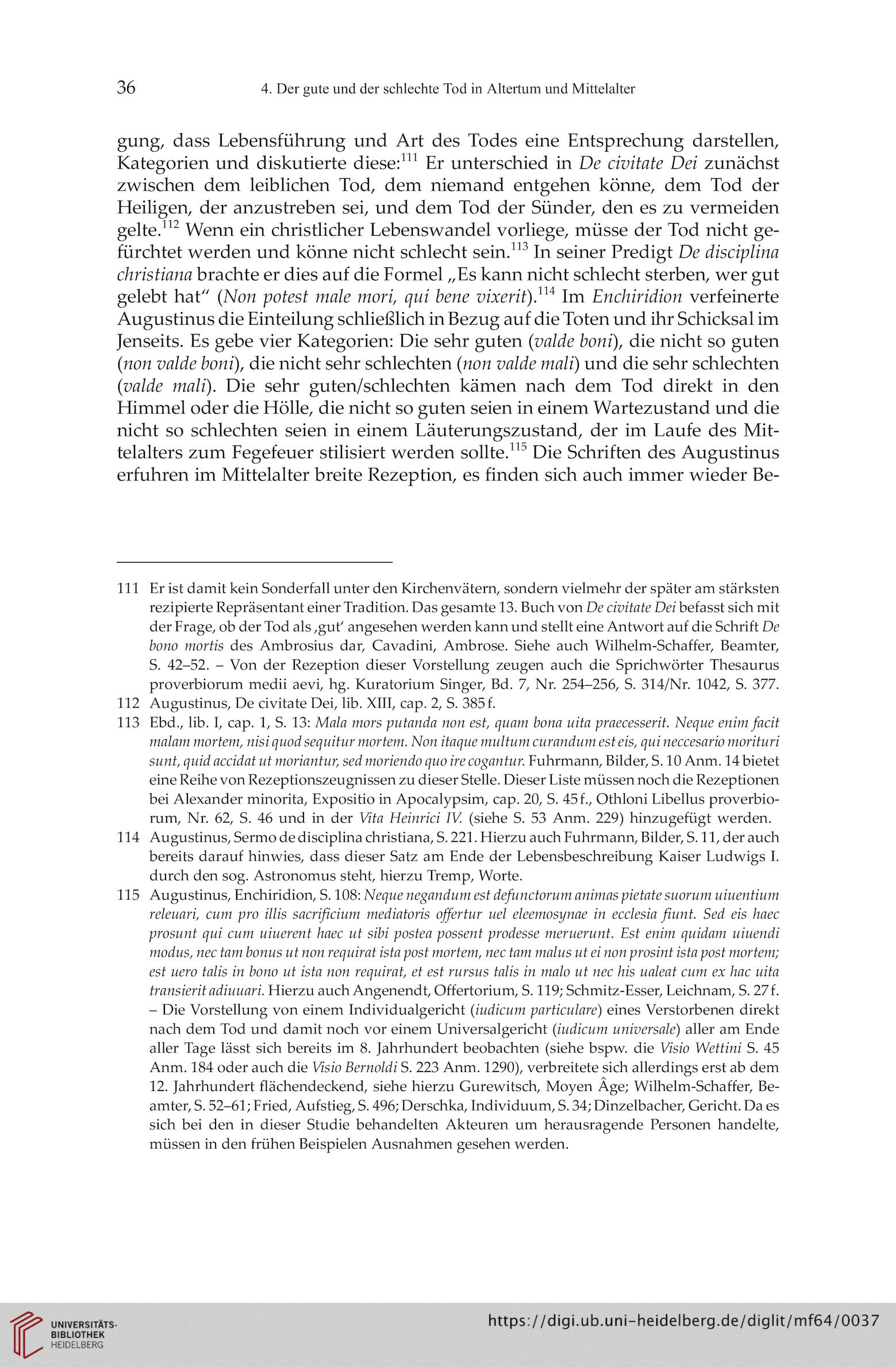36
4. Der gute und der schlechte Tod in Altertum und Mittelalter
gung, dass Lebensführung und Art des Todes eine Entsprechung darstellen,
Kategorien und diskutierte diese:111 Er unterschied in De civitate Dei zunächst
zwischen dem leiblichen Tod, dem niemand entgehen könne, dem Tod der
Heiligen, der anzustreben sei, und dem Tod der Sünder, den es zu vermeiden
gelte.112 Wenn ein christlicher Lebenswandel vorliege, müsse der Tod nicht ge-
fürchtet werden und könne nicht schlecht sein.113 In seiner Predigt De disciplina
christiana brachte er dies auf die Formel „Es kann nicht schlecht sterben, wer gut
gelebt hat" (Non potest male mori, qui bene vixerit)."4 Im Enchiridion verfeinerte
Augustinus die Einteilung schließlich in Bezug auf die Toten und ihr Schicksal im
Jenseits. Es gebe vier Kategorien: Die sehr guten (valde boni), die nicht so guten
(non valde boni), die nicht sehr schlechten (non valde mali) und die sehr schlechten
(valde mali). Die sehr guten/schlechten kämen nach dem Tod direkt in den
Himmel oder die Hölle, die nicht so guten seien in einem Wartezustand und die
nicht so schlechten seien in einem Läuterungszustand, der im Laufe des Mit-
telalters zum Fegefeuer stilisiert werden sollte.115 Die Schriften des Augustinus
erfuhren im Mittelalter breite Rezeption, es finden sich auch immer wieder Be-
lli Er ist damit kein Sonderfall unter den Kirchenvätern, sondern vielmehr der später am stärksten
rezipierte Repräsentant einer Tradition. Das gesamte 13. Buch von De civitate Dei befasst sich mit
der Frage, ob der Tod als ,gut' angesehen werden kann und stellt eine Antwort auf die Schrift De
bono mortis des Ambrosius dar, Cavadini, Ambrose. Siehe auch Wilhelm-Schaffer, Beamter,
S. 42-52. - Von der Rezeption dieser Vorstellung zeugen auch die Sprichwörter Thesaurus
proverbiorum medii aevi, hg. Kuratorium Singer, Bd. 7, Nr. 254-256, S. 314/Nr. 1042, S. 377.
112 Augustinus, De civitate Dei, lib. XIII, cap. 2, S. 385 f.
113 Ebd., lib. I, cap. 1, S. 13: Mala mors putanda non est, quam bona uita praecesserit. Neque enimfacit
malam mortem, nisi quod sequitur mortem. Non itaque multum curandum esteis, qui neccesario morituri
sunt, quid accidat ut moriantur, sed moriendo quo ire cogantur. Fuhrmann, Bilder, S. 10 Anm. 14 bietet
eine Reihe von Rezeptionszeugnissen zu dieser Stelle. Dieser Liste müssen noch die Rezeptionen
bei Alexander minorita, Expositio in Apocalypsim, cap. 20, S. 45 f., Othloni Libellus proverbio-
rum, Nr. 62, S. 46 und in der Vita Heinrici IV. (siehe S. 53 Anm. 229) hinzugefügt werden.
114 Augustinus, Sermo de disciplina christiana, S. 221. Hierzu auch Fuhrmann, Bilder, S. 11, der auch
bereits darauf hinwies, dass dieser Satz am Ende der Lebensbeschreibung Kaiser Ludwigs I.
durch den sog. Astronomus steht, hierzu Tremp, Worte.
115 Augustinus, Enchiridion, S. 108: Neque negandum est defunctorum animas pietate suorum uiuentium
releuari, cum pro Ulis sacrificium mediatoris offertur uel eleemosynae in ecclesia fiunt. Sed eis haec
prosunt qui cum uiuerent haec ut sibi postea possent prodesse meruerunt. Est enim quidam uiuendi
modus, nec tarn bonus ut non requirat ista post mortem, nec tarn malus ut ei non prosint ista post mortem;
est uero talis in bono ut ista non requirat, et est rursus talis in malo ut nec his ualeat cum ex hac uita
transierit adiuuari. Hierzu auch Angenendt, Offertorium, S. 119; Schmitz-Esser, Leichnam, S. 27f.
- Die Vorstellung von einem Individualgericht (iudicum particulare) eines Verstorbenen direkt
nach dem Tod und damit noch vor einem Universalgericht (iudicum universale) aller am Ende
aller Tage lässt sich bereits im 8. Jahrhundert beobachten (siehe bspw. die Visio Wettini S. 45
Anm. 184 oder auch die Visio Bernoldi S. 223 Anm. 1290), verbreitete sich allerdings erst ab dem
12. Jahrhundert flächendeckend, siehe hierzu Gurewitsch, Moyen Age; Wilhelm-Schaffer, Be-
amter, S. 52-61; Fried, Aufstieg, S. 496; Derschka, Individuum, S. 34; Dinzelbacher, Gericht. Da es
sich bei den in dieser Studie behandelten Akteuren um herausragende Personen handelte,
müssen in den frühen Beispielen Ausnahmen gesehen werden.
4. Der gute und der schlechte Tod in Altertum und Mittelalter
gung, dass Lebensführung und Art des Todes eine Entsprechung darstellen,
Kategorien und diskutierte diese:111 Er unterschied in De civitate Dei zunächst
zwischen dem leiblichen Tod, dem niemand entgehen könne, dem Tod der
Heiligen, der anzustreben sei, und dem Tod der Sünder, den es zu vermeiden
gelte.112 Wenn ein christlicher Lebenswandel vorliege, müsse der Tod nicht ge-
fürchtet werden und könne nicht schlecht sein.113 In seiner Predigt De disciplina
christiana brachte er dies auf die Formel „Es kann nicht schlecht sterben, wer gut
gelebt hat" (Non potest male mori, qui bene vixerit)."4 Im Enchiridion verfeinerte
Augustinus die Einteilung schließlich in Bezug auf die Toten und ihr Schicksal im
Jenseits. Es gebe vier Kategorien: Die sehr guten (valde boni), die nicht so guten
(non valde boni), die nicht sehr schlechten (non valde mali) und die sehr schlechten
(valde mali). Die sehr guten/schlechten kämen nach dem Tod direkt in den
Himmel oder die Hölle, die nicht so guten seien in einem Wartezustand und die
nicht so schlechten seien in einem Läuterungszustand, der im Laufe des Mit-
telalters zum Fegefeuer stilisiert werden sollte.115 Die Schriften des Augustinus
erfuhren im Mittelalter breite Rezeption, es finden sich auch immer wieder Be-
lli Er ist damit kein Sonderfall unter den Kirchenvätern, sondern vielmehr der später am stärksten
rezipierte Repräsentant einer Tradition. Das gesamte 13. Buch von De civitate Dei befasst sich mit
der Frage, ob der Tod als ,gut' angesehen werden kann und stellt eine Antwort auf die Schrift De
bono mortis des Ambrosius dar, Cavadini, Ambrose. Siehe auch Wilhelm-Schaffer, Beamter,
S. 42-52. - Von der Rezeption dieser Vorstellung zeugen auch die Sprichwörter Thesaurus
proverbiorum medii aevi, hg. Kuratorium Singer, Bd. 7, Nr. 254-256, S. 314/Nr. 1042, S. 377.
112 Augustinus, De civitate Dei, lib. XIII, cap. 2, S. 385 f.
113 Ebd., lib. I, cap. 1, S. 13: Mala mors putanda non est, quam bona uita praecesserit. Neque enimfacit
malam mortem, nisi quod sequitur mortem. Non itaque multum curandum esteis, qui neccesario morituri
sunt, quid accidat ut moriantur, sed moriendo quo ire cogantur. Fuhrmann, Bilder, S. 10 Anm. 14 bietet
eine Reihe von Rezeptionszeugnissen zu dieser Stelle. Dieser Liste müssen noch die Rezeptionen
bei Alexander minorita, Expositio in Apocalypsim, cap. 20, S. 45 f., Othloni Libellus proverbio-
rum, Nr. 62, S. 46 und in der Vita Heinrici IV. (siehe S. 53 Anm. 229) hinzugefügt werden.
114 Augustinus, Sermo de disciplina christiana, S. 221. Hierzu auch Fuhrmann, Bilder, S. 11, der auch
bereits darauf hinwies, dass dieser Satz am Ende der Lebensbeschreibung Kaiser Ludwigs I.
durch den sog. Astronomus steht, hierzu Tremp, Worte.
115 Augustinus, Enchiridion, S. 108: Neque negandum est defunctorum animas pietate suorum uiuentium
releuari, cum pro Ulis sacrificium mediatoris offertur uel eleemosynae in ecclesia fiunt. Sed eis haec
prosunt qui cum uiuerent haec ut sibi postea possent prodesse meruerunt. Est enim quidam uiuendi
modus, nec tarn bonus ut non requirat ista post mortem, nec tarn malus ut ei non prosint ista post mortem;
est uero talis in bono ut ista non requirat, et est rursus talis in malo ut nec his ualeat cum ex hac uita
transierit adiuuari. Hierzu auch Angenendt, Offertorium, S. 119; Schmitz-Esser, Leichnam, S. 27f.
- Die Vorstellung von einem Individualgericht (iudicum particulare) eines Verstorbenen direkt
nach dem Tod und damit noch vor einem Universalgericht (iudicum universale) aller am Ende
aller Tage lässt sich bereits im 8. Jahrhundert beobachten (siehe bspw. die Visio Wettini S. 45
Anm. 184 oder auch die Visio Bernoldi S. 223 Anm. 1290), verbreitete sich allerdings erst ab dem
12. Jahrhundert flächendeckend, siehe hierzu Gurewitsch, Moyen Age; Wilhelm-Schaffer, Be-
amter, S. 52-61; Fried, Aufstieg, S. 496; Derschka, Individuum, S. 34; Dinzelbacher, Gericht. Da es
sich bei den in dieser Studie behandelten Akteuren um herausragende Personen handelte,
müssen in den frühen Beispielen Ausnahmen gesehen werden.