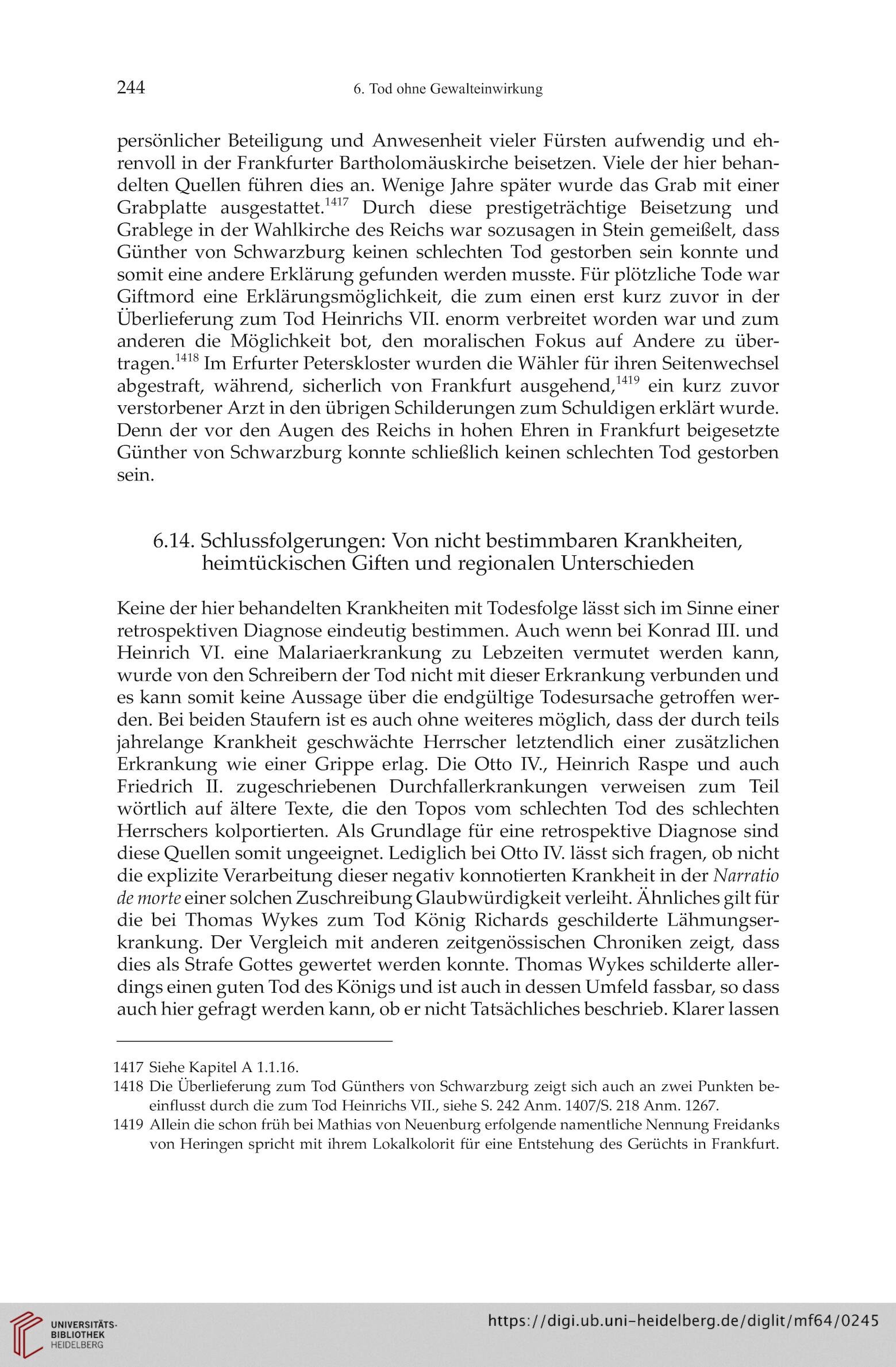244
6. Tod ohne Gewalteinwirkung
persönlicher Beteiligung und Anwesenheit vieler Fürsten aufwendig und eh-
renvoll in der Frankfurter Bartholomäuskirche beisetzen. Viele der hier behan-
delten Quellen führen dies an. Wenige Jahre später wurde das Grab mit einer
Grabplatte ausgestattet.1417 Durch diese prestigeträchtige Beisetzung und
Grablege in der Wahlkirche des Reichs war sozusagen in Stein gemeißelt, dass
Günther von Schwarzburg keinen schlechten Tod gestorben sein konnte und
somit eine andere Erklärung gefunden werden musste. Für plötzliche Tode war
Giftmord eine Erklärungsmöglichkeit, die zum einen erst kurz zuvor in der
Überlieferung zum Tod Heinrichs VII. enorm verbreitet worden war und zum
anderen die Möglichkeit bot, den moralischen Fokus auf Andere zu über-
tragen.1418 Im Erfurter Peterskloster wurden die Wähler für ihren Seitenwechsel
abgestraft, während, sicherlich von Frankfurt ausgehend,1419 ein kurz zuvor
verstorbener Arzt in den übrigen Schilderungen zum Schuldigen erklärt wurde.
Denn der vor den Augen des Reichs in hohen Ehren in Frankfurt beigesetzte
Günther von Schwarzburg konnte schließlich keinen schlechten Tod gestorben
sein.
6.14. Schlussfolgerungen: Von nicht bestimmbaren Krankheiten,
heimtückischen Giften und regionalen Unterschieden
Keine der hier behandelten Krankheiten mit Todesfolge lässt sich im Sinne einer
retrospektiven Diagnose eindeutig bestimmen. Auch wenn bei Konrad III. und
Heinrich VI. eine Malariaerkrankung zu Lebzeiten vermutet werden kann,
wurde von den Schreibern der Tod nicht mit dieser Erkrankung verbunden und
es kann somit keine Aussage über die endgültige Todesursache getroffen wer-
den. Bei beiden Staufern ist es auch ohne weiteres möglich, dass der durch teils
jahrelange Krankheit geschwächte Herrscher letztendlich einer zusätzlichen
Erkrankung wie einer Grippe erlag. Die Otto IV, Heinrich Raspe und auch
Friedrich II. zugeschriebenen Durchfallerkrankungen verweisen zum Teil
wörtlich auf ältere Texte, die den Topos vom schlechten Tod des schlechten
Herrschers kolportierten. Als Grundlage für eine retrospektive Diagnose sind
diese Quellen somit ungeeignet. Lediglich bei Otto IV. lässt sich fragen, ob nicht
die explizite Verarbeitung dieser negativ konnotierten Krankheit in der Narratio
de morte einer solchen Zuschreibung Glaubwürdigkeit verleiht. Ähnliches gilt für
die bei Thomas Wykes zum Tod König Richards geschilderte Lähmungser-
krankung. Der Vergleich mit anderen zeitgenössischen Chroniken zeigt, dass
dies als Strafe Gottes gewertet werden konnte. Thomas Wykes schilderte aller-
dings einen guten Tod des Königs und ist auch in dessen Umfeld fassbar, so dass
auch hier gefragt werden kann, ob er nicht Tatsächliches beschrieb. Klarer lassen
1417 Siehe Kapitel A 1.1.16.
1418 Die Überlieferung zum Tod Günthers von Schwarzburg zeigt sich auch an zwei Punkten be-
einflusst durch die zum Tod Heinrichs VII., siehe S. 242 Anm. 1407/S. 218 Anm. 1267.
1419 Allein die schon früh bei Mathias von Neuenburg erfolgende namentliche Nennung Freidanks
von Heringen spricht mit ihrem Lokalkolorit für eine Entstehung des Gerüchts in Frankfurt.
6. Tod ohne Gewalteinwirkung
persönlicher Beteiligung und Anwesenheit vieler Fürsten aufwendig und eh-
renvoll in der Frankfurter Bartholomäuskirche beisetzen. Viele der hier behan-
delten Quellen führen dies an. Wenige Jahre später wurde das Grab mit einer
Grabplatte ausgestattet.1417 Durch diese prestigeträchtige Beisetzung und
Grablege in der Wahlkirche des Reichs war sozusagen in Stein gemeißelt, dass
Günther von Schwarzburg keinen schlechten Tod gestorben sein konnte und
somit eine andere Erklärung gefunden werden musste. Für plötzliche Tode war
Giftmord eine Erklärungsmöglichkeit, die zum einen erst kurz zuvor in der
Überlieferung zum Tod Heinrichs VII. enorm verbreitet worden war und zum
anderen die Möglichkeit bot, den moralischen Fokus auf Andere zu über-
tragen.1418 Im Erfurter Peterskloster wurden die Wähler für ihren Seitenwechsel
abgestraft, während, sicherlich von Frankfurt ausgehend,1419 ein kurz zuvor
verstorbener Arzt in den übrigen Schilderungen zum Schuldigen erklärt wurde.
Denn der vor den Augen des Reichs in hohen Ehren in Frankfurt beigesetzte
Günther von Schwarzburg konnte schließlich keinen schlechten Tod gestorben
sein.
6.14. Schlussfolgerungen: Von nicht bestimmbaren Krankheiten,
heimtückischen Giften und regionalen Unterschieden
Keine der hier behandelten Krankheiten mit Todesfolge lässt sich im Sinne einer
retrospektiven Diagnose eindeutig bestimmen. Auch wenn bei Konrad III. und
Heinrich VI. eine Malariaerkrankung zu Lebzeiten vermutet werden kann,
wurde von den Schreibern der Tod nicht mit dieser Erkrankung verbunden und
es kann somit keine Aussage über die endgültige Todesursache getroffen wer-
den. Bei beiden Staufern ist es auch ohne weiteres möglich, dass der durch teils
jahrelange Krankheit geschwächte Herrscher letztendlich einer zusätzlichen
Erkrankung wie einer Grippe erlag. Die Otto IV, Heinrich Raspe und auch
Friedrich II. zugeschriebenen Durchfallerkrankungen verweisen zum Teil
wörtlich auf ältere Texte, die den Topos vom schlechten Tod des schlechten
Herrschers kolportierten. Als Grundlage für eine retrospektive Diagnose sind
diese Quellen somit ungeeignet. Lediglich bei Otto IV. lässt sich fragen, ob nicht
die explizite Verarbeitung dieser negativ konnotierten Krankheit in der Narratio
de morte einer solchen Zuschreibung Glaubwürdigkeit verleiht. Ähnliches gilt für
die bei Thomas Wykes zum Tod König Richards geschilderte Lähmungser-
krankung. Der Vergleich mit anderen zeitgenössischen Chroniken zeigt, dass
dies als Strafe Gottes gewertet werden konnte. Thomas Wykes schilderte aller-
dings einen guten Tod des Königs und ist auch in dessen Umfeld fassbar, so dass
auch hier gefragt werden kann, ob er nicht Tatsächliches beschrieb. Klarer lassen
1417 Siehe Kapitel A 1.1.16.
1418 Die Überlieferung zum Tod Günthers von Schwarzburg zeigt sich auch an zwei Punkten be-
einflusst durch die zum Tod Heinrichs VII., siehe S. 242 Anm. 1407/S. 218 Anm. 1267.
1419 Allein die schon früh bei Mathias von Neuenburg erfolgende namentliche Nennung Freidanks
von Heringen spricht mit ihrem Lokalkolorit für eine Entstehung des Gerüchts in Frankfurt.