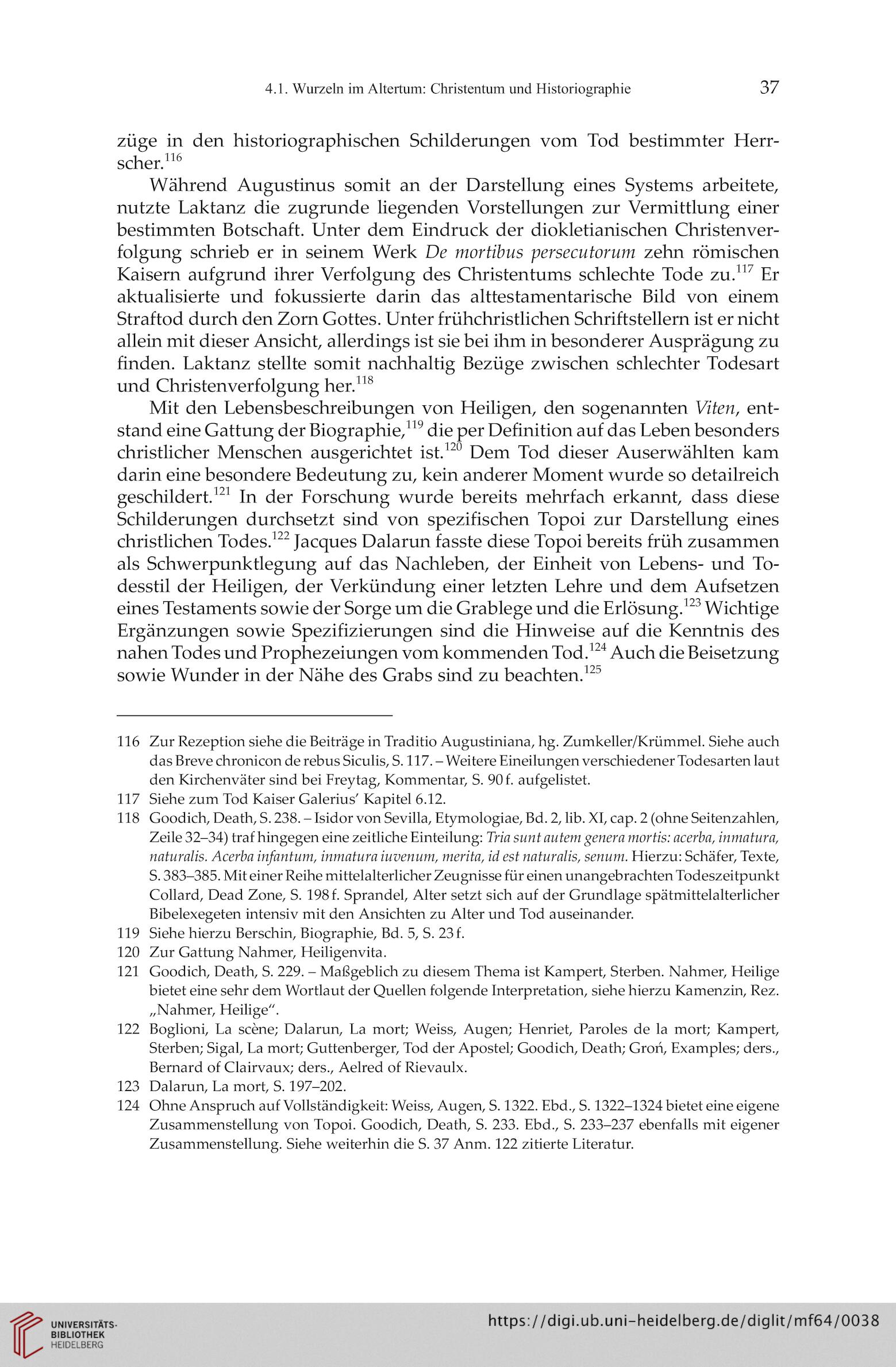4.1. Wurzeln im Altertum: Christentum und Historiographie
37
züge in den historiographischen Schilderungen vom Tod bestimmter Herr-
scher.116
Während Augustinus somit an der Darstellung eines Systems arbeitete,
nutzte Laktanz die zugrunde liegenden Vorstellungen zur Vermittlung einer
bestimmten Botschaft. Unter dem Eindruck der diokletianischen Christenver-
folgung schrieb er in seinem Werk De mortibus persecutorum zehn römischen
Kaisern aufgrund ihrer Verfolgung des Christentums schlechte Tode zu.117 Er
aktualisierte und fokussierte darin das alttestamentarische Bild von einem
Straftod durch den Zorn Gottes. Unter frühchristlichen Schriftstellern ist er nicht
allein mit dieser Ansicht, allerdings ist sie bei ihm in besonderer Ausprägung zu
finden. Laktanz stellte somit nachhaltig Bezüge zwischen schlechter Todesart
und Christenverfolgung her.118
Mit den Lebensbeschreibungen von Heiligen, den sogenannten Viten, ent-
stand eine Gattung der Biographie,119 die per Definition auf das Leben besonders
christlicher Menschen aus gerichtet ist.120 Dem Tod dieser Auserwählten kam
darin eine besondere Bedeutung zu, kein anderer Moment wurde so detailreich
geschildert.121 In der Forschung wurde bereits mehrfach erkannt, dass diese
Schilderungen durchsetzt sind von spezifischen Topoi zur Darstellung eines
christlichen Todes.122 Jacques Dalarun fasste diese Topoi bereits früh zusammen
als Schwerpunktlegung auf das Nachleben, der Einheit von Lebens- und To-
desstil der Heiligen, der Verkündung einer letzten Lehre und dem Aufsetzen
eines Testaments sowie der Sorge um die Grab lege und die Erlösung.123 Wichtige
Ergänzungen sowie Spezifizierungen sind die Hinweise auf die Kenntnis des
nahen Todes und Prophezeiungen vom kommenden Tod.124 Auch die Beisetzung
sowie Wunder in der Nähe des Grabs sind zu beachten.125
116 Zur Rezeption siehe die Beiträge in Traditio Augustiniana, hg. Zumkeller/Krümmel. Siehe auch
das Breve chronicon de rebus Siculis, S. 117. - Weitere Eineilungen verschiedener Todesarten laut
den Kirchenväter sind bei Freytag, Kommentar, S. 90 f. aufgelistet.
117 Siehe zum Tod Kaiser Galerius' Kapitel 6.12.
118 Goodich, Death, S. 238. - Isidor von Sevilla, Etymologiae, Bd. 2, lib. XI, cap. 2 (ohne Seitenzahlen,
Zeile 32-34) traf hingegen eine zeitliche Einteilung: Tria suntautem genera mortis: acerba, inmatura,
naturalis. Acerba infantum, inmatura iuvenum, merita, id est naturalis, senum. Hierzu: Schäfer, Texte,
S. 383-385. Mit einer Reihe mittelalterlicher Zeugnisse für einen unangebrachten Todeszeitpunkt
Collard, Dead Zone, S. 198 f. Sprandel, Alter setzt sich auf der Grundlage spätmittelalterlicher
Bibelexegeten intensiv mit den Ansichten zu Alter und Tod auseinander.
119 Siehe hierzu Berschin, Biographie, Bd. 5, S. 23 f.
120 Zur Gattung Nahmer, Heiligenvita.
121 Goodich, Death, S. 229. - Maßgeblich zu diesem Thema ist Kampert, Sterben. Nahmer, Heilige
bietet eine sehr dem Wortlaut der Quellen folgende Interpretation, siehe hierzu Kamenzin, Rez.
„Nahmer, Heilige".
122 Boglioni, La scene; Dalarun, La mort; Weiss, Augen; Henriet, Paroles de la mort; Kampert,
Sterben; Sigal, La mort; Guttenberger, Tod der Apostel; Goodich, Death; Groh, Examples; ders.,
Bernard of Clairvaux; ders., Aelred of Rievaulx.
123 Dalarun, La mort, S. 197-202.
124 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Weiss, Augen, S. 1322. Ebd., S. 1322-1324 bietet eine eigene
Zusammenstellung von Topoi. Goodich, Death, S. 233. Ebd., S. 233-237 ebenfalls mit eigener
Zusammenstellung. Siehe weiterhin die S. 37 Anm. 122 zitierte Literatur.
37
züge in den historiographischen Schilderungen vom Tod bestimmter Herr-
scher.116
Während Augustinus somit an der Darstellung eines Systems arbeitete,
nutzte Laktanz die zugrunde liegenden Vorstellungen zur Vermittlung einer
bestimmten Botschaft. Unter dem Eindruck der diokletianischen Christenver-
folgung schrieb er in seinem Werk De mortibus persecutorum zehn römischen
Kaisern aufgrund ihrer Verfolgung des Christentums schlechte Tode zu.117 Er
aktualisierte und fokussierte darin das alttestamentarische Bild von einem
Straftod durch den Zorn Gottes. Unter frühchristlichen Schriftstellern ist er nicht
allein mit dieser Ansicht, allerdings ist sie bei ihm in besonderer Ausprägung zu
finden. Laktanz stellte somit nachhaltig Bezüge zwischen schlechter Todesart
und Christenverfolgung her.118
Mit den Lebensbeschreibungen von Heiligen, den sogenannten Viten, ent-
stand eine Gattung der Biographie,119 die per Definition auf das Leben besonders
christlicher Menschen aus gerichtet ist.120 Dem Tod dieser Auserwählten kam
darin eine besondere Bedeutung zu, kein anderer Moment wurde so detailreich
geschildert.121 In der Forschung wurde bereits mehrfach erkannt, dass diese
Schilderungen durchsetzt sind von spezifischen Topoi zur Darstellung eines
christlichen Todes.122 Jacques Dalarun fasste diese Topoi bereits früh zusammen
als Schwerpunktlegung auf das Nachleben, der Einheit von Lebens- und To-
desstil der Heiligen, der Verkündung einer letzten Lehre und dem Aufsetzen
eines Testaments sowie der Sorge um die Grab lege und die Erlösung.123 Wichtige
Ergänzungen sowie Spezifizierungen sind die Hinweise auf die Kenntnis des
nahen Todes und Prophezeiungen vom kommenden Tod.124 Auch die Beisetzung
sowie Wunder in der Nähe des Grabs sind zu beachten.125
116 Zur Rezeption siehe die Beiträge in Traditio Augustiniana, hg. Zumkeller/Krümmel. Siehe auch
das Breve chronicon de rebus Siculis, S. 117. - Weitere Eineilungen verschiedener Todesarten laut
den Kirchenväter sind bei Freytag, Kommentar, S. 90 f. aufgelistet.
117 Siehe zum Tod Kaiser Galerius' Kapitel 6.12.
118 Goodich, Death, S. 238. - Isidor von Sevilla, Etymologiae, Bd. 2, lib. XI, cap. 2 (ohne Seitenzahlen,
Zeile 32-34) traf hingegen eine zeitliche Einteilung: Tria suntautem genera mortis: acerba, inmatura,
naturalis. Acerba infantum, inmatura iuvenum, merita, id est naturalis, senum. Hierzu: Schäfer, Texte,
S. 383-385. Mit einer Reihe mittelalterlicher Zeugnisse für einen unangebrachten Todeszeitpunkt
Collard, Dead Zone, S. 198 f. Sprandel, Alter setzt sich auf der Grundlage spätmittelalterlicher
Bibelexegeten intensiv mit den Ansichten zu Alter und Tod auseinander.
119 Siehe hierzu Berschin, Biographie, Bd. 5, S. 23 f.
120 Zur Gattung Nahmer, Heiligenvita.
121 Goodich, Death, S. 229. - Maßgeblich zu diesem Thema ist Kampert, Sterben. Nahmer, Heilige
bietet eine sehr dem Wortlaut der Quellen folgende Interpretation, siehe hierzu Kamenzin, Rez.
„Nahmer, Heilige".
122 Boglioni, La scene; Dalarun, La mort; Weiss, Augen; Henriet, Paroles de la mort; Kampert,
Sterben; Sigal, La mort; Guttenberger, Tod der Apostel; Goodich, Death; Groh, Examples; ders.,
Bernard of Clairvaux; ders., Aelred of Rievaulx.
123 Dalarun, La mort, S. 197-202.
124 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Weiss, Augen, S. 1322. Ebd., S. 1322-1324 bietet eine eigene
Zusammenstellung von Topoi. Goodich, Death, S. 233. Ebd., S. 233-237 ebenfalls mit eigener
Zusammenstellung. Siehe weiterhin die S. 37 Anm. 122 zitierte Literatur.