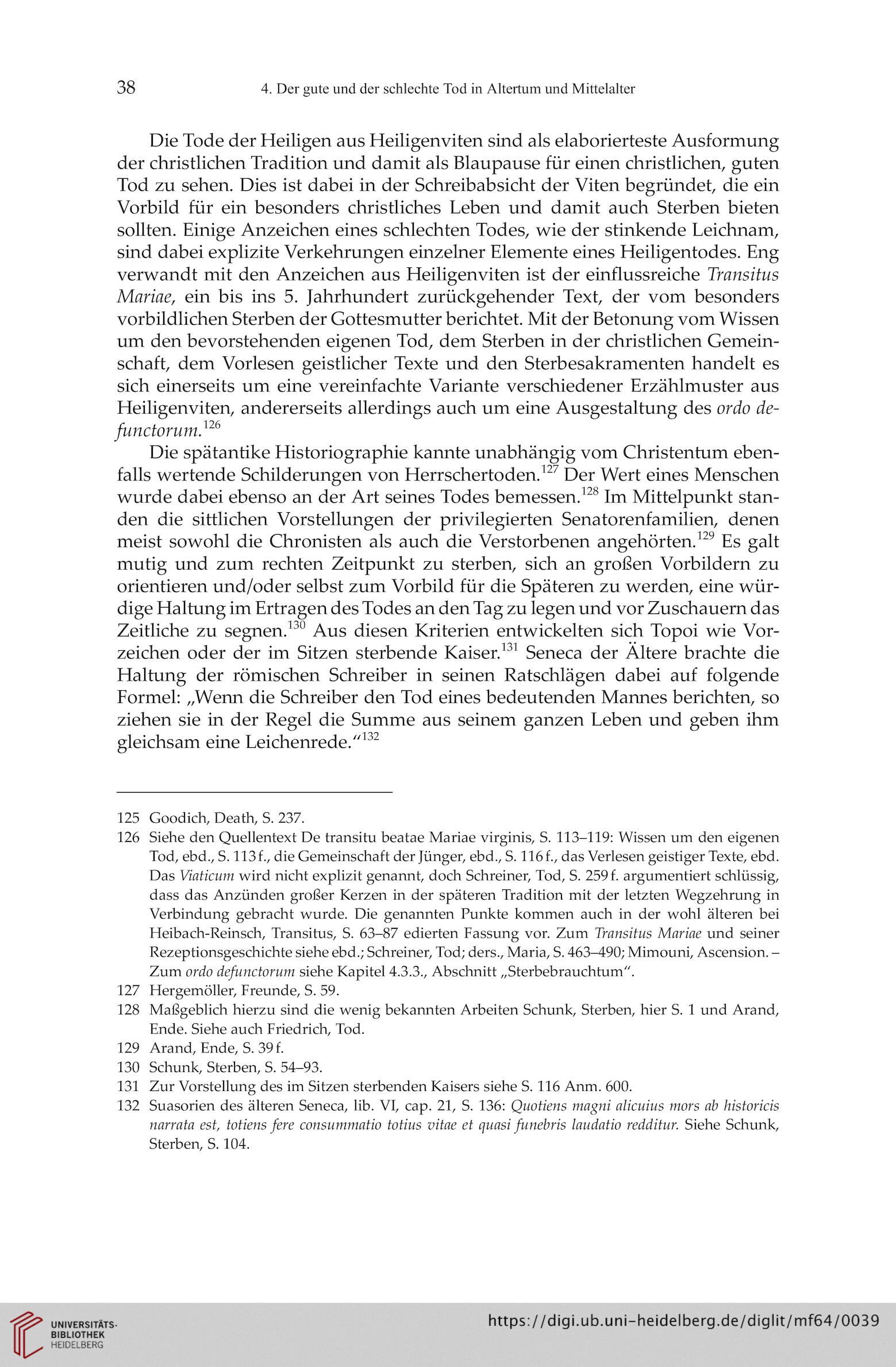38
4. Der gute und der schlechte Tod in Altertum und Mittelalter
Die Tode der Heiligen aus Heiligenviten sind als elaborierteste Ausformung
der christlichen Tradition und damit als Blaupause für einen christlichen, guten
Tod zu sehen. Dies ist dabei in der Schreibabsicht der Viten begründet, die ein
Vorbild für ein besonders christliches Leben und damit auch Sterben bieten
sollten. Einige Anzeichen eines schlechten Todes, wie der stinkende Leichnam,
sind dabei explizite Verkehrungen einzelner Elemente eines Heiligentodes. Eng
verwandt mit den Anzeichen aus Heiligenviten ist der einflussreiche Transitus
Mariae, ein bis ins 5. Jahrhundert zurückgehender Text, der vom besonders
vorbildlichen Sterben der Gottesmutter berichtet. Mit der Betonung vom Wissen
um den bevorstehenden eigenen Tod, dem Sterben in der christlichen Gemein-
schaft, dem Vorlesen geistlicher Texte und den Sterbesakramenten handelt es
sich einerseits um eine vereinfachte Variante verschiedener Erzählmuster aus
Heiligenviten, andererseits allerdings auch um eine Ausgestaltung des ordo de-
functorum.™
Die spätantike Historiographie kannte unabhängig vom Christentum eben-
falls wertende Schilderungen von Herrschertoden.127 Der Wert eines Menschen
wurde dabei ebenso an der Art seines Todes bemessen.128 Im Mittelpunkt stan-
den die sittlichen Vorstellungen der privilegierten Senatorenfamilien, denen
meist sowohl die Chronisten als auch die Verstorbenen angehörten.129 Es galt
mutig und zum rechten Zeitpunkt zu sterben, sich an großen Vorbildern zu
orientieren und/oder selbst zum Vorbild für die Späteren zu werden, eine wür-
dige Haltung im Ertragen des Todes an den Tag zu legen und vor Zuschauern das
Zeitliche zu segnen.130 Aus diesen Kriterien entwickelten sich Topoi wie Vor-
zeichen oder der im Sitzen sterbende Kaiser.131 Seneca der Altere brachte die
Haltung der römischen Schreiber in seinen Ratschlägen dabei auf folgende
Formel: „Wenn die Schreiber den Tod eines bedeutenden Mannes berichten, so
ziehen sie in der Regel die Summe aus seinem ganzen Leben und geben ihm
gleichsam eine Leichenrede/'132
125 Goodich, Death, S. 237.
126 Siehe den Quellentext De transitu beatae Mariae virginis, S. 113-119: Wissen um den eigenen
Tod, ebd., S. 113f., die Gemeinschaft der Jünger, ebd., S. 116f., das Verlesen geistiger Texte, ebd.
Das Viaticum wird nicht explizit genannt, doch Schreiner, Tod, S. 259 f. argumentiert schlüssig,
dass das Anzünden großer Kerzen in der späteren Tradition mit der letzten Wegzehrung in
Verbindung gebracht wurde. Die genannten Punkte kommen auch in der wohl älteren bei
Heibach-Reinsch, Transitus, S. 63-87 edierten Fassung vor. Zum Transitus Mariae und seiner
Rezeptionsgeschichte siehe ebd.; Schreiner, Tod; ders., Maria, S. 463-490; Mimouni, Ascension. -
Zum ordo defunctorum siehe Kapitel 4.3.3., Abschnitt „Sterbebrauchtum".
127 Hergemöller, Freunde, S. 59.
128 Maßgeblich hierzu sind die wenig bekannten Arbeiten Schunk, Sterben, hier S. 1 und Arand,
Ende. Siehe auch Friedrich, Tod.
129 Arand, Ende, S. 39 f.
130 Schunk, Sterben, S. 54-93.
131 Zur Vorstellung des im Sitzen sterbenden Kaisers siehe S. 116 Anm. 600.
132 Suasorien des älteren Seneca, lib. VI, cap. 21, S. 136: Quotiens magni alicuius mors ab historicis
narrata est, totiens fere consummatio totius vitae et quasi funebris laudatio redditur. Siehe Schunk,
Sterben, S. 104.
4. Der gute und der schlechte Tod in Altertum und Mittelalter
Die Tode der Heiligen aus Heiligenviten sind als elaborierteste Ausformung
der christlichen Tradition und damit als Blaupause für einen christlichen, guten
Tod zu sehen. Dies ist dabei in der Schreibabsicht der Viten begründet, die ein
Vorbild für ein besonders christliches Leben und damit auch Sterben bieten
sollten. Einige Anzeichen eines schlechten Todes, wie der stinkende Leichnam,
sind dabei explizite Verkehrungen einzelner Elemente eines Heiligentodes. Eng
verwandt mit den Anzeichen aus Heiligenviten ist der einflussreiche Transitus
Mariae, ein bis ins 5. Jahrhundert zurückgehender Text, der vom besonders
vorbildlichen Sterben der Gottesmutter berichtet. Mit der Betonung vom Wissen
um den bevorstehenden eigenen Tod, dem Sterben in der christlichen Gemein-
schaft, dem Vorlesen geistlicher Texte und den Sterbesakramenten handelt es
sich einerseits um eine vereinfachte Variante verschiedener Erzählmuster aus
Heiligenviten, andererseits allerdings auch um eine Ausgestaltung des ordo de-
functorum.™
Die spätantike Historiographie kannte unabhängig vom Christentum eben-
falls wertende Schilderungen von Herrschertoden.127 Der Wert eines Menschen
wurde dabei ebenso an der Art seines Todes bemessen.128 Im Mittelpunkt stan-
den die sittlichen Vorstellungen der privilegierten Senatorenfamilien, denen
meist sowohl die Chronisten als auch die Verstorbenen angehörten.129 Es galt
mutig und zum rechten Zeitpunkt zu sterben, sich an großen Vorbildern zu
orientieren und/oder selbst zum Vorbild für die Späteren zu werden, eine wür-
dige Haltung im Ertragen des Todes an den Tag zu legen und vor Zuschauern das
Zeitliche zu segnen.130 Aus diesen Kriterien entwickelten sich Topoi wie Vor-
zeichen oder der im Sitzen sterbende Kaiser.131 Seneca der Altere brachte die
Haltung der römischen Schreiber in seinen Ratschlägen dabei auf folgende
Formel: „Wenn die Schreiber den Tod eines bedeutenden Mannes berichten, so
ziehen sie in der Regel die Summe aus seinem ganzen Leben und geben ihm
gleichsam eine Leichenrede/'132
125 Goodich, Death, S. 237.
126 Siehe den Quellentext De transitu beatae Mariae virginis, S. 113-119: Wissen um den eigenen
Tod, ebd., S. 113f., die Gemeinschaft der Jünger, ebd., S. 116f., das Verlesen geistiger Texte, ebd.
Das Viaticum wird nicht explizit genannt, doch Schreiner, Tod, S. 259 f. argumentiert schlüssig,
dass das Anzünden großer Kerzen in der späteren Tradition mit der letzten Wegzehrung in
Verbindung gebracht wurde. Die genannten Punkte kommen auch in der wohl älteren bei
Heibach-Reinsch, Transitus, S. 63-87 edierten Fassung vor. Zum Transitus Mariae und seiner
Rezeptionsgeschichte siehe ebd.; Schreiner, Tod; ders., Maria, S. 463-490; Mimouni, Ascension. -
Zum ordo defunctorum siehe Kapitel 4.3.3., Abschnitt „Sterbebrauchtum".
127 Hergemöller, Freunde, S. 59.
128 Maßgeblich hierzu sind die wenig bekannten Arbeiten Schunk, Sterben, hier S. 1 und Arand,
Ende. Siehe auch Friedrich, Tod.
129 Arand, Ende, S. 39 f.
130 Schunk, Sterben, S. 54-93.
131 Zur Vorstellung des im Sitzen sterbenden Kaisers siehe S. 116 Anm. 600.
132 Suasorien des älteren Seneca, lib. VI, cap. 21, S. 136: Quotiens magni alicuius mors ab historicis
narrata est, totiens fere consummatio totius vitae et quasi funebris laudatio redditur. Siehe Schunk,
Sterben, S. 104.